Kaminski, Heinrich
| Geburtsdatum/-ort: | 04.07.1886; Tiengen (Schwarzwald) |
|---|---|
| Sterbedatum/-ort: | 21.06.1946; Ried (Oberbayern) |
| Beruf/Funktion: |
|
| Kurzbiografie: | 1902 Mittlere Reife in Konstanz 1905 Abitur in Bonn 1905-06 Banklehre in Offenbach (abgebrochen) 1906-07 Studium der Nationalökonomie in Heidelberg (abgebrochen) 1907-09 Musikstudium in Heidelberg 1909 Fortsetzung in Berlin 1914 Niederlassung in Ried (bei Benediktbeuern) 1928 Beethovenpreis der Stadt Berlin 1930 Musikpreis der Stadt München 1930-33 Nachfolger Hans Pfitzners als Leiter einer Meisterklasse für Komposition an der Preußischen Akademie der Künste in Berlin, gleichzeitig Leitung der Kunstvereinskonzerte in Bielefeld 1938 Gescheiterte Berufung als Nachfolger Paul Hindemiths an der Hochschule für Musik in Berlin |
| Weitere Angaben zur Person: | Religion: altk. Verheiratet: 1916 Friederike, geb. Jopp Eltern: Vater: Paul Kaminski, altkatholischer Pfarrer Mutter: Mathilde, geb. Barro, Opernsängerin Geschwister: 5 Kinder: 5 |
| GND-ID: | GND/118776614 |
Biografie
| Biografie: | Horst Ferdinand (Autor) Aus: Badische Biographien NF 3 (1990), 143-145 Kaminski nimmt wegen der Originalität seiner esoterischen Tonsprache und des immer ins Metaphysische weisenden Anspruchs seiner Aussage eine Sonderstellung unter den Komponisten der ersten Jahrhunderthälfte ein. Das in seiner Vielseitigkeit imponierende Werkverzeichnis weist aus, wie der „mystische Gotiker, romantische Ekstatiker“ (K. Honolka) Kaminski, ausgehend von den traditionellen musikalischen Formen wie Choral, Messe oder Motette und immer wieder dahin zurückkehrend, im Lauf seiner Entwicklung den Weg zu den östlichen Weisheiten Zarathustras und Buddhas suchte; bei allen seinen Kompositionen wurde er von einer dogmatisch oder konfessionell nicht gebundenen religiösen Grundströmung getragen. Kaminskis Lebensbahn war steinig, zeitlebens wurde er von Existenzsorgen geplagt. Zu der vom Vater gewünschten Aufnahme des (altkatholischen) Theologiestudiums kam es erst gar nicht; Versuche, einen bürgerlichen Beruf zu erlernen, scheiterten schnell. Aber in Heidelberg, bei zuerst nebenbei betriebenen Musikstudien, erkannte er seine Berufung: Philipp Wolfrum riet dem 22jährigen, die dort aufgenommenen Studien am Sternschen Konservatorium in Berlin fortzusetzen. Von Seiten der Eltern war für solche Eskapaden des fünften von sechs Kindern keine Unterstützung zu erwarten, aber uneigennützige Mäzene ermöglichten ihm, der nunmehr als endgültig erkannten Bestimmung zum Tonsetzer zu folgen und dem rasch aufbrechenden Schöpferdrang zu leben. Martha Warburg in Hamburg, Anna Hirzel-Langenhan in München, Werner Reinhart in Winterthur und später der Bärenreiterverlag in Kassel stellten sicher, daß sich die reichen Talente des jungen, völlig mittellosen Komponisten unter der Obhut erprobter Meister wie Paul Juon, Hugo Kaun und Wilhelm Klatte entfalten konnten. Schon in Berlin, wo Edwin Fischer und Otto Klemperer seine Studiengefährten waren, entstand ein erstes Meisterwerk, der „130. Psalm“ für vielstimmigen gemischten Chor. Aber die Hektik des Großstadtlebens stieß Kaminski ab. In der Abgeschiedenheit des Isartals fand er sein Tusculum, und hier sind die meisten seiner Werke entstanden. Zunächst wohnte er in der Nachbarschaft seines Freundes Franz Marc, nach dem Tod des Malers (Verdun 1916) siedelte er 1921 auf Einladung der Witwe mit seiner großen Familie in dessen Haus über und blieb darin bis zum Ende seines Lebens. In den Zwanzigerjahren wurde Kaminski zu einer Berühmtheit, seine Werke wurden häufig von namhaften Interpreten in den deutschen Musikzentren aufgeführt. Bruno Walter hob 1920 den „130. Psalm“ aus der Taufe, ohne besonderes Echo, während Kaminski bald darauf mit seinem „69. Psalm“ bei einem Tonkünstlerfest in Nürnberg einen überzeugenden Erfolg errang. Wilhelm Furtwängler interessierte sich für ihn, aber – durch äußere Umstände bedingt – kam es erst 1934 zu einer Zusammenarbeit, der Aufführung der „Dorischen Musik“ Kaminskis mit den Berliner Philharmonikern. Auch andere Werke erlebten in diesen Jahren erfolgreiche Wiedergaben, vor allem das „Magnificat“ für Solosopran, Viola, Orchester und Fernchor, sein bekanntestes Werk, neben Kompositionen wie dem mächtigen „Concerto grosso“ und dem Quintett für Klarinette, Hörn und Streicher. Wieder war es einer der Großen der Zunft, Fritz Busch, der seine erste Oper „Jürg Jenatsch“ im Jahre 1928 in Dresden aufführte. Aber der in sich versponnene Kaminski war alles andere als der geborene Musikdramatiker. „Als Textdichter für seine Bühnenwerke hat er sich offenbar übernommen“ (W. Scharff). Dies dürfte auch für das letzte Opus, den „König Aphelius“, gelten, den Kaminski für sein vollkommenstes Werk hielt. – In den Jahren des äußeren Erfolgs sammelte sich ein kleiner Kreis treuer Schüler um ihn, unter ihnen Carl Orff, Reinhard Schwarz-Schilling und Horst Günther Schnell, der seine spätere Ehefrau Luise Rinser in Ried einführte. (Das von der Schriftstellerin nach Jahrzehnten gezeichnete Persönlichkeitsbild Kaminskis ist nicht mehr als eine unerfreuliche Karikatur). Eine immerhin drei Jahre währende Bindung an wichtige Ämter in der damaligen Musikwelt – Kaminski leitete eine Meisterklasse für Komposition in Berlin und zeichnete gleichzeitig für das Musikleben der Stadt Bielefeld verantwortlich – blieb Episode. Kaminskis organisatorisch-pädagogische Fähigkeiten, auch in der Leitung eines Orchesters, standen nicht auf der Stufe seiner Kompositionen. Außerdem war ihm, dessen Lebensinhalt in der völligen künstlerischen Freizügigkeit bei der „Klangwerdung ewiger Lebensgesetze“ bestand, die beamtenmäßige Fixierung auf ein Amt mit festen Dienststunden ein Greuel. Eben diese Verfassung seiner Persönlichkeit machte ihn zum natürlichen Gegner der im Jahre 1933 einsetzenden Reglementierung und Gleichschaltung. Das kam zunächst nicht zum Ausdruck, im Gegenteil, es wurde ihm bescheinigt, daß er „in dem Chaos der Experimente entwurzelter Artisten seine geistige Stellung bewahrt“ habe: „Etwas Mönchisches, Asketisches dominierte in seiner Musik, die heute zu den wertvollsten Bestandteilen der deutschen Musik zählt. Das neue Deutschland wird gewiß die Tiefe seiner Persönlichkeit besser begreifen können als die in wurzellosem Musikbetrieb verhaftete Generation nach dem Kriege ...“ (Friedrich W. Herzog, 1934). Aber es kam ganz anders. Als Kaminski im Jahre 1938 die Nachfolge Hindemiths in Berlin antreten sollte, fanden die Gewaltigen vom „Sippenamt“ heraus, daß er eine „nichtarische“ Großmutter hatte. Drei Jahre lang, bis 1941, durften seine Werke nicht mehr aufgeführt werden; das Verbot wurde erst aufgehoben, als der Nachweis des „arischen“ Ehemannes der Großmutter erbracht war. Kaminskis wirtschaftliche Lage wurde durch das Aufführungsverbot immer prekärer, und weitere Schicksalsschläge verdüsterten die ohnehin notvollen Kriegsjahre: zwei Töchter starben früh, ein Sohn blieb im Felde, und eine Krebserkrankung überfiel den einsamen Dulder in seiner Komponistenklause. Er raffte die letzten Kräfte zusammen, um den „König Aphelius“ zu vollenden (1946). Die Erstaufführung in Bielefeld (1951) erlebte er nicht mehr; aber auch dieses aus Elementen des Sprech-, Tanz- und Musiktheaters bestehende und ideenreiche – zu reiche – Stück konnte sich keinen dauernden Platz in den Opernspielplänen erobern. „Für Kaminski bedeutete Musikschreiben eine heilige Handlung“ (I. Samson). Seine dabei verfolgten Intentionen hat er selbst beschrieben: „Wir wollen keinen anderen Maßstab gelten lassen als diesen: daß, was als Kunstwerk uns entgegentritt und also 'Leben' uns verheißt, daß das auch irgendwie uns 'Leben' spende. Tut's das, und ist es gar Musik: die reinste, höchste Offenbarung jener ewigen Gesetze, die menschlichem Geist gegeben ist, so wollen wir das uns daraus entgegenblühende Leben froh und dankbar in uns einströmen lassen, rückhaltlos ihm die Tore unserer Seele weit, weit öffnend.“ Kaminski ging von der Polyphonie Bachs aus, machte sich jedoch von dem musikalischen Prinzip, das der Epoche den Namen gab, dem Generalbaß, unabhängig und gelangte zu einer den „gotischen“ Vorgängern Bachs benachbarten „Gruppenpolyphonie“ (F. von Hößlin), in der der Eigenwert und die individuelle Selbständigkeit jeder einzelnen Stimme vorwalten. Gleichwohl betonte er oft die akkordisch-harmonische Klangstruktur. Für seine Kompositionsweise sind auch Versuche charakteristisch, mit häufig wechselnden Rhythmen – „Polyrhythmik“ – die herkömmlichen metrischen Grenzen zu überschreiten. Wenn Kaminski auch nicht, bei aller Eigenständigkeit seines Lebenswerks, zu den Großen der Musikgeschichte gerechnet werden kann, gebührte ihm doch in der Wertschätzung der musikalischen Nachwelt ein höherer Rang, als ihm tatsächlich eingeräumt wird. An geglückten Versuchen, Kaminskis Werk dem heutigen musikinteressierten Publikum näherzubringen, hat es besonders im Jahr der 100. Wiederkehr seiner Geburt (1986) nicht gefehlt, und der im Jahre 1987 gegründeten Heinrich-Kaminski-Gesellschaft in Waldshut ist Erfolg bei ihren Bestrebungen zu wünschen, das Oeuvre des in der Absolutheit seines Ethos und der romantischen Introvertiertheit seiner Kompositionen urdeutschen Solitärs H. Kaminski wiederzubeleben. |
|---|---|
| Werke: | Über die im Text genannten Werke hinaus vgl. R. Schwarz-Schilling/K. Schleifer, H. Kaminski, Werkverzeichnis (Kassel 1946). |
| Nachweis: | Bildnachweise: in MGG 7 Sp. 571. |
Literatur + Links
| Literatur: | I. Samson, Das Vokalschaffen von H. Kaminski mit Ausnahme der Opern, Frankfurt a. M. 1956; J. Samson, H. Kaminski, in: MGG 7 Sp. 470-475 (dort ausführliche Literaturangaben); ergänzend: Kaminski H., in: BbG 8, 1979, 550; ferner: F. W. Herzog, Werkbild eines deutschen Komponisten, in: Ekkhart 1934, 80-93; Kaminski Honolka, Weltgeschichte der Musik, Eltville 1976, 576; Thomas-M. Langner, H. Kaminski, in: NDB 11, 1977, 80 f.; Luise Rinser, Den Wolf umarmen, Frankfurt/M. 1984, 320-330; W. Scharff, H. Kaminski (1886-1946), Nachdenkliches zum 100. Geburtstag des in Tiengen geborenen Komponisten, in: Heimat am Hochrhein, Konstanz 1987, 198-208. |
|---|







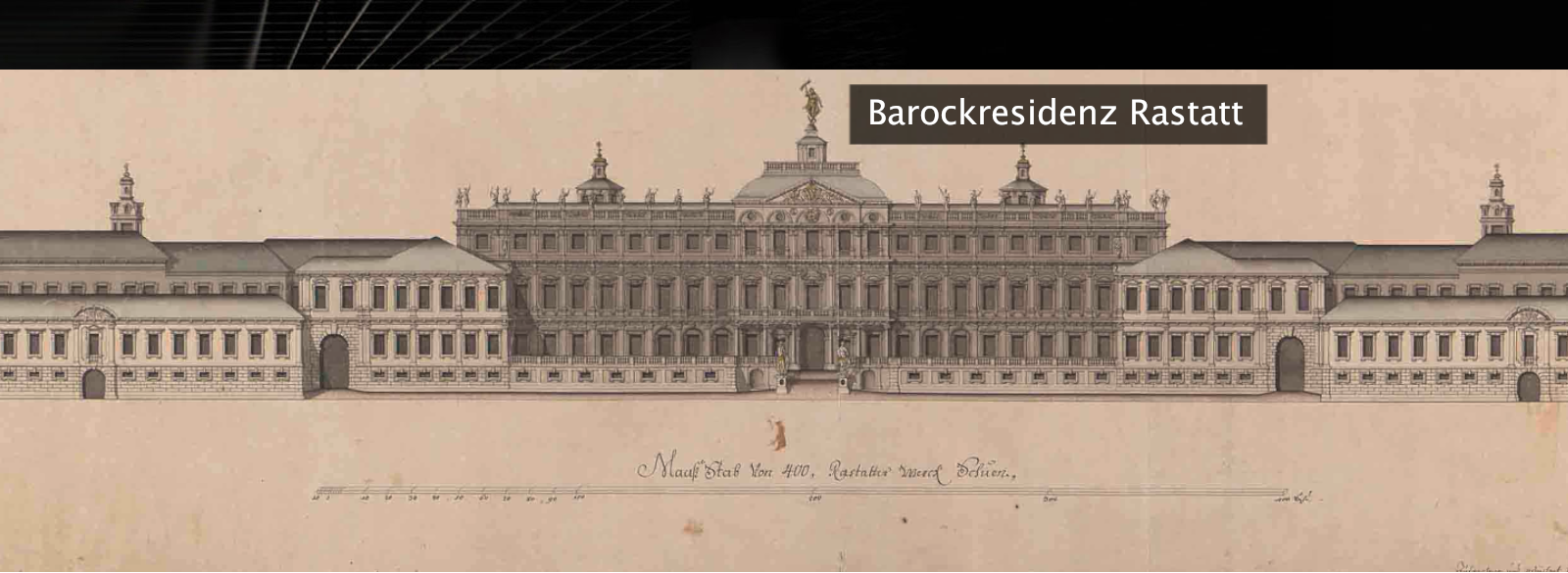



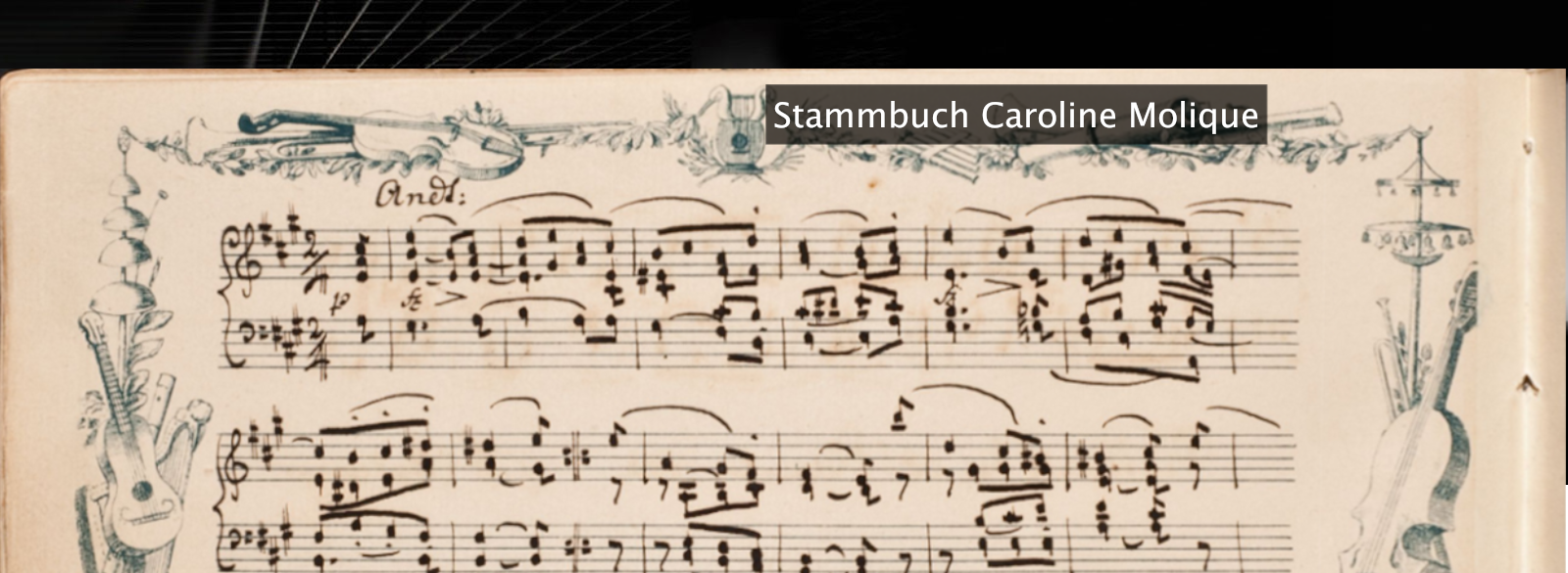







 leobw
leobw