Malsch
![Luftbild: Film 103 Bildnr. 183, Bild 1]()
Luftbild: Film 103 Bildnr. 183, Bild 1 [Quelle: Landesarchiv BW] /
Zur Detailseite ![Luftbild: Film 17 Bildnr. 119, Bild 1]()
Luftbild: Film 17 Bildnr. 119, Bild 1 [Quelle: Landesarchiv BW] /
Zur Detailseite ![Luftbild: Film 103 Bildnr. 185, Bild 1]()
Luftbild: Film 103 Bildnr. 185, Bild 1 [Quelle: Landesarchiv BW] /
Zur Detailseite ![Luftbild: Film 17 Bildnr. 117, Bild 1]()
Luftbild: Film 17 Bildnr. 117, Bild 1 [Quelle: Landesarchiv BW] /
Zur Detailseite ![Luftbild: Film 103 Bildnr. 182, Bild 1]()
Luftbild: Film 103 Bildnr. 182, Bild 1 [Quelle: Landesarchiv BW] /
Zur Detailseite ![Luftbild: Film 17 Bildnr. 118, Bild 1]()
Luftbild: Film 17 Bildnr. 118, Bild 1 [Quelle: Landesarchiv BW] /
Zur Detailseite ![Luftbild: Film 17 Bildnr. 115, Bild 1]()
Luftbild: Film 17 Bildnr. 115, Bild 1 [Quelle: Landesarchiv BW] /
Zur Detailseite ![Luftbild: Film 17 Bildnr. 116, Bild 1]()
Luftbild: Film 17 Bildnr. 116, Bild 1 [Quelle: Landesarchiv BW] /
Zur Detailseite ![Luftbild: Film 104 Bildnr. 33, Bild 1]()
Luftbild: Film 104 Bildnr. 33, Bild 1 [Quelle: Landesarchiv BW] /
Zur Detailseite ![Malsch, Luftbild 1979]()
Malsch, Luftbild 1979 [Copyright: Landesmedienzentrum Baden-Württemberg; 27.11.1979] /
Zur Detailseite ![Luftbild: Film 104 Bildnr. 37, Bild 1]()
Luftbild: Film 104 Bildnr. 37, Bild 1 [Quelle: Landesarchiv BW] /
Zur Detailseite ![Luftbild: Film 104 Bildnr. 35, Bild 1]()
Luftbild: Film 104 Bildnr. 35, Bild 1 [Quelle: Landesarchiv BW] /
Zur Detailseite ![Luftbild: Film 103 Bildnr. 181, Bild 1]()
Luftbild: Film 103 Bildnr. 181, Bild 1 [Quelle: Landesarchiv BW] /
Zur Detailseite ![Luftbild: Film 104 Bildnr. 36, Bild 1]()
Luftbild: Film 104 Bildnr. 36, Bild 1 [Quelle: Landesarchiv BW] /
Zur Detailseite ![Luftbild: Film 104 Bildnr. 34, Bild 1]()
Luftbild: Film 104 Bildnr. 34, Bild 1 [Quelle: Landesarchiv BW] /
Zur Detailseite ![Luftbild: Film 104 Bildnr. 38, Bild 1]()
Luftbild: Film 104 Bildnr. 38, Bild 1 [Quelle: Landesarchiv BW] /
Zur Detailseite ![Wappen von Malsch]()
In gespaltenem Schild vorn in Blau ein durchgehendes, geschliffenes, halbes silbernes (weißes) Kreuz am Spalt, hinten in Rot das silberne (weiße) Ortszeichen (Sester). /
Zur Detailseite ![Luftbild: Film 103 Bildnr. 184, Bild 1]()
Luftbild: Film 103 Bildnr. 184, Bild 1 [Quelle: Landesarchiv BW] /
Zur Detailseite Previous Next Die Gemeinde Malsch liegt an der Südgrenze des Rhein-Neckar-Kreises zum Landkreis Karlsruhe. Das Gemeindegebiet erstreckt sich am Westrand des Kraichgauer Hügellandes in der Langenbrückener Senke, hat aber im Westen noch Anteil an der Gebirgsrandniederung. Naturräumlich gehört es zu den übergeordneten Einheiten der Hardtebenen im Westen sowie flächenmäßig überwiegend zum Kraichgau. Der höchste Punkt liegt im Osten auf 242,70 m, der tiefste Punkt im Westen auf 92,08 m. Das Gemeindegebiet hat Anteil an den Naturschutzgebieten Altenbachtal und Galgenberg, Hochholz-Kapellenbruch (3 Teilgebiete) und Malscher Aue. Malsch kam 1803 an das Großherzogtum Baden und wurde ab 1804 dem neuen badischen Amt Kislau zugewiesen. 1824 wurde die Gemarkung von Malschenberg abgetrennt. Von 1910-1938 gehörte die Gemeinde zum Bezirksamt Wiesloch und kam dann zum Landkreis Heidelberg. Seit der Auflösung dieses Landkreises im Zuge der Verwaltungsreform 1973 gehört Malsch zum Rhein-Neckar-Kreis. Die Gemeinde ist Mitglied im Gemeindeverwaltungsverband Rauenberg. Seit 1945 hat die Gemeinde ihre Siedlungsfläche stark vergrößert. Bis zur Mitte der 1960er Jahre wurden große neubaugebiete im Westen und Süden und vor allem im Osten des Ortes geschaffen. Diese wurden in der folgenden Dekade um weitere Flächen am Südwestrand sowie im Nordosten ergänzt. Ab Ende der 1970er Jahre entstand ein kleineres Baugebiet im Südwesten, ab Ende der 1990er Jahre wurden weitere kleine Flächen im Nordosten und Nordwesten ausgewiesen. Malsch ist über die L546 und L635 sowie die nahen B3 und A6 an das Fernstraßennetz angeschlossen. Mit dem Bahnhof Rot-Malsch an der 1840-63 erbauten Baden-Kurpfalz-Bahn besteht ein Anschluss an die S-Bahn RheinNeckar. Der ÖPNV wird durch weitere Buslinien des Verkehrsverbundes Rhein-Neckar sichergestellt.
Die Gemarkung liegt im Westrand des Kraichgauer Hügellandes und hat im Westen noch Anteil an der mit Bruchwäldern und Wiesen bedeckten Gebirgsrandniederung. Der Kraichgauanteil liegt in der Langenbrückener Senke. Tertiär-, Keuper- und Juraschichten bilden den Untergrund. Das Oberflächenbild wird im östlichen Gemarkungsteil ganz vom Letzenberg beherrscht, dessen Steilabfall im Oberen Keuper liegt.
![]()
Wanderungsbewegung Malsch
![]()
Natürliche Bevölkerungsbewegung Malsch
![]()
Bevölkerungsdichte Malsch
![]()
Altersstruktur Malsch
![]()
Bundestagswahlen (ab 1972) Malsch
![]()
Europawahlen Malsch
![]()
Landtagswahlen (ab 1972) Malsch
![]()
Schüler nach Schularten Malsch
![]()
Übergänge an weiterführende Schulen Malsch
![]()
Beschäftigte nach Wirtschaftsbereichen (aktuell) Malsch
![]()
Aus- und Einpendler Malsch
![]()
Bestand an Kfz Malsch
Previous Next 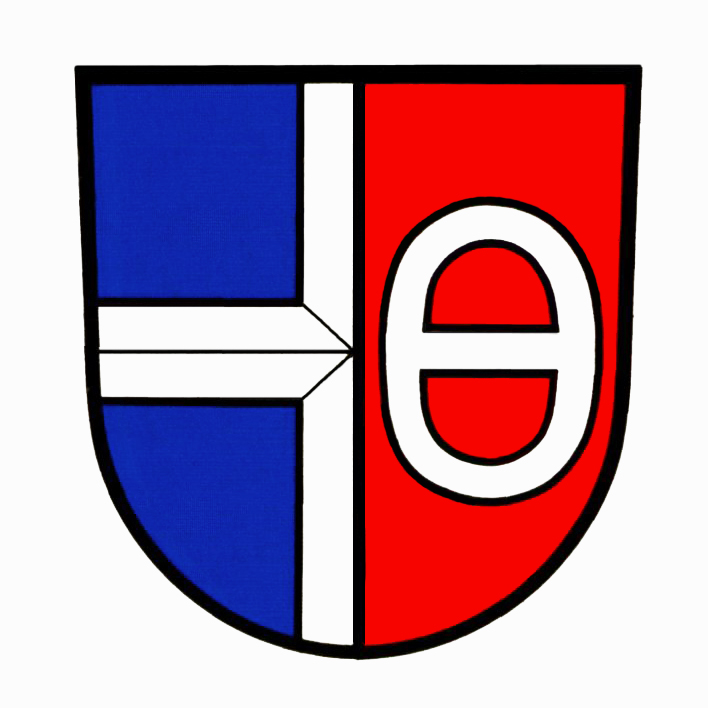
In gespaltenem Schild vorn in Blau ein durchgehendes, geschliffenes, halbes silbernes (weißes) Kreuz am Spalt, hinten in Rot das silberne (weiße) Ortszeichen (Sester).
Beschreibung Wappen
Bereits 1494 ist ein Gerichtssiegel des von 1302 bis 1802 zum Hochstift Speyer gehörenden Ortes bezeugt, Abdrucke sind jedoch erst aus dem Jahre 1523 erhalten. Sie zeigen einen Weinstock, ein Hinweis auf die große Bedeutung des Weinbaus im Ort seit dem Mittelalter. Erst im 18. Jahrhundert benutzte die Gemeinde wieder ein Siegel (Abdruck 1775), das jetzt das Dorfzeichen zeigte: eine „waagrecht durchstrichene Null", ein auch von anderen Gemeinden benutztes und allgemein als Sester (Getreidemaß) gedeutetes Zeichen. Auf Vorschlag des Generallandesarchivs nahm die Gemeinde im Jahre 1900 das Dorfzeichen und das halbe Speyerer Kreuz als Wappen an. Die nicht korrekt aus dem Wappen abgeleitete Flagge wurde schon vor 1935 geführt.
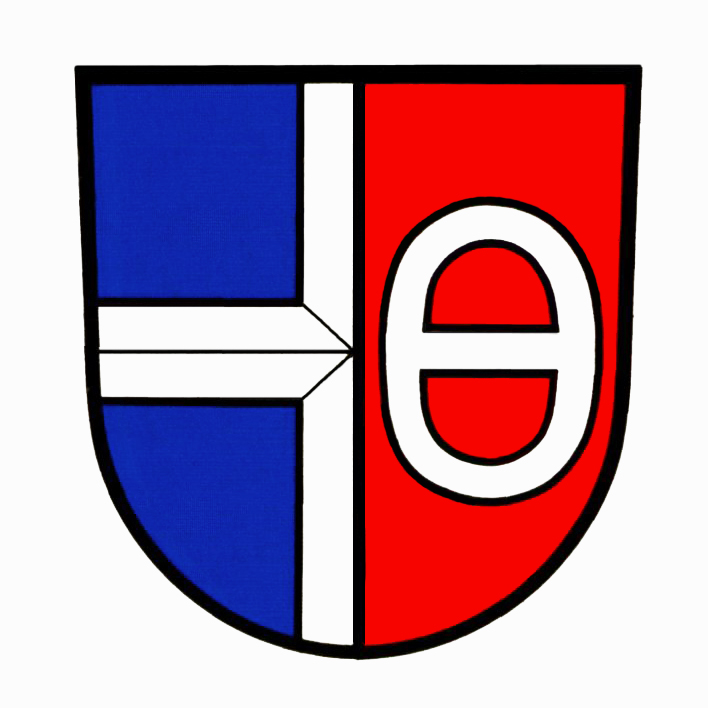



































































 leobw
leobw