Mannheim, Karl
| Andere Namensformen: |
|
|---|---|
| Geburtsdatum/-ort: | 28.03.1893; Budapest |
| Sterbedatum/-ort: | 09.01.1947; London |
| Beruf/Funktion: |
|
| Kurzbiografie: | 1911 Beginn d. Bekanntschaft mit Georg Lukács 1911–1918 Studium d. Philosophie, Pädagogik u. Literaturwissenschaft in Budapest, 1911/12, Berlin, 1913–15, Paris, 1914, u. wieder Budapest, 1915–18 1915 Mitbegründer des „Sonntagskreises“ 1917 Mitbegründer d. aus dem „Sonntagskreis“ hervorgegangenen „Freien Schule d. Geisteswissenschaften“ 1918 Promotion: „Die Struktur d. Erkenntnistheorie“ 1919–1920 während d. Räterepublik Professor für Kulturphilosophie an d. Univ. Budapest; nach Sturz d. Räteregierung Emigration nach Deutschland 1921–1930 Heidelberg 1926 nach d. Habilitation mit einer Arbeit über „Altkonservatismus“ Habilitation bei Alfred Weber u. Ernennung zum Privatdozenten für Soziologie 1930–1933 o. Professor für Soziologie und Nationalökonomie an d. Univ. Frankfurt 1933 Entlassung nach d. NS-„Machtübernahme“; Emigration nach London 1933ff. Anstellung an d. London School of Economics and Political Science 1940 britische Staatsbürgerschaft 1941–1947 Lecturer am Institute of Education, ab 1945 Professor of Education u.Chairman |
| Weitere Angaben zur Person: | Religion: isr. Verheiratet: 1921 (Heidelberg) Julia, geb. Láng (1893–1955) Eltern: Vater: Gusztáv (Gustav), Textilhändler Mutter: Rosa, geb. Eylenburg Geschwister: keine Kinder: keine |
| GND-ID: | GND/118577190 |
Biografie
| Biografie: | Rolf Wiggershaus (Autor) Aus: Baden-Württembergische Biographien 6 (2016), 321-326 Mannheim, bekannt vor allem als Begründer der Wissenssoziologie, gehört zu den Klassikern der Soziologie, die zwischen 1890 und 1930 das Profil dieser Disziplin prägten. Dieser Ansatz rückt die Analyse der Struktur und der Funktion von menschlicher Vergesellschaftung in den Mittelpunkt und konnte erst allmählich und gegen Widerstände an den Universitäten Fuß fassen. Mannheim, Sohn eines Budapester wohlhabenden ungarisch-jüdischen Textilhändlers und einer deutschjüdischen Mutter, führte von früh an ein der Bildung gewidmetes Leben. Nach der Gymnasialzeit studierte Mannheim in verschiedenen Städten – auch ausländischen wie Berlin, wo er unter anderem den Philosophen und Soziologen Georg Simmel (1858–1918) hörte – und nach dem Staatsexamen in deutscher und französischer Sprachwissenschaft und Literaturgeschichte promovierte er. Gleichzeitig gehörte Mannheim zu den Begründern und zentralen Mitgliedern des Sonntagskreises. Dessen intellektueller Mittelpunkt war Georg Lukács, acht Jahre älter als Mannheim, Philosoph und Autor einer „Entwicklungsgeschichte des modernen Dramas“ und der Essaysammlung „Die Seele und die Formen“ und während mehrjähriger Aufenthalte in Heidelberg hochgeschätztes Mitglied des Max-Weber-Kreises. Mannheim wirkte ebenfalls an der aus dem „Sonntagskreis“ hervorgegangenen Freien Schule der Geisteswissenschaften mit, die eine Art private Gegenuniversität zur offiziellen Institution bildete. In Vorträgen zu Metaphysik, Erkenntnistheorie, Ethik und Kulturphilosophie ging es um die „Suche nach einer höheren geistigen Weltanschauung und einem höheren Leben“ (Karády/Vezér, Hgg., Sonntagskreis, S. 12). Als Lukács zur Überraschung selbst seiner engsten Freunde Ende 1918 Mitglied der jungen Kommunistischen Partei Ungarns wurde, gehörte Mannheim zu denen, die eine solche politische Bindung ablehnten und distanziert blieben. Doch als Lukács im März 1919 Volkskommissar für das Unterrichtswesen in der Räteregierung Béla Kun wurde, viele Stellen neu besetzte und dabei Teilnehmer des Sonntagskreises zum Zuge kamen, übernahm Mannheim eine Professur für Kulturphilosophie am Pädagogischen Seminar der Lehrerfortbildungsschule der Budapester Universität. Nach dem Sturz der Räterepublik verließ Mannheim Ungarn, da er dort keine Zukunftsperspektive für sich sah. Zusammen mit seiner späteren Frau Julia Lang, einer Psychologin, die ebenfalls einer Budapester Unternehmerfamilie entstammte und Teilnehmerin am Sonntagskreis war, emigrierte er über Wien nach Deutschland. Dort setzte er seine Studien als Privatgelehrter an den Universitäten in Freiburg im Breisgau, bei den Philosophen Edmund Husserl und Martin Heidegger, dann in Berlin fort. Schließlich ließ das Paar sich im März 1921 in Heidelberg nieder, der Wirkungsstätte von Max und Alfred Weber, wo dank der wiederholten Aufenthalte von Lukács auch Budapester Intellektuelle mit wohlwollender Aufnahme rechnen konnten. Max Weber, dessen Lektüre Mannheim zu soziologischen Studien angeregt hatte, war inzwischen gestorben. Doch bei seinem Bruder Alfred Weber und bei Emil Lederer (1882–1939), einem Schüler Max Webers, konnte Mannheim sich volkswirtschaftlichen und soziologischen Studien widmen, neben denen philosophische bei dem Neukantianer Heinrich Rickert (1863–1936) eine immer geringere Rolle spielten. Dass er zum Freundeskreis von Lukács gehörte, erleichterte Mannheim den Zugang zum Haus Marianne Webers, der Witwe Max Webers, wo sich „in regelmäßigen Abständen ein Teil der Heidelberger Universitätselite“ (Elias über sich selbst, 1990, S. 126) versammelte. Seit seinem ersten Heidelberger Sommer veranstaltete Mannheim in seiner Wohnung auch schon private Seminare. So wurde Heidelberg für ihn rasch zu einem Ort, an dem er vom Philosophen zum Soziologen wurde und – noch ohne offizielle akademische Stelle – als Privatgelehrter und Intellektueller seine pädagogischen und soziologischen Talente entfalten konnte. Heidelbergs geistiges Leben habe zwei Pole, meinte Mannheim im Herbst 1921 im ersten seiner Heidelberger Briefe. Den einen bildeten die Soziologen, den anderen die Georgeaner. Der Idealtypus der einen sei Max Weber, der der anderen Stefan George. Der George-Kreis stellte für ihn das Beispiel einer „‘charismatischen‘ Gemeinschaft“ (Mannheim, Heidelberger Briefe, in: E. Karádi u.a., Hgg., Sonntagskreis, 86) dar. Sie bot dem in der modernen Gesellschaft einsam gewordenen Intellektuellen eine seelische Heimat, doch nur um den Preis einer Entfremdung von der Welt und von sich selbst. Wie der Intellektuelle eine seelische Heimat finden könnte, ohne die Augen vor der Welt und der eigenen Position in ihr zu verschließen – das war eine Problemstellung, mit der Mannheim weiterhin in der Tradition des Budapester Sonntagskreises stand. Während Lukács in der Aufsatzsammlung „Geschichte und Klassenbewusstsein“ (1923) die Aufgabe des Intellektuellen darin sah, dem Proletariat zum Bewusstsein seiner Bestimmung als Subjekt einer neuen, die Wirklichkeit erschließenden Weltsicht zu verhelfen, wurde Mannheim zum Kultursoziologen und wichtigsten Begründer der Wissenssoziologie. Seine Habilitationsschrift über das konservative Denken präsentierte er als einen „Beitrag zur Soziologie des Wissens“. Die philosophischen Disziplinen und die Ideengeschichte untersuchten das Denken unter Absehung von seiner geschichtlich-gesellschaftlichen Genesis. Der Wissenssoziologie dagegen gehe es darum, so Mannheim, „die vorhandenen Gedankenmassen in jener historisch-soziologischen Gesamtkonstellation, aus der sie jeweils genuin hervorgetreten sind, zurückzuverankern und ihr Emporkommen vom Totalprozess her zu verstehen“ (Mannheim, Konservatismus, 1984, S. 48). Mannheims Habilitationsarbeit, von Emil Lederer und Alfred Weber enthusiastisch empfohlen, wurde von der Fakultät rasch angenommen. Ein Problem ergab sich, als die Frage aufkam, ob man Mannheim nicht zunächst auffordern solle, die deutsche Staatsbürgerschaft zu erwerben. Nur weil Weber und Lederer sich dafür verbürgten, dass Mannheim „weder früher je politisch hervorgetreten“ sei noch „nach seiner ganzen Anlage und seinen Neigungen sich je betätigen wird“ (D. Kettler u.a., Hgg., Mannheim u. d. Konservatismus, in: Mannheim, Konservatismus, 18) wurde das Problem vertagt. So wurde Mannheim 1926 in Heidelberg Privatdozent für Soziologie und bald auch deutscher Staatsbürger, doch nicht ohne dass sein Bewusstsein dafür wachgehalten wurde, dass er kein etablierter Zugehöriger war, sondern einer ungarischen Diaspora angehöre. Mannheims Durchbruch zum meistdiskutierten Soziologen der Weimarer Republik erfolgte in den späten 1920er-Jahren: mit seinem Vortrag über „Die Bedeutung der Konkurrenz im Gebiete des Geistigen“ auf dem sechsten Deutschen Soziologentag in Zürich im September 1928 und der Publikation der Essaysammlung „Ideologie und Utopie“ 1929. Karl Marx hatte einst im Vorwort seiner Schrift „Zur Kritik der Politischen Ökonomie“ angesichts der bisherigen Menschheitsgeschichte als allgemeines Resultat seiner Untersuchungen formuliert, es sei nicht das Bewusstsein der Menschen, das ihr Sein, sondern umgekehrt ihr gesellschaftliches Sein, das ihr Bewusstsein bestimme. In Anlehnung daran sprach Mannheim von „seinsgebundenem“ oder „seinsverbundenem Denken“. Dabei hatte er, anders als Marx, nicht Konflikte und Kämpfe im Bereich der Produktionsverhältnisse und der ökonomischen Struktur der Gesellschaft im Blick. Die Kämpfe, um die es bei ihm ging, drehten sich um – wie er, aus Martin Heideggers 1927 erschienener Abhandlung „Sein und Zeit“ zitierend, formulierte – die „öffentliche Auslegung des Seins“ (Schriften zur Wirtschafts- und Kultursoziologie, 2009, S. 90). Dem naturwissenschaftlichen Denken gestand Mannheim Seinsungebundenheit zu, also Objektivität und Wirklichkeitsadäquatheit. Alles übrige Denken – historisches, politisches und Alltags-Denken und ausdrücklich auch das der Geistes- und Sozialwissenschaften – rechnete er zum seinsgebundenen Denken. Das bedeute aber keineswegs Relativismus. So könne es nur erscheinen, wenn man fälschlicherweise die exakten Naturwissenschaften als Maßstab allen Denkens und Wissens betrachte. Seinsgebundenes Denken würde nicht etwa von ihm als willkürlich entlarvt, sondern als perspektivisch begriffen. Gewisse Wahrheiten seien nur bestimmten Bewusstseinsstrukturen zugänglich. Man müsse in der Geistesgeschichte in „Denkstilen“ denken lernen und den Kampf der „Denkstile“ analysieren. Man müsse aber auch eine Freiheit des Blicks für Synthesen bewahren. Doch wie sollte man sich das vorstellen, wenn alles Denken außer dem exakten naturwissenschaftlichen seinsgebunden und perspektivisch war? Wer könnte unter welchen Bedingungen dazu in der Lage sein? Eine Antwort darauf suchte Mannheim in der Aufsatzsammlung „Ideologie und Utopie“ zu geben, die zu seinem Hauptwerk wurde. Die gegenwärtige Situation, so Mannheim, sei gekennzeichnet durch eine Pluralität von Weltanschauungen mit Liberalismus, Konservatismus und Sozialismus als zentralen Typen. Bisher habe man die eigene Position verabsolutiert, andere Positionen für ideologisch erklärt. Nun aber gebe es zu viele geistig gleich mächtige und gleichwertige Positionen, als dass sie sich nicht gegenseitig relativieren müssten. Das bedeute aber nicht nur, dass damit alles gleichermaßen als ideologiehaft erscheine, sondern auch, dass die Einsicht in die Partikularität der einzelnen Standorte die Aussicht auf eine Lockerung verfestigter Positionen und auf die Bereitschaft zu deren Ergänzung eröffne. Relational und dynamisch zu denken zeichnete in Mannheims Augen den aus, der – Partikularsichten aufgreifend – an deren Erweiterung arbeitete. Doch wer waren die, die dazu in der Lage und von solcher Intention getrieben waren? Zu seiner Antwort gelangte der 35-jährige Privatdozent durch die Analyse eigener Erfahrungen. Eine „auf die Dynamik und Ganzheit ausgerichtete Haltung“ (Ideologie und Utopie, 1929, S. 135) schrieb er einem bestimmten Segment der Intellektuellen zu, die er mit dem von Alfred Weber übernommenen Begriff der „sozial freischwebenden Intelligenz“ bezeichnete. Sie war keiner einzelnen Schicht oder Klasse zuzuordnen, erneuerte sich aus einer sich stets erweitern - den sozialen Basis und war dank der Fähigkeit, sich in die sich bekämpfenden Kräfte einzufühlen, von einer Tendenz zur dynamischen Synthese erfüllt. Mannheim unterschied idealtypisch zwischen zwei Wegen, die sich bei der freischwebenden Intelligenz tatsächlich beobachten ließen. Der eine war der eines direkten Anschlusses an eine der sich bekämpfenden Klassen und Parteien im Zeichen einer dynamischen Synthese, die bewusst oder unbewusst sein konnte. Für diesen Weg stand idealtypisch Lukács. Der andere Weg bestand in der Bewusstmachung der eigenen sozialen Position dieser Intellektuellen, die sie dazu prädestinierte, „Anwalt der geistigen Interessen des Ganzen zu sein“ (ebd. S. 138). Das entsprach Mannheims Selbstverständnis als Intellektueller, der mit der Wissenssoziologie im Rahmen der Universität einen Ort für synthetische Forschung und für eine Gesamtorientierung im Geschehen bot und „Politik als Wissenschaft“ ermöglichte. Eben das – Synthese und Gesamtorientierung – wollte das Berliner Ministerium für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung fördern. Gleichzeitig war der Kurator der Frankfurter Universität, Kurt Riezler, darauf bedacht, die noch junge Universität durch die Berufung herausragender und innovativer Persönlichkeiten zu einer lebendigen und bedeutenden Bildungsstätte zu machen. Von beiden Seiten gefördert, wurde Mannheim gegen den Wunsch der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät auf den Frankfurter Lehrstuhl für Soziologie berufen – einen der wenigen, die es in Deutschland und weltweit damals gab. Die von Mannheim, der zugleich Direktor des Soziologischen Seminars war, und von seinem Assistenten Norbert Elias (1897–1990) genutzten Räume befanden sich im Gebäude des von Hermann und Felix Weil gestifteten „Instituts für Sozialforschung“, das vertragsgemäß die Parterre- Räume der Universität überließ. Direktor des Weilschen Forschungsinstituts und Ordinarius für Sozialphilosophie auf einem ebenfalls von Felix Weil gestifteten Lehrstuhl wurde im Jahr von Mannheims Ankunft in Frankfurt der zwei Jahre jüngere Max Horkheimer. Er hatte zu den vielen gehört, die sich mit Mannheims „Ideologie und Utopie“ kritisch auseinandersetzten, und dem Autor vorgeworfen, seine Wissenssoziologie nutze „einige Stücke aus der Rüstkammer des Marxismus“, um dann aber mit ihnen in die Höhen der Gegensätze von „Denkstilen“ und „Weltanschauungssystemen“ zurückzukehren (Horkheimer, Ein neuer Ideologiebegriff?, in: ders., Ges. Schr. 2, 294). Horkheimer selbst vertrat als Leiter des großzügig ausgestatteten Weilschen Instituts das Programm eines deutlich marxistisch orientierten interdisziplinären Materialismus. Es bestand ein weitgehend beziehungsloses Nebeneinander der beiden sozialwissenschaftlichen Positionen, bei dem Mannheim keineswegs der Unterlegene war. Seine Vorlesungen und Seminare zogen ein großes und – wie in Heidelberg – politisch breitgefächertes Studentenpublikum an. Das galt erst recht, als seit dem Wintersemester 1931/32 die Veranstaltungen einer Arbeitsgemeinschaft für Sozialgeschichte und Ideengeschichte begannen, die zunächst dem Frühliberalismus in Deutschland galten. Mannheim arbeitete dabei zusammen mit dem Wirtschaftswissenschaftler Adolf Löwe, dem Politologen Ludwig Bergsträsser (1863–1960) und dem Historiker Ulrich Noack (1889–1974). Mannheims besondere Attraktivität beruhte auf seiner eleganten Erscheinung und seinem Ruf als brillanter Intellektueller. Doch er selbst sah sich immer mehr als akademischer Fachsoziologe. Im Februar 1932 wurde er Wortführer einer neuen Soziologengeneration, der es um die Professionalisierung und Institutionalisierung der Soziologie ging. Politisch hatte Mannheim sich nie exponiert. Orthodoxen und politisch aktiven Marxisten galt er wegen der Totalisierung des Ideologiebegriffs und seiner Verwendung auch für den Marxismus gleichermaßen als eine Art Verräter. Noch im April 1933 schrieb er einem jungen Kommunisten, der sich für ein Soziologie-Studium in Frankfurt interessierte, hier verstehe man sich nicht als politische Partei und nehme man sich die Zeit, das Für und Wider jeder Sache ruhig zu diskutieren. Er ahnte nicht, dass er zusammen mit Max Horkheimer und weiteren prominenten Frankfurter Professoren bereits auf der NS-Liste für einen „ersten Beurlaubungsschub“ im Gefolge des am 7. April verabschiedeten „Gesetzes zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums“ stand, das vor allem die Dienstentlassung jüdischer, kommunistischer und sozialdemokratischer Beamter regeln sollte. Mannheim musste ein zweites Mal emigrieren. Zusammen mit seiner Frau fand er nach Zwischenstationen in Amsterdam und Paris Zuflucht in London. Dort setzten sich der Soziologe Morris Ginsberg (1889–1970) und der Politologe Harold Laski (1893–1950) von der London School of Economics and Political Science für ihn ein, die seine wissenschaftssoziologischen Arbeiten schätzten. Mannheim erhielt eine aus Mitteln für exilierte Forscher finanzierte Stelle als „Lecturer“ für Soziologie. Doch dem Emigranten erschien angesichts des Vormarsches und der Erfolge autoritärer und totalitärer Regime Zeitdiagnose wichtiger als Wissenssoziologie, was ihn von den Kollegen, denen es um die akademische Etablierung der Soziologie als Fach ging, entfremdete. Anerkennung fand er dagegen als Lehrender bei Studenten, als engagiertes Mitglied des Moot-Kreises – eines Diskussionszirkels von Intellektuellen mit dem Ziel der Förderung einer christlich orientierten Gesellschaft – und als Vortragender und Autor von Büchern, die sich an ein breiteres Publikum richteten. Darin ging es um das Problem, wie demokratische Gesellschaften nach dem Scheitern des „Laissez-faire-Prinzips“ in der Konkurrenz mit totalitären Systemen bestehen könnten. 1935 erschien in den Niederlanden als letzte deutschsprachige Publikation von Mannheim der weitgehend aus Vorlesungen hervorgegangene Band „Mensch und Gesellschaft im Zeitalter des Umbaus“ und 1940 eine erweiterte englische Ausgabe unter dem Titel „Man and Society in an Age of Reconstruction“. Als letzte Buchpublikation zu Lebzeiten folgte 1943 die Essaysammlung „Diagnosis of our Time: Wartime Essays of a Sociologist“. Postum erschien der Fragment gebliebene Band „Freedom, Power and Democratic Planning“. Im Zentrum all dieser zeitdiagnostischen Studien standen die vergleichende Analyse der faschistischen, der kommunistischen und der demokratischen Reaktionen auf die Probleme moderner Massengesellschaften und das Bemühen um den Entwurf eines „dritten Weges“ jenseits von liberalistischem „Laissez-faire“ und autoritärer Planung. In den totalitären Lösungen sah Mannheim „erschrockene und unausgereifte Versuche“ (Mensch u. Gesellschaft, 1958, S. 9), mit den Schwierigkeiten einer „Übergangsphase“ fertig zu werden. Der Faschismus glaube nicht an die Möglichkeit einer Vervollkommnung des Menschen und Verbesserung der sozialen Organisation und verabsolutiere deshalb das Führerprinzip. Der Kommunismus wiederum überschätze die Verbesserungsfähigkeit des Menschen und unterschätze die Schwierigkeiten der Übergangsphase. Daraus ergab sich für Mannheim als demokratischer „dritter Weg“ ein soziales System, das durch eine freiheitliche, nämlich demokratische Kontrolle unterworfene Planung charakterisiert war. Bei diesem Entwurf einer „geplanten Demokratie“ kamen auch die sozial freischwebenden Intellektuellen wieder zu Ehren. Die Art, wie das geschah, war symptomatisch für Mannheims Vision einer radikalen Reform von oben. Die unabhängige Intelligenz, so hieß es im postum erschienenen Werk, sei eine soziale Gruppe, die in einer geplanten Kultur als Damm gegen Eintönigkeit und Nivellierungstendenzen unbedingt erhalten werden müsse. In der Vergangenheit hätte sie mit ihrem dynamischen Bewusstsein die Grenzen des jeweils Existierenden gesprengt. Das sei eine durch kaum etwas anderes zu ersetzende Funktion. Deshalb sollte die demokratische Gesellschaft der Zukunft „bewusst Karrieren einplanen, die außerhalb der regulären sozialen und Erziehungskarrieren verlaufen“ (Freiheit u. geplante Demokratie, 1970, S. 206). Nach diesem Muster sollten auch Philosophie und Religion eine wichtige Funktion in dem von Mannheim entworfenen Gesellschaftssystem haben, nämlich die Funktion von Integrationsmechanismen. Damit wurden sie zu sozialtechnischen Instrumenten in den Händen einer Elite degradiert. Elitenauslese, Wissenschaftsoptimismus und funktionalistisches Denken wurden zu zentralen Elementen von Mannheims Theorie und Engagement. Noch nicht ganz 54 Jahre alt starb Mannheim, der seit Geburt an einem Herzklappenfehler gelitten hatte, 1947 in London. In der ersten Nachkriegszeit spielten seine Zeitdiagnosen und Zukunftsentwürfe eine wichtige Rolle in politischen Debatten in den USA und in einigen europäischen Ländern. Doch langfristig wurde er durch die bedeutenden Beiträge zur Wissenssoziologie, die in seiner Heidelberger und Frankfurter Zeit entstanden, zu einem Klassiker der Soziologie. Mannheims Beiträge zur Wissenssoziologie wurden und werden dabei auf unterschiedliche Weise rezipiert. Für die einen geht es dabei um eine spezielle Disziplin der Fachsoziologie, für die anderen um eine geistes- und kulturgeschichtlich orientierte Alternative zum Historischen Sozialismus. Im letzteren Sinne gehört zu Mannheims Wirkungsgeschichte vor allem die Untersuchung seines Freundes und Assistenten Norbert Elias „Über den Prozess der Zivilisation“. |
|---|---|
| Quellen: | UA Frankfurt am Mannheim, VAF Abt. 14, Nur. 25, Personalakte Karl Mannheim; UA Heidelberg, Personalakte Karl Mannheim; Library of Keele University, Staffordshire, Karl Mannheim Papers; weitere Hinweise in: H. E. S. Woldring, Karl Mannheim, 1987, 408. |
| Werke: | Auswahl: Besprechung von G. Lukács, Die Theorie des Romans, in: Logos, IX, 1920–21, 298-302; Beiträge zur Theorie d. Weltanschauungs-Interpretation, in: Jb. für Kunstgeschichte, 1921–22, 236-274; Die Strukturanalyse d. Erkenntnistheorie, in: Kant-Studien, Ergänzungsheft Nr. 57, 1922; Historismus, in: Archiv für Sozialwissenschaft u. Sozialpolitik, 1924, 1-60; Das Problem einer Soziologie des Wissens, ebd. 1925, 577-652; Ideologische u. soziologische Interpretation d. geistigen Gebilde, in: Jb. für Soziologie, 1926, 426-440; Das konservative Denken, in: Archiv für Sozialwissenschaft u. Sozialpolitik, 1927, 470-495; Das Problem d. Generationen, in: Kölner Vierteljahreshefte für Soziologie, 1928, 157-185; Die Bedeutung d. Konkurrenz im Gebiete des Geistigen, in: Verhandlungen des sechsten dt. Soziologentages, 1929, 35-83; Ideologie u. Utopie, 1929 (erweiterte englische Ausgabe 1936); Über das Wesen u. die Bedeutung des wirtschaftlichen Erfolgsstrebens, in: Archiv für Sozialwissenschaft u. Sozialpolitik, 1930, 449-512; Wissenssoziologie, in: Handwörterb. d. Soziologie, hgg. von A. Vierkandt, 1931, 659-680; Die Gegenwartsaufgaben d. Soziologie, 1932; Rational and Irrational Elements in Contemporary Society, 1934; Mensch u. Gesellschaft im Zeitalter des Umbaus, 1935; Mass Education and Group Analysis, in: J. H. Cohen u.a., Hgg., Educating for Democracy, 1939; Diagnosis of our Time, 1943 (deutsch 1951); Freedom, Power and Democratic Planning, 1950 (deutsch 1970); Wissenssoziologie, hgg. von K. H. Wolff, 1964; Strukturen des Denkens, hgg. von D. Kettler u.a., 1980; Konservatismus, hgg. von D. Kettler u.a., 1984; Sociology as Political Education, hgg. von D. Kettler u.a., 2001; Collected Works of Karl Mannheim, 11 Bände, 1997ff. |
| Nachweis: | Bildnachweise: Foto (o. J.), in Baden-Württembergische Biographien 6, S. 316, H. E. S. Woldring, 1986, Bucheinband, mit Genehmigung des Verfassers. |
Literatur + Links
| Literatur: | M. Horkheimer, Ein neuer Ideologiebegriff?, in: C. Grünberg, Hg., Archiv für die Geschichte des Sozialismus u. d. Arbeiterbewegung, 1930, 1-34; T. W. Adorno, Über Mannheims Wissenssoziologie, in: Aufklärung, 1953, 224-236; R. K. Merton, Karl Mannheim and the Sociology of Knowledge, in: ders., Social Theory and Social Structure, 1967; D. Kettler, Marxismus u. Kultur, 1967; A. Neusüß, Utopisches Bewusstsein u. freischwebende Intelligenz, 1968; V. Meja u.a., Der Streit um die Wissenssoziologie, 2 Bde., 1982; E. Karádi u.a. (Hgg.), Georg Lukács, Karl Mannheim u. d. Sonntagskreis, 1985; H. E. S. Woldring, Karl Mannheim, 1986; D. Kettler u. a., Politisches Wissen, 1989; U. Matthiesen, Kontrastierungen/Kooperationen, in: H. Steinert (Hg.), Die (mindestens) zwei Sozialwissenschaften in Frankfurt u. ihre Geschichte, 1989; W. Hofmann, Karl Mannheim zur Einführung, 1996; N. Elias über sich selbst, 1990; W. Hofmann, Karl Mannheim zur Einführung, 1996; R. Blomert, Intellektuelle im Aufbruch, 1999; C. Loader, The Intellectual Development of Karl Mannheim; M. Endreß u.a. (Hgg.), Karl Mannheims Analyse d. Moderne, 2000; R. Laube, Karl Mannheim u. die Krise des Historismus, 2004; D. Kettler u.a., Karl Mannheim, in: D. Käsler (Hg.), Klassiker d. Soziologie, Bd. 1, 2006, 299-318; R. Bohnsack, Mannheims Wissenssoziologie als Methode, in: D. Tänzler (Hg.), Neue Perspektiven d. Wissenssoziologie, 2005, 271-291; A. Barboza, Die verpassten Chancen einer Kooperation zwischen d. „Frankfurter Schule“ u. Karl Mannheim Soziologischem Seminar, in: R. Faber u.a. (Hgg.), Das Feld d. Frankfurter Kultur- u. Sozialwissenschaften, 2007, 63-87; A. Barboza, Karl Mannheim, 2009. |
|---|







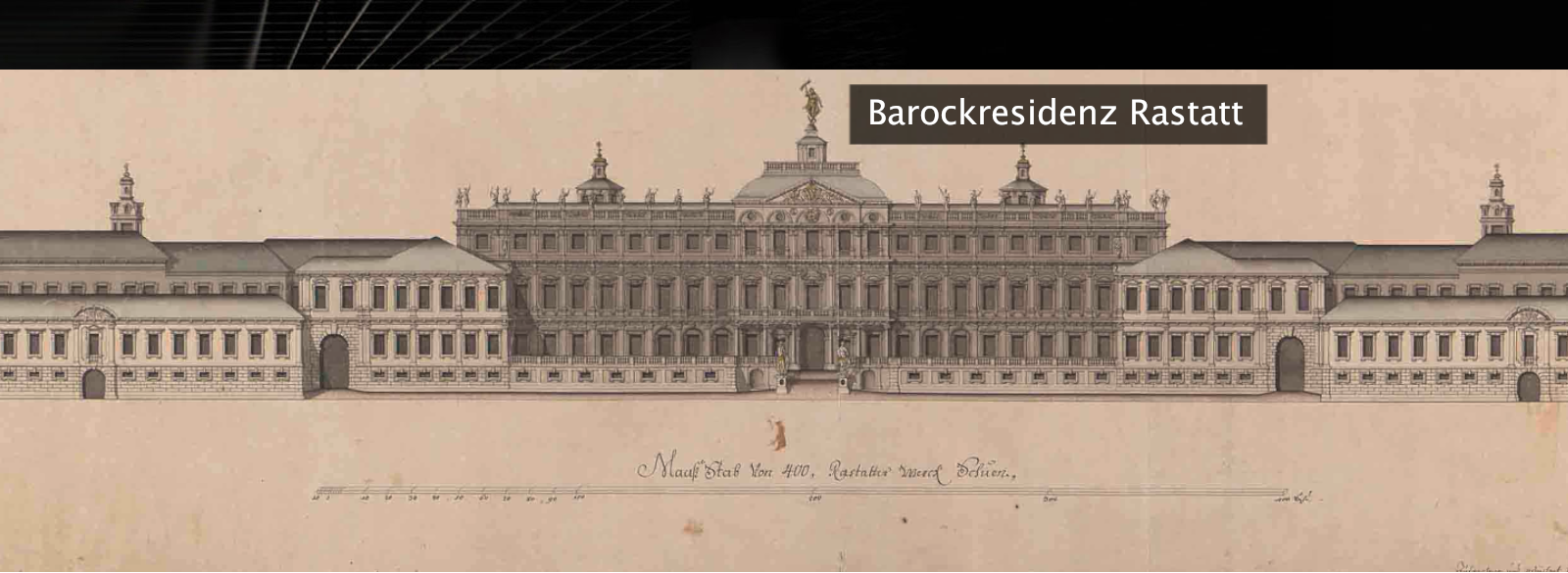



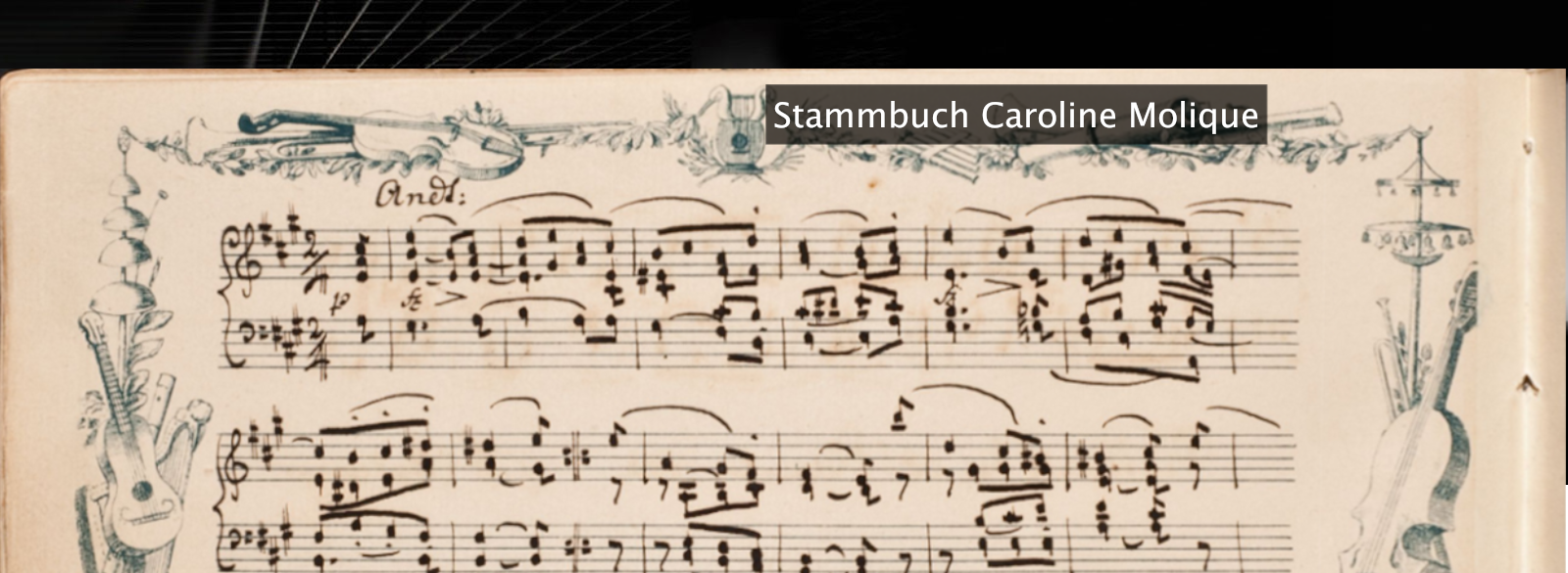





 leobw
leobw