Schnarrenberger, Melitta
| Geburtsdatum/-ort: | 17.01.1909; Pforzheim |
|---|---|
| Sterbedatum/-ort: | 27.07.1996; Lenzkirch |
| Beruf/Funktion: |
|
| Kurzbiografie: | 1927-1930 Studium an der Akademie für Bildende Künste in Karlsruhe, Schülerin bei Georg Scholz und Karl Hubbuch, dann in der Meisterklasse von Albert Haueisen 1930 Kunstpreis der Akademie, Ehe mit Wilhelm Schnarrenberger, 1946 geschieden 1933 Entlassung des Ehemannes durch die Nationalsozialisten und Übersiedlung nach Berlin 1938 Übersiedlung nach Lenzkirch im Schwarzwald 1947-1977 Mitarbeit bei der SPD und der Arbeiterwohlfahrt in Lenzkirch 1959-1977 Mitglied des Lenzkircher Gemeinderats 1977 Bundesverdienstkreuz am Bande 1977-1996 Wiederaufnahme der künstlerischen Tätigkeit. Zahlreiche Einzel- und Gruppenausstellungen, u. a. in Lenzkirch, Schluchsee-Seebrugg, Titisee-Neustadt, Tuttlingen, Konstanz, Freiburg, Karlsruhe, Köln, Berlin 1997 Gedächtnisausstellung in Schluchsee-Seebrugg |
| Weitere Angaben zur Person: | Religion: evangelisch (1946-1968 römisch-katholisch) Verheiratet: 1930 Karlsruhe, Wilhelm Schnarrenberger (1946 gesch.) Eltern: Karl Auwärter, Goldschmied und Schmuckfabrikant (1866-1931) Gertrude Auwärter, geb. Horst Kinder: Vera, verh. Hösl (geb. 1931) |
| GND-ID: | GND/123372526 |
Biografie
| Biografie: | Fred Ludwig Sepaintner (Autor) Aus: Baden-Württembergische Biographien 3 (2002), 367-369 Eine zierlich kleine Dame schreitet die Treppen herunter, sie ist schlicht gekleidet, die Linien des dunklen, langen Kleides sind herabfallend, würdevoll. Graumeliert und glatt ist das nicht ganz schulterlage Haar, das ovale, beim Lächeln fast wieder jugendlich wirkende Gesicht prägen die klaren Augen. Nur der Schal hebt sich elegant hervor, den sie, der Wirkung bewußt und die Bewegung unterstreichend, über die rechte Schulter wirft. Selbstbewußtsein kennzeichnet die Erscheinung, Energie. Und ihre Stimme ist klar, die Rede ohne Schnörkel, zielstrebig und voller Kraft, durchtränkt aber auch von Humor und Wärme. So erlebte der Teilnehmer Schnarrenberger, wenn sie ihre Kunst präsentierte: ganz die – wie sie selbst betonte – akademisch ausgebildete Malerin. Hinter der Künstlerpersönlichkeit trat alles andere zurück. Dabei konnte sie diese Berufung, betrachtet man ihr Leben, nur in ihren beiden letzten Jahrzehnten so recht ausleben. Zuvor hatten Ehe und Familie über ihren Alltag entschieden, die ersten Nachkriegsjahrzehnte nach der Scheidung das politisch-soziale Engagement. Im ersten Lebensabschnitt freilich, in den Lehrjahren, war es anders gewesen. Die in Pforzheim Geborene hatte dort ihre frühe Kindheit verbracht; zusammen mit ihrem um elf Monate jüngeren Bruder wuchs sie in großbürgerlichen Verhältnissen auf, bis der Vater 1915 die Schmuckfabrik verkaufte und die Familie nach Karlsruhe umzog. Dort erhielt sie ihre Schulausbildung, bewarb sich 1927, noch bevor sie das Abitur hatte, an der Kunstakademie. Das Landschaftsbild „Heuschober mit Strauch“ und ein „Porträt des Vaters“, beide im Nachlaß der Künstlerin, verhalfen ihrer Bewerbung zum Erfolg. Ihr Talent wurde rasch erkannt und nach dem ersten Semester erhielt sie ein Stipendium für den Rest des Studiums. Die wirtschaftlichen Verhältnisse der Familie waren inzwischen entsprechend. Nach anderthalb Jahren Zeichenunterricht bei Georg Scholz und danach bei Karl Hubbuch, 1930, inzwischen einundzwanzigjährig, wurde ihr für ein Selbstportrait (Bleistift und Kohle) der Akademiepreis verliehen, danach besuchte sie die Meisterklasse von Albert Haueisen und erhielt ein eigenes Atelier. Noch im gleichen Jahr heiratete sie. Nach diesem vielverheißenden Anfang, dem Preis, kam fast unvermutet die Wende. Dabei hatte die Eheschließung mit Wilhelm Schnarrenberger, dem Professor für Gebrauchsgraphik an der gleichen Akademie und arrivierten Maler, eigentlich doch die Fortsetzung der Künstlerlaufbahn erwarten lassen. „Ich hatte ein wunderbares Leben neben ihm ... In der Kunst verstanden wir beide uns prächtig“ urteilte sie noch 1993 (Der Wartturm). Die Ehe ließ die junge Künstlerin aber nie recht aus dem Schatten des Meisters treten. Das war sicher vor allem zeitbedingt, der Frau mochte zuerst künstlerische Abstinenz abverlangt werden, Unterordnung. Ein Übriges mag die Geburt der Tochter beigetragen haben. Dennoch belegen Gemeinschaftsarbeiten beider den intensiven künstlerischen Dialog. Der andere, tiefere Einschnitt im Leben der damals 24jährigen folgte dem Beginn der NS-Herrschaft, der beide Eheleute politisch feindlich gegenüberstanden. Noch kurz nach der Machtergreifung hatte Schnarrenberger im Munzischen Konservatorium zum passiven Widerstand gegen die Hitlerregierung aufgerufen; doch während diese ablehnende Haltung für sie selbst ohne direkte Folgen blieb, wurde Wilhelm Schnarrenberger nach kurzer Frist zusammen mit elf weiteren Kollegen als politisch unliebsam entlassen. Die Familie verließ Karlsruhe und zog gegen Ende des Jahres 1933 – die „Abfindung“ hatte darin bestanden, daß die Machthaber das Gehalt des „Beamten“ noch 6 Monate weiterbezahlt hatten – nach Berlin. Als dann das erwartete baldige Ende der Hitlerherrschaft ausgeblieben war, nur noch kleinere Aufträge eingingen, die politische Lage aber immer weniger Hoffnung auf mehr künstlerische Freiheit zuließ, entschloß sich die Familie zum Rückzug. Anfang 1938 kam Schnarrenberger mit ihrer Familie nach Lenzkirch in den Schwarzwald. Ihr Mann hatte die Ferienpension „Waldesfrieden“ erworben, die sie bewirtschaftete, bis das NS-Regime auch den Pensionsbetrieb 1943 als nicht kriegswichtig schloß. Mehrfach zuvor schon hatten beide Künstler unter der NS-Herrschaft zu leiden gehabt: die bei der Ausstellung „Frau mit Schmuck“ 1935 in Berlin gezeigten Bilder (Melitta: Weiblicher Akt im Profil mit Perlenkette) waren von den Nationalsozialisten abgehängt worden; 1937 endlich war die für lange Zeit letzte Ausstellung ihres Mannes als „entartet“ geschlossen worden. Kunst durfte all die späteren Jahre über nur noch privat geschehen. Nicht selten beherrschte existentielle Not diese Zeit. Schnarrenbergers eigentliche künstlerische Arbeit blieb untergeordnet. Nur wenige Zeichnungen, Aquarelle und ein paar Pastelle sind aus diesen Tagen erhalten. Sie verzichtete zu Gunsten ihres Mannes auf die eigentlich ihr zugeteilten Malutensilien, denn nur sie war in der Reichskulturkammer registriert. Viel mehr galt ihre Sorge allein dem Schaffen des Ehemannes, den „bei Stimmung zu halten“ ihr vordringlich war, konnte er doch ganze Gesellschaften in seine inneren Abgründe hineinreißen, wie sie sich erinnerte. „Ich fand das alles selbstverständlich, auch daß in erster Linie mein Mann malte. ... Ich bin im Dritten Reich nicht verfolgt worden, habe keinen Besitz verloren, aber meine ... Arbeit auf künstlerischem Gebiet wurde amputiert, zerstückelt, fast vernichtet.“, (Künstlerschicksale ...) so urteilte die Künstlerin in der Rückschau. „Nach Kriegsende war ich 36, ein Alter, in dem es durchaus noch möglich gewesen wäre, in den Kunstbetrieb hineinzukommen. Aber nicht im Schwarzwald, nicht als Frau und nicht ohne Geld.“ Dies mag erklären, warum auch nach ihrer Scheidung 1946 nicht gleich die Schaffensperiode einsetzte und auch, wie sie empfand, weil ihr die entscheidenden Jahre der Jugend fehlten. Wieder betrieb Schnarrenberger für Jahre ihre Fremdenpension, jetzt ganz auf sich selbst gestellt. Es bedurfte erst einer weiteren Phase der inneren Emanzipation, wozu besonders das politische Engagement verhalf, vor allem aber die soziale Hingabe, mit der sie während dieser Zeit ihren Einsatz als Ortsvorsitzende der Arbeiterwohlfahrt und die Leitung der Lenzkircher Sozialstation betrieb. Schnarrenberger wurde die erste Frau in einem Gemeindeparlament des Hochschwarzwaldes. Diese Phase ihres Lebens endete 1977. Das Bundesverdienstkreuz war die öffentliche Anerkennung dafür. Die Eigenständigkeit, die sie unterdessen errungen hatte, leitete den Durchbruch zur letzten Periode ihres Lebens ein: zur eigentlich künstlerischen, die bis ins Jahr 1996, bis unmittelbar vor ihren Tod, währte. Mehr als 150 Bilder sind in diesen Jahren entstanden, zumeist in Öl gemalt, auch einige Aquarelle. Die Zeichnungen und Skizzen bleiben ungerechnet. Vom Sujet her gesehen fällt eine Dreiteilung ins Auge: den zahlenmäßig kleinsten Anteil machen Landschaften aus, die durchweg Eindrücke der Künstlerin wiedergeben, einen Abschnitt des Bodenseeufers etwa, eine Griechenlandimpression, und, wie nicht anders zu erwarten, zeigen viele dieser Bilder ihre Wahlheimat, den Schwarzwald, Berge und Seen. Gleich mehrfach ist es der Schluchsee, die Impression des 1982 abgelassenen Stausees – nur wenige Gemälde geben diesen Eindruck bizarr verstümmelt anmutender Landschaft so eindringlich wider – und dann eine Ölkreidezeichnung: der Blick vom Seehotel Hubertus in Seebrugg auf die kaum 50 m entfernte Bucht. Weit häufiger entstanden Porträts: Freunde, Mitglieder der Familie und immer wieder – ein Leitmotiv gleichsam – Selbstportraits, meist in auffällig düsteren Farben, von tiefem Pessimismus geprägt. Erreicht sie hier schon ein Niveau der künstlerischen Selbständigkeit und des Ausdrucks, wie es angesichts der Vita gerade bei diesem Gegenstand zu erwarten war – erhielt sie doch für ein Selbstportrait ihren frühen Akademiepreis – so mag es den Kenner der Künstlerpersönlichkeit nicht verwundern, wenn sie sich häufiger noch einem anderen Genre widmete: dem Stilleben und Interieurbild. Fraglos, zahlenmäßig, und nicht nur quantitativ liegt hier der Schwerpunkt künstlerischen Schaffens. Es ist die erlebte, künstlerische Transformation der eigenen Lebenswelt: hier die geschwungene Lehne des Sessels, dort sind es Kissen, Tassen, Karaffen, Gläser, alles durch das Künstlerauge gesehen und auf der Leinwand festgehalten. Auffällig und durchaus typisch mag auch ihre Kombination der Sujets Stilleben und Landschaft sein, wie auf den Bildern „Blick durch das Fenster“ (1988) und „Seeufer-Bild und Sessel“ (1985) geschehen. Beide sind im Nachlaß erhalten. Schnarrenberger schrieb einmal unter die für sie typische Skizze eines Selbstportraits „So sehe ich!“. Hier kommt das persönliche Anliegen, die Botschaft der Künstlerin, unmittelbar und deutlich zum Ausdruck. Gewiß die Schule wird sichtbar, und nicht nur die Wahl der Gegenstände steht unverkennbar in der Tradition ihrer Ausbildung, auch stilistische Anklänge, Parallelitäten zu den 1920er Jahren fallen oftmals ins Auge. Sie blieb die Schülerin von Hubbuch, und Wilhelm Schnarrenberger hinterließ genauso seine Spuren. Dennoch, prägend wirkt letztlich bei allen Werken die Individualität, die persönliche geistige Durchdringung, deren Produkt sich dem Betrachter bietet, stärker vielleicht noch der vom Künstler empfundene Augenblicksimpuls, der zum Gemälde gerann. Dabei spiegelt die Malerei selbst keineswegs den Vorgang geistiger Durchdringung wider; das Malen ist eher bereits sein Produkt, geschah rasch; der immer kräftige, willensbetonte Strich, viel wuchtiger als bei Wilhelm Schnarrenberger, ist untrügliches Zeichen ihrer Impulsivität. Was kennzeichnet dieses Werk? Nicht die Entwicklung, dazu fehlt die Zeit! Das Werk setzte erst ein, als die Summe der persönlichen Lebenserfahrung bereits vorlag. In ihrer Malerei faßte Schnarrenberger ihre subjektive Sicht der Dinge zusammen, sie ist ihre persönliche Botschaft an die Nachwelt, die – dergestalt seltene – Botschaft einer engagierten Frau, die am Ende des Jahrhunderts eine künstlerische Brücke schlägt zu dessen Anfangszeit. |
|---|---|
| Quellen: | Nachlaß im Familienbesitz |
| Werke: | Gemälde in öffentlichem, Familien- und Privatbesitz |
| Nachweis: | Bildnachweise: Fotos in Presseartikeln (siehe oben) |
Literatur + Links
| Literatur: | Künstlerschicksale im Dritten Reich in Württemberg und Baden. Hg. vom Verband Bildender Künstler Württemberg e. V. Stuttgart (1987), 30 f.; Der Wartturm, Heimatblätter des Vereins Bezirksmuseum Buchen Nr. 4, 1993, 6 f.; Zahlreiche Presseberichte über politisches und malerisches Wirken, z. B. in: Schwarzwälder Bote (14.01.1977, 11.11.1987, 17.01.1989, 30.07.1996) und BZ (15.01.1977, 20.03.1987, 30.07.1996) |
|---|







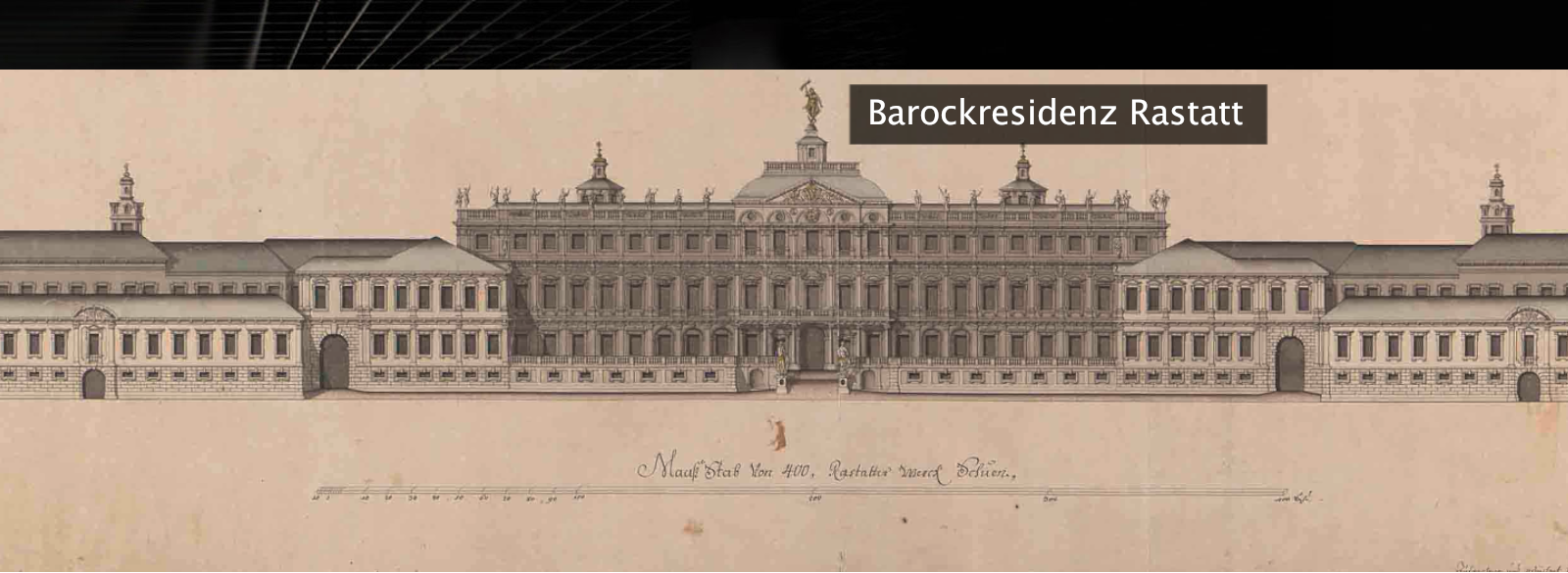



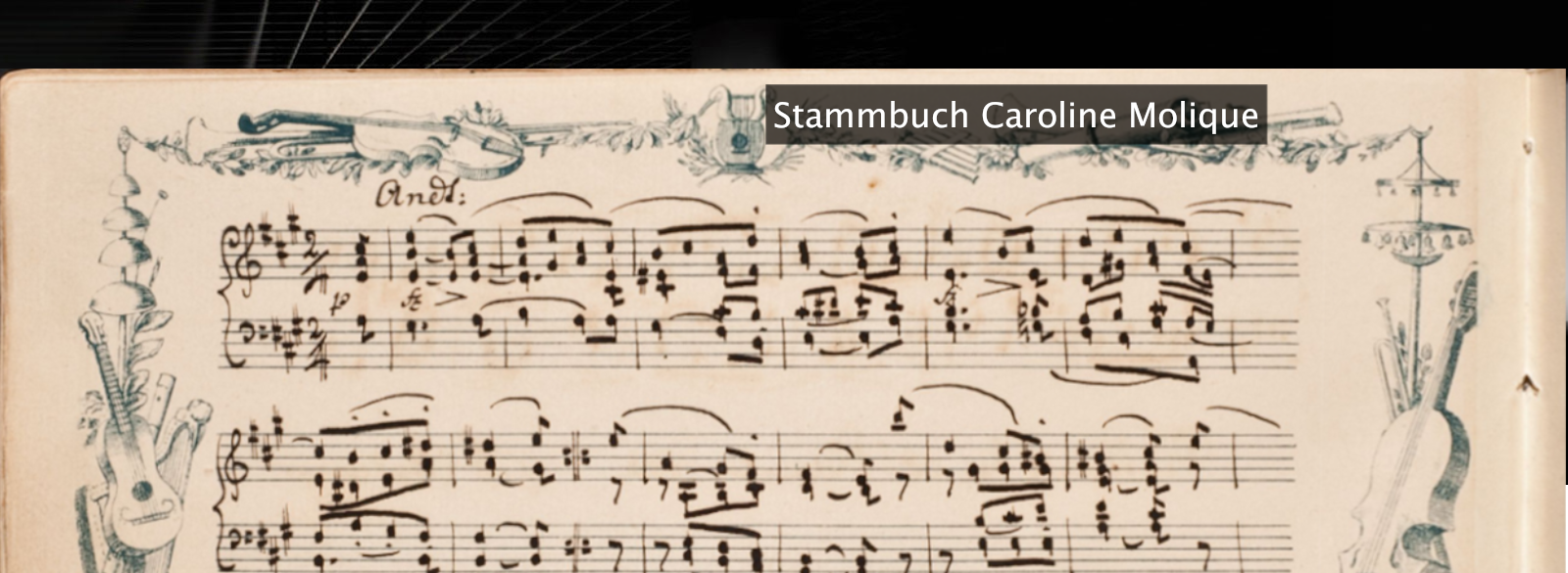





 leobw
leobw