Marx, Leopold
| Geburtsdatum/-ort: | 08.12.1889; Cannstatt |
|---|---|
| Sterbedatum/-ort: | 23.01.1983; Naharia, Israel |
| Beruf/Funktion: |
|
| Kurzbiografie: | bis 1904 Humanistisches Gymnasium Cannstatt 1909 Übernahme d. Verantwortung für die väterliche Gurten- u. Bandweberei in Cannstatt 1916 Kriegsdienst u. Gefangennahme an d. Somme 1918 Heimkehr aus französischer Kriegsgefangenschaft 1926 Mitbegründer des Stuttgarter jüd. Lehrhauses 1938 KZ Dachau 1939 Polizeihaft, Auswanderung nach Palästina, Aufnahme in die Siedlung Shavej Zion 1942 erste Buchveröffentlichung |
| Weitere Angaben zur Person: | Religion: isr. Auszeichnungen: Ehrungen: Ehrenurkunde d. Stadt Stuttgart (1969), Ehrenspende des Verbands dt. Schriftsteller (1974); postume Ehrung durch die Organisation von Juden aus Württemberg im Leo Baeck Institut (1983) Verheiratet: 1916 Ida (in Israel: Judith), geb. Hartog (geboren 1890 in Mannheim) Eltern: Vater: Eduard (1854–1904), Kaufmann u. Fabrikant Mutter: Babette, geb. Rothschild (1865–1942) Geschwister: 3; Julius (geboren 1893), Alfred (geboren 1899) u. Margarete (geboren 1901) Kinder: 2; Erich Josua (in Israel: Jehoshua, geboren 1921, gef. 1948), Karl Eduard (in Israel: Efraim, geboren 1923) |
| GND-ID: | GND/125003366 |
Biografie
| Biografie: | Rainer Redies (Autor) Aus: Baden-Württembergische Biographien 6 (2016), 326-330 Marx’ Vorfahren stammten aus verschiedenen Judendörfern in Württemberg und Baden. Im Zuge der Judenemanzipation waren sie als Unternehmer ins Bürgertum aufgestiegen. Einer von ihnen, Bernhard Jakob Gutmann (1845–1913) verlegte 1878 seine drei Jahre zuvor in Göppingen gegründete Gurten- und Bandweberei nach Cannstatt und verband sich vier Jahre später mit seinem Schwager Eduard Marx „Mechanische Gurten- und Bandweberei B. Gutmann&Marx“ nannten die beiden ihr Unternehmen mit Sitz am Wilhelmsplatz, wo Eduard Marx und seine Familie auch wohnten. Hier wuchs Marx mit seinen Geschwistern heran. Er besuchte das Cannstatter Gymnasium, als 1904 sein Vater starb. Die Firma sollte in ungeteilter Erbengemeinschaft fortgeführt werden, doch war kein Nachfolger in Sicht. Hatte Marx bis dahin ernsthaft eine geisteswissenschaftlich- literarische Laufbahn angestrebt, musste er sich jetzt in die Familiendisziplin fügen und den Kaufmannsberuf erlernen. Der 15-jährige stürzte in die erste lange Krise eines an Schicksalsschlägen reichen Lebens. Pflichtbewusst, aber innerlich widerstrebend durchlief er Lehre, Fachschule und Auslandsaufenthalte und übernahm mit 19 Jahren die Leitung des väterlichen Unternehmens mit mehr als 100 Beschäftigten. Wie die Mehrzahl der deutschen Juden wollte auch Marx sich 1914 an die Front melden, doch als Leiter eines kriegswichtigen Unternehmens wurde er zurückgestellt. „Glücklich ein jeder, der mit scharfer Wehre/im Kampfgewühl der Fronten wacht und ficht“, beginnt sein 1914 entstandenes Gedicht von einem „der daheim zu bleiben hatte“. Nachdem er sich an den Kriegsminister gewandt hatte, durfte er anstelle seines Bruders Julius doch an die Front. Sein Dienst währte jedoch nur wenige Wochen. Er geriet 1916 an der Somme in französische Gefangenschaft und durchlief nun mehrere Lager. Dem tristen Gefangenendasein suchte er lesend und schreibend zu entfliehen. Von Hermann Hesse initiierte Büchersendungen an die Gefangenen ermutigten Marx, dem Dichter eigene Verse zu senden. Hesse war angetan und vermittelte, dass die Frankfurter Zeitung unter „K. G. 3515“ ein Gedicht von Marx veröffentlichte. Er selber hatte darum gebeten, seinen Namen nicht zu nennen. Aus dem Gefangenenlager St. Quentin gelang Marx 1918 die Flucht. Er reiste per Bahn in den äußersten Südwesten des Landes und überquerte die Grenze nach Spanien. Sein makelloses Französisch bewahrte ihn davor, entdeckt zu werden. Als seine Frau den Heimkehrer an der Schweizer Grenze in Konstanz im Empfang nahm, blickten die beiden auf drei Wochen gemeinsamen Lebens und dreieinhalb Jahre Trennung zurück. Marx und sein Bruder Julius waren nun herausgefordert, die Gurten- und Bandweberei durch schwierige Nachkriegsjahre zu führen. Schwerer noch nach dem ernüchternden Kriegserlebnis und zermürbenden Lagerjahren schien es Marx, die vertraute Beziehung zu seiner Frau wiederherzustellen. Die Geburt des ersten Sohnes stellte das Einverständnis des Paares wieder her, das sich später oft bewähren sollte. Das Haus am Cannstatter Wilhelmsplatz machten sie zum Ort geistigen Austauschs. Zu den Freunden zählten u.a. Fritz Elsas, Otto Hirsch, der Religionswissenschaftler Martin Buber (1878–1965). Unter dem Einfluss von Buber u.a. erwachte in den 1920er-Jahren ein neuer Geist im jüdischen Kulturleben. Auch Marx hatte Bubers philosophische Schriften gelesen und sich auf sein Judentum besonnen. In persönlichen Begegnungen mit Buber entwickelte sich sogar eine Freundschaft und diese Verbindung wurde fruchtbar, als die Rückbesinnung auf das Jüdische in Stuttgart einsetzte und die jüdische Erwachsenenbildung eine Heimstatt brauchte. Von Buber inspiriert gründeten Marx, Otto Hirsch (1895–1941) und Karl Adler am 10. Februar 1926 den Verein jüdisches Lehrhaus. Verbreitung, Erneuerung und Vertiefung der jüdischen Glaubens- und Kulturwelt, Selbstbesinnung auf das Judentum und Hebräisch standen auf dem Programm. In Abgrenzung zur jüdischen Orthodoxie hatte man bewusst das Frankfurter Freie Jüdische Lehrhaus zum Vorbild erkoren und wollte die jüdische Geisteswelt Juden und Christen gleichermaßen erschließen. Gedichte aus den 1920er-Jahren zeugen von Marx’ Sorge um und Liebe für seine Familie, deren gemeinsames Leben nur noch wenig mehr als ein Jahrzehnt dauern sollte. Schon früh mussten die Kinder einer feindlichen Umwelt standhalten. Sein jüngerer Sohn wurde 1933 gezwungen, das Horst-Wessel-Lied auswendig zu lernen, im Jahr darauf wurde ihm trotz bestandener Aufnahmeprüfung der Besuch des Gymnasiums verweigert. Für den Älteren, der vom Gymnasium gewiesen wurde, hatten die Eltern das 1804 im Geist der Aufklärung gegründete jüdische Philanthropin in Frankfurt ausfindig gemacht, das seine Schüler unter dem Druck der politischen Verhältnisse auf die Auswanderung vorbereitete. Der jüngere fand Schutz in der Stuttgarter jüdischen Schule, später im jüdischen Landschulheim Herrlingen. Unter der Parole „Deutscher kaufe nicht beim Juden“ wurde 1935 ein Verzeichnis jüdischer Firmen und Freiberufler verbreitet, das neben der Gurten- und Bandweberei auch Marx’ Onkel, Rechtsanwalt Martin Rothschild, diffamierte. Noch schärfer traf die Familie, dass im selben Jahr Marx’ Bruder Alfred, ein Amtsrichter, aufgrund der Nürnberger Gesetze aus dem Justizdienst entlassen wurde. Er arbeitete dann für die Gurten- und Bandweberei. 1936 reiste Marx mit seiner Frau nach Palästina, um die Möglichkeiten dort zu erkunden. Bald nach der Rückkehr bemerkte er beim Ausflug seines Betriebs nach Blaubeuren, dass sich das Schwimmbad dort als „judenfrei“ deklarierte. Es war also Zeit, Deutschland zu verlassen, aber neben der Verantwortung für das Unternehmen sah Marx sich auch in der Pflicht für seine betagte Mutter und ihre beiden Brüder. Vorerst musste die florierende Gurten- und Bandweberei deshalb auf der Höhe gehalten werden. 1939 gelang wenigstens die Auswanderung der beiden Söhne nach Palästina. Für die zusammenrückende israelitische Gemeinde war Marx inzwischen als Autor tätig. Seine den bedrohlichen Umständen abgetrotzten Stücke, durchweg Gelegenheitsarbeiten, blieben unveröffentlicht. In Erinnerung haftete „Purim in Schwabylon“, das zu Purim im März 1935 geschrieben und von der Stuttgarter Jüdischen Kunstgemeinschaft inszeniert wurde. Marx hat das im biblischen Buch Esther vorgegebene Thema anspielungsreich, witzig, vor allem aber so behandelt, dass die Zuschauer in den historischen Figuren die braune Politprominenz mit ihrer Mordlust, Raffgier und Bestechlichkeit verspottet sahen. Mit den Worten „Grüßt ihr mich nicht beim Wiedersehn, so lass ich euch den Hals umdrehn“ lässt er den grausamen, selbstverliebten Haman die Szene betreten. Auch wenn die Anspielungen deutlich waren, die der Aufführung beiwohnende Gestapo ahndete zumindest den Spott nicht. Zur Einweihung der jüdischen Schule im April 1935 entstand „Schuleinweihung in Susa“, worin Marx humorvoll und einfühlsam auf die Situation der jüdischen Kinder eingeht. Die Cannstatter Synagoge, in Rufweite des Marx’schen Anwesens gelegen, wurde am 9. November 1938 von Feuerwehrleuten niedergebrannt, Marx’ Bruder Alfred verhaftet und ins KZ Dachau gebracht. Er selber entging dem Zugriff zunächst in Neuffen, wo die Firma einen Zweigbetrieb unterhielt. Als er dann nach Cannstatt zurückkehrte, war das immer noch zu früh: „Sie kamen denn auch, schon durch ihr stürmisches Läuten ihr Vorhaben ankündigend, verfügten außer meiner Verhaftung auch die Beschlagnahme des Autos und befahlen mir, mit diesem und ihnen ins Gefängnis zu fahren.“ Dachau hieß die nächste Etappe. Nach zwei Wochen endete die KZ-Haft, Marx musste sich nun werktäglich bei der Polizei melden. Als sich der leidenschaftliche Wanderer im Frühjahr 1939 mit einer Schurwaldwanderung „unter Blüten und dem unbeschreiblich zarten Grün des deutschen Frühlingswaldes“ noch einmal dem Druck der Verfolgung entzog, vergaß er die Tagesmeldung bei der Polizei. Acht Tage Gefängnis wegen sträflicher Nichtachtung der Obrigkeit folgten. Alles Weitere kann die Familie nur in der Fluchtabsicht bestärkt haben: Mehr als 100 000 M Judenvermögensabgabe wurden der Erbengemeinschaft auferlegt. Weit unter Wert musste die Firma verkauft, der Veräußerungsgewinn freilich versteuert werden. Die Stadt Stuttgart eignete sich das Anwesen Seelbergstraße 1 an. Reichsfluchtsteuer und Enteignung des restlichen Vermögens nach der Ausreise bildeten Schlusspunkte. Das Vermögen war beschlagnahmt, die Fabrik und alle Liegenschaften „arisiert“, nun stand die Ausreise von Ida und Marx endlich bevor. Da brach der II. Weltkrieg aus. Das gebuchte Schiff fuhr nicht mehr. Eine Freundin half mit italienischen Flugtickets. Mit genehmigten 10 RM in der Tasche gelangte das Paar nach Brindisi – und wurde „plötzlich reich. Da warteten in einem Wertbrief 500 Schweizer Franken […]. Diese verdankten wir der Hilfsbereitschaft Hermann Hesses, der sie uns […]geschickt hatte.“ Am 6. Oktober landeten die Flüchtlinge in Haifa und kamen zunächst bei Freunden unter, ehe sie in Shavej Zion Aufnahme fanden. Zugleich trieb der menschenverachtende NS-Terror seinem Höhepunkt zu. Zwar entkamen seine Tochter Grete mit ihrem Mann Karl Adler, ebenso Julius Marx und seine Frau Liddy, aber für Marx’ Mutter und ihre Brüder schnappte die Falle zu. Die zionistische Idee eines jüdischen Staates war 1939 wenig mehr als ein Wunschtraum. Wer in Palästina Fuß fassen wollte, musste ein entbehrungsreiches, gefährliches Leben akzeptieren. Die Nachricht von der Ankunft der Eltern war nicht bis zu den Söhnen gedrungen. Niemand erwartete Marx und seine Frau, als sie in Haifa eintrafen. Freunde, die in Naharia nahe der Grenze zum Libanon lebten, gewährten erstes Obdach. Als Bleibe diente, damals nicht ungewöhnlich, ein „Lift“, ein großer, ursprünglich zum Transport von Hausrat und Möbeln bestimmter Container. Als Ziel auf Dauer hatte das Paar sich bald das nahe gelegene Shavej Zion erkoren. Welche Zuneigung Marx zu dem von Rexinger Juden begründeten Ort gefasst hat, verrät das 1939 entstandene, später mehrfach variierte und sogar ins Englische übertragene Gedicht „Shavej Zion“: „Es lag am Meer, wirtschaftete als Kollektiv, und die Mehrzahl seiner Bewohner waren Schwaben“ hat Marx das Wunschziel beschrieben. Im Dezember wurde das Paar von der Generalversammlung mit knapper Mehrheit angenommen und im Frühjahr 1940 konnte es zunächst eine Baracke, kurze Zeit später ein kleines Haus beziehen. Übergangslos wurden aus Städtern Bauern. Seine Frau arbeitete im Gemüsegarten, er selbst in den Pflanzungen. In einem Brief aus dieser Zeit schreibt er: „Wenn die tägliche […] Arbeit schon immer ein Segen war, so ist sie es jetzt doppelt. Sie nimmt alle Kräfte in Anspruch und lässt keine Zeit, Spekulationen und düsteren Gedanken nachzuhängen.“ Anlass für Sorgen gab die verfehlte britische Mandatspolitik reichlich: bewaffnete Konflikte mit den arabischen Nachbarn, die bis zum Terror auf beiden Seiten wuchsen, Sorge um die Angehörigen in Cannstatt und die Drohung, vom Libanon her könnten die Vichy-Franzosen einmarschieren oder gar die Deutschen unter Rommel über El Alamein hinaus nach Palästina vordringen. Noch war Shavej Zion mehr Baustelle als Siedlung. Viele Siedler waren anfangs auf Provisorien angewiesen und Terror und Attentate forderten Blutzoll von Juden wie Arabern. Neue Unruhen flammten auf, nachdem die Vereinten Nationen mit Zweidrittelmehrheit für eine Teilung Palästinas gestimmt hatten. Nicht mehr gegen das Weißbuch, wohl aber gegen dessen fatale Folgen kämpften die Juden jetzt, und Marx’ 27-jähriger Sohn Jehoshua war dabei. Er wurde tödlich getroffen, als er einen strategisch wichtigen Punkt verteidigte. Über den Verlust der schwäbischen Heimat ist Marx hinweggekommen, den Tod des Sohnes betrauerte er lebenslang. Ein innerer Dialog, dem Buch „Mein Sohn Erich Jehoshua“ vorangestellt, verlieh dieser Trauer Ausdruck. Als 1917 das Gedicht „Gestern und heute und morgen“ als Marx’ erste Veröffentlichung in der Frankfurter Zeitung erschien, hatte er Hesse gegenüber noch dichterische Ambitionen bestritten. Was er seinem Kaufmannsberuf „an Zeit und Gedanken abgewinnen“ könne, gehöre „dem Lebensberuf – ein Mensch zu werden.“ Nachdrücklicher noch heißt es an anderer Stelle: „Du sollst mich nicht einen Dichter nennen! Jeder junge Mensch mit ein bisschen Phantasie und Sprachgefühl hat Zeiten, in denen er glaubt, Verse machen zu müssen.“ Der Zuspruch des Dichterfreundes Hesse musste Marx jedoch bewusst gemacht haben, dass es mehr als „Verse machen“ war, was er betrieb. Seine Aufgabe als Unternehmer, später der Verfolgungsdruck und die Arbeit als Siedler hatten Veröffentlichungspläne lange hinausgeschoben. In Palästina vertraute er sich dann einem Verleger an. Bei Dr. Peter Freund in Jerusalem erschien 1942 die Gedichtsammlung „Hachscharah“. Das 19 Blatt starke, maschinenschriftlich vervielfältigte, notdürftig geheftete Skript enthält 59 Gedichte und hat im Wesentlichen wohl Freunde und Verwandte erreicht. In erster Linie einem inneren Kreis war auch „Über Schavej Zion“ zugedacht, eine Geschichte der Siedlung von ihren Anfängen in Rexingen bis 1960. Sie zu schreiben hat Marx als Pflicht übernommen, seinem Werk zugehörig hätte er sie wohl kaum betrachtet. Als 1964 endlich bei Reclam die Übertragung des Hoheliedes aus dem Hebräischen unter dem Titel „Das Lied der Lieder“ erschien, hatte Marx die Siebzig schon überschritten. In seinem Ruhestand konnte er die Vorarbeiten vieler Jahre vollenden, und deutlich wusste er jetzt auch um ihren Wert: „Dass Wort und Ton Elemente hoher Kunst sein können, ist nur wenigen bewusst. Von diesen wenigen ein Bruchteil nur liest Gedichte. Und dennoch werden Gedichte geschrieben.“ Noch zu Marx’ Lebzeiten erschienen „Das Lied der Lieder“ mit Vorwort von Alfred Goes, die Gedichtsammlung „Es führt eine lange Straße“ und das auch biografisch aufschlussreiche Prosawerk „Mein Sohn Erich Jehoshua“. Postum kamen „Gedichte“ (1985) und „Die Lobgesänge“ (1989) heraus, eine Nachdichtung der Psalmen aus dem Hebräischen. Bis heute unveröffentlicht blieben das Drama „König Schaul“ und das Versepos „In Memoriam J. W.“, eine Vorwegnahme der postum erschienenen Erzählung „Franz und Elisabeth“. Das Grundstück am Cannstatter Wilhelmsplatz hat die Familie zurückerhalten, der beim Firmenverkauf erlittene Verlust wurde ausgeglichen, „Wiedergutmachung“ geleistet, aber Marx’ Mutter und sein Onkel Martin Rothschild hatten das KZ-Theresienstadt nicht überlebt; sein Vetter Rothschild war von dort weiter nach Auschwitz in den Gastod deportiert worden. Ungeachtet dieser Verluste und persönlicher Schicksalsschläge hat Marx stets am Gedanken der Versöhnung festgehalten, mit den arabischen Nachbarn und mit Deutschland, wo zeitlebens seine sprachliche Heimat blieb. Von zahlreichen Gästen, die er in Shavej Zion empfing, sei nur Theodor Heuss erwähnt. Zum 80. Geburtstag hat ihn die Stadt Stuttgart mit einer Ehrenurkunde bedacht für seine Verdienste um die Gründung des Jüdischen Lehrhauses und die Förderung gegenseitigen Verständnisses von Juden und Christen. Fast erblindet starb der 93-Jährige in einem Altersheim in Naharia. Sein Sohn Efraim schreibt davon: „Er wusste, dass es zu Ende geht […] Am letzten Abend […]da fing er plötzlich an in Alt- Griechisch die Ilias des Homer sich vorzusagen. Nachdem ich ihn danach fragte, meinte er: Ich sage mir das immer wieder vor, dass die Zeit schneller vergeht!“ Den wesentlichen Teil seines schriftstellerischen Nachlasses hat Marx an das Deutsche Literaturarchiv in Marbach gegeben, vor allem die Typoskripte seiner Hauptwerke. In den 1980er-Jahren wurde Marx in Stuttgart in Matineen, Vorträgen und Lesungen gewürdigt und 1985 in Bad Cannstatt auf Initiative des Vereins Pro Alt Cannstatt ein Leopold-Marx-Denkmal bei Marx’ ehemaligem Wohnhaus errichtet. |
|---|---|
| Quellen: | Gespräche mit dem Sohn Efraim Marx und dem Neffen Walter Marx. |
| Werke: | König Schaul. Ein dramatisches Gedicht, 1938/39, unveröffentlicht; Zur Errichtung des jüdischen Lehrhauses Stuttgart. Rede, gehalten in d. Gründungsversammlung am 10. Februar 1926; Hachscharah, Gedichte, 1942; Das Lied d. Lieder. 1964; Es führt eine lange Straße. Gedichte, 1976; Gedichte aus d. Schaffenszeit von 1910 bis 1982, 1985; Die Lobgesänge. Das Buch d. Psalmen aus dem hebr. Urtext neu übertragen, 1987; Franz u. Elisabeth, Erzählung, 1989; Mein Sohn Jehoshua. Sein Lebensweg aus Briefen u. Tagebüchern, 2. Aufl. 1996. |
| Nachweis: | Bildnachweise: Foto (1959), in: Baden-Württembergische Biographien 6, S. 329, Besitz d. Familie Marx in Evron, Israel. |
Literatur + Links
| Literatur: | Werner Volke, Nachwort, in: Franz u. Elisabeth, 1989; Werner P. Heyd, Marx, Leopold, in: NDB 16, 1990; ders.: Nachwort, in: Mein Sohn Jehoshua, 21996, 323ff.; Carsten Kohlmann, Das Archiv d. Gemeinde Shavej Zion in Israel. Archivgeschichte, Beständestruktur, Ausstellungsplanung, 2005;. Reinhard Doehl, Von Cannstatt nach Shavej Zion. Der Dichter Leopold Marx,; http://www.reinhard-doehl.de/poetscorner/marx.htm. |
|---|







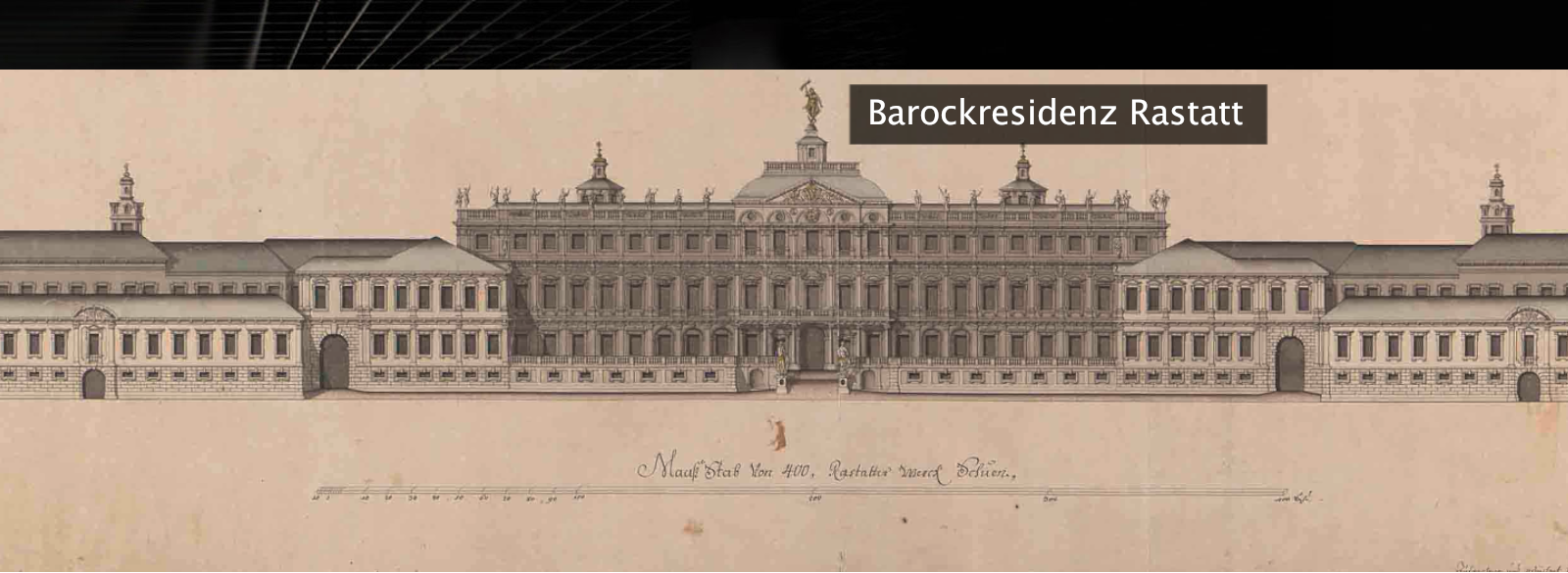



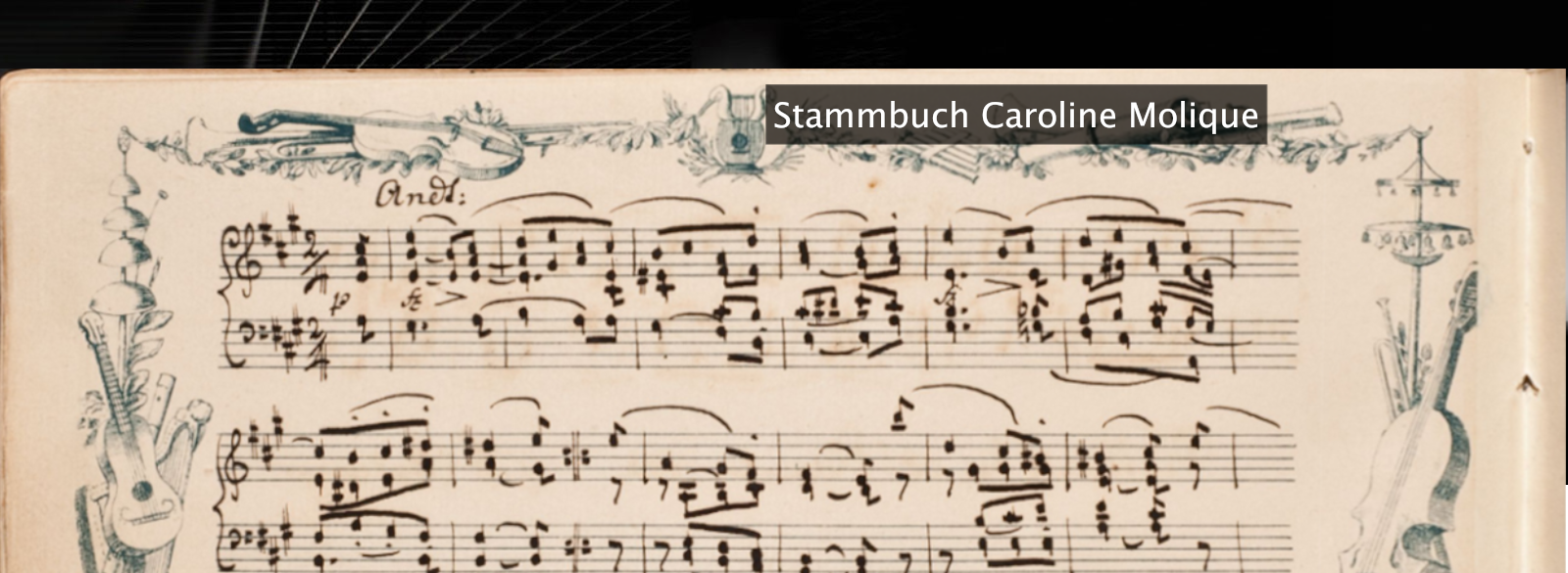





 leobw
leobw