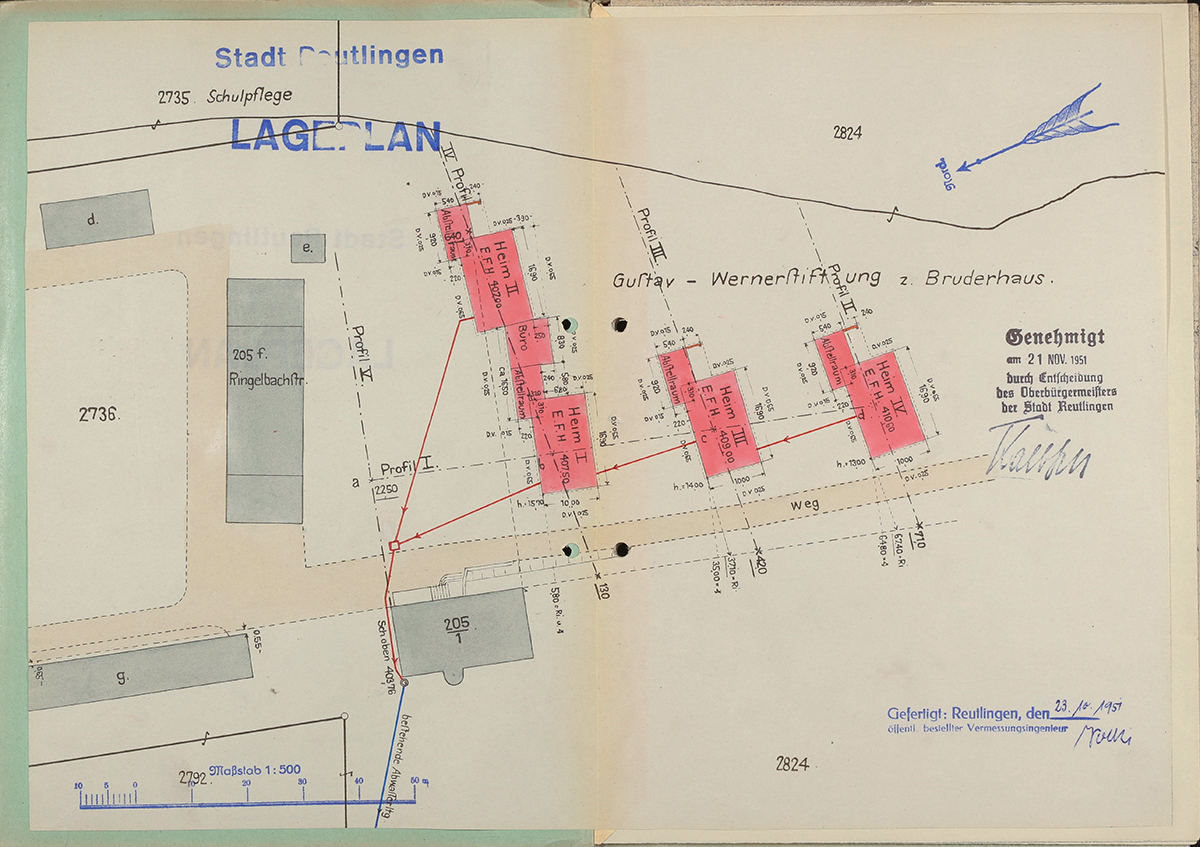Die Arbeit der Anlaufstelle der Stiftung Anerkennung und Hilfe in Bayern
von Annina Börgmann, Melanie Seitz, Daniela Singer

Die Anlaufstelle der Stiftung Anerkennung und Hilfe in Bayern, die beim Zentrum Bayern Familie und Soziales- Bayerisches Landesjugendamt angesiedelt ist, nahm im Jahr 2017 ihre Arbeit mit drei Beraterinnen und Beratern auf.
Von 2012 bis 2018 war in den Räumlichkeiten die Anlauf- und Beratungsstelle für ehemalige Heimkinder angesiedelt, die seit 2019 mit Landesmitteln weiterbetrieben wird. Dort konnten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Arbeit also mit einem anderen Schwerpunkt fortsetzen und ehemalige Heimkinder können sich auch weiterhin an die Stelle wenden (vorerst bis Ende 2022).
Zunächst meldeten sich nur wenige Betroffene, durch breite Öffentlichkeitsarbeit stiegen die Anmeldezahlen im Jahr 2018 jedoch rapide an. So musste auch das Personal in der Anlaufstelle aufgestockt werden und es kamen im Laufe der Jahre 2019 und 2020 sechs neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dazu. Die Anmeldezahlen blieben dann konstant hoch. Die größte Betroffenengruppe sind Gehörlose (ca. 60%). Durch Verbände, Vereine und Beratungsstellen sind sie in Bayern sehr gut vernetzt. Leider wurden im gesamten Anmeldezeitraum nur wenige Betroffene erreicht, die zu den genannten Zeiträumen in ihrer Kindheit und Jugend in psychiatrischen Einrichtungen untergebracht waren.
Eine weitere große Gruppe bilden in Bayern die Menschen, die in Einrichtungen der Behindertenhilfe, oft sogar noch in der gleichen Einrichtung von damals, leben. Die Einrichtungen und deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter spielten bei der Anmeldung dieser Betroffenen eine große Rolle: Aufgrund der Kommunikationsbarrieren vermittelten sie oft zwischen Anlaufstelle und Betroffenen. Es entstand zum Teil ein enger Kontakt und eine sehr kooperative Zusammenarbeit. Diese war allerdings davon abhängig, ob sich die Einrichtung mit ihrer eigenen Vergangenheit auseinandersetzte. Manchmal war und ist das Thema sehr präsent und es gibt Veranstaltungen oder Veröffentlichungen zur Geschichte der Einrichtung.
Erkenntnisse aus den Beratungsgesprächen
Vielen Betroffenen ist die gesellschaftliche Aufarbeitung sehr wichtig. In den Beratungsgesprächen, gibt es manchmal Fragen dazu, was die Stiftung in dieser Hinsicht weiter unternimmt. Viele Betroffene sind bestürzt, wenn sie erfahren, dass es weder Unterlagen gibt, in denen die Grausamkeiten im Heim dokumentiert wurden, noch persönliche Unterlagen über sie selbst. Nur in seltenen Fällen wurden Akten in ein Archiv übernommen, viele Akten wurden bereits vernichtet.
Der Wunsch nach Aufarbeitung und auch nach Bestrafung von Haupttäterinnen und -tätern ist groß. In den Beratungsgesprächen werden oft Namen von besonders grausamen Klosterschwestern und Erzieherinnen oder Erziehern genannt. „Leider ist die schon tot, da können Sie jetzt nichts mehr machen.“
Viele Betroffene sehen ihre ausführliche Aussage im Beratungsgespräch eher als den Auftakt denn als Ende eines längeren Aufarbeitungsprozesses. Der Wunsch, dass die Familie versteht, wie schlimm diese Einrichtungen waren, wird oft geäußert. Außerdem wird der Wunsch geäußert, dass das damalige Leid der Kinder gesamtgesellschaftlich anerkannt wird. Die Sehnsucht nach Inklusion und gesellschaftlichem Verständnis ist vor allem bei gehörlosen Menschen sehr ausgeprägt.
In den Beratungsgesprächen berichteten fast alle Betroffenen massiver psychischer und physischer Gewalt. Die folgenden Beispiele für häufige und flächendeckende Gewalterfahrungen wurden in den Gesprächen genannt:
- Physische und psychische Gewalt von Betreuungspersonal
- Sexualisierte Gewalt
- Essenszwang, teilweise bis zum Erbrechen
- Gewalt durch Mitschülerinnen und Mitschüler
- Kontakt zur Familie wurde unterbunden
- Isolation als Strafe
- Demütigungen
- Anschreien
- Arbeit als Strafe
- Mangelnde gesundheitliche Versorgung
Viele gehörlose Betroffene scheinen es trotz dieser traumatischen Erfahrungen geschafft zu haben, sich stabile Lebensverhältnisse aufzubauen. Sie berichten jedoch von Ängsten und dass sie dazu tendieren, sich bei Konflikten schnell anzupassen und unterzuordnen. Manche geben an, die Vergangenheit für sich bewältigt zu haben. Wieder andere, würden gerne ihre Geschichte mit therapeutischer Hilfe aufarbeiten. Mit diesem Wunsch stoßen sie jedoch oft an Grenzen. Es gibt nur wenige Therapiemöglichkeiten in psychosomatischen Kliniken oder bei Therapeutinnen und Therapeuten, die gebärden. Viele Betroffene fühlen sich deshalb auch weiterhin ungehört und mit ihrer Vergangenheit alleingelassen.
Grundsätzlich erzählen die Betroffenen sehr unterschiedlich. Bei manchen sprudelt es nur so heraus und es besteht ein sehr großes Bedürfnis, das Geschehene endlich zu mitzuteilen. Die Erzählungen sind dann lebhaft und oft auch emotional. Andere Betroffene sind sehr zurückhaltend, erzählen nur bruchstückhaft und hören nach kurzer Zeit wieder auf: „Ich denke es reicht, was ich erzählt habe. Ich möchte jetzt auch gar nicht mehr erzählen.“ Es scheint manchen Klientinnen und Klienten schwer zu fallen, sich an konkrete Erlebnisse erinnern zu können. Das Heim, die Erzieherinnen und Erzieher sind jedoch auch bei denjenigen mit „Erinnerungslücken“ negativ abgespeichert. Sätze wie diese hören die Beraterinnen und Berater immer wieder: „Nein, ich gehe nie auf Klassentreffen, ich würde dort nie hingehen, es war schrecklich. Wenn ich Fotos vom Heim sehe, fühle ich mich wie erstarrt, ich fühle mich dann wieder wie der kleine Junge von damals, noch bis heute wird mir plötzlich schlecht, wenn ich mit dem Auto an dem Heim vorbeifahre.“
Es gibt auch Betroffene, die von vielen guten Erinnerungen an die Zeit im Heim berichten. Nachfragen ergeben aber meist, dass sie die gleichen schrecklichen Erfahrungen gemacht hatten wie andere Kinder in dieser Zeit. Sie bewerten sie nur anders. Für Gewalt und Schläge sehen sie die Schuld bei sich selbst und ihrem – angeblichen – Fehlverhalten. Betroffene, die bis heute noch in einer Einrichtung leben, stehen oft in Abhängigkeit von der Einrichtung und erzählen nur zögernd von ihrer Vergangenheit. Sie trauen sich kaum etwas Negatives zu sagen. Hier können nach dem Gespräch jedoch meist auf andere ausführliche Erfahrungsberichte aus der Einrichtung zurückgegriffen werden.
Die Beraterinnen und Berater können sich mit viel Erfahrung im direkten Kontakt auf die unterschiedlichen Bedürfnisse, die unterschiedlichen Lebensbedingungen und Kommunikationsmöglichkeiten der Betroffenengruppen einstellen.
Und dann kam Corona….
Die ersten Ausgangsbeschränkungen und Home-Office-Vorgaben in Folge der beginnenden Corona-Pandemie trafen die bayerische Anlaufstelle, wie alle anderen, komplett unvorbereitet. Im Frühjahr 2020 wurden auch in Bayern für zwei Monate keine Gespräche geführt. Es wurden dann Möglichkeiten erarbeitet, Beratungsgespräche per Videotelefonie durchzuführen. Dies war zunächst mit vielen technischen und persönlichen Herausforderungen verbunden. Letztendlich ermöglichte die Videotelefonie es den Beraterinnen und Beratern jedoch kontinuierlich Gespräche zumindest für einen Teil der Betroffenen anzubieten. Die Möglichkeit der Videotelefonie erweitert das Angebot der Anlaufstelle inzwischen dauerhaft, ist einem persönlichen Gespräch aber nicht gleichzusetzen.
Unterschiede im Prozess der Stiftung Anerkennung und Hilfe und des Fonds Heimerziehung
Die Anlauf- und Beratungsstelle für ehemalige Heimkinder, angesiedelt beim Zentrum Bayern Familie und Soziales- Bayerisches Landesjugendamt (siehe eigener Text), war bereits für die Anmeldungsbearbeitung im Rahmen des Fonds Heimerziehung in der Bundesrepublik in den Jahren 1949 – 1975 zuständig. Nach Ende des Fonds Heimerziehung wurde die Anlaufstelle mit anderer Schwerpunktsetzung vorerst bis Ende 2022 fortgeführt und berät weiterhin ehemalige Heimkinder. Der Fonds Heimerziehung bot ein ähnliches Modell an wie die Stiftung Anerkennung und Hilfe, richtete sich jedoch an Menschen, die stationär in Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe untergebracht waren. Trotz der Ähnlichkeit der Verfahren zur persönlichen Aufarbeitung zeigten sich nach den Erfahrungen der Bayerischen Anlauf- und Beratungsstellen deutliche Unterschiede im Verfahrensprozess, in den institutionellen Strukturen sowie in den persönlichen und gesellschaftlichen Voraussetzungen.
Unterschiede im Verfahrensprozess: Einmaliges Anerkennungsgespräch versus mehrmaliger Kontakt
Im Vergleich zum Verfahren der Stiftung Anerkennung und Hilfe wurden die materiellen Hilfen im Fonds Heimerziehung nicht direkt als Geldleistung ausgezahlt. Die Betroffenen konnten stattdessen – durch den Fonds bezahlte – Dienstleistungen in Anspruch nehmen oder Waren erwerben, die die Folgeschäden der damaligen Unterbringung lindern sollten. Diese Vorgehensweise, die einerseits von vielen Betroffenen als Bevormundung empfunden wurde, ermöglichte andererseits eine längerfristige Begleitung der ehemaligen Heimkinder. Im Verlauf dieser Begleitung entwickelten sich teilweise vertrauensvolle Beziehungen zwischen ehemaligen Heimkindern und den Beraterinnen und Beratern, die den persönlichen Aufarbeitungsprozess der Betroffenen fördern konnten.
Im Rahmen der Beratungen der Stiftung Anerkennung und Hilfe findet in der Regel nur ein Gespräch statt. Im Anschluss werden die Leistungen ausgezahlt, ohne dass eine weitere Rechtfertigung für die Verwendung geleistet werden muss. Damit ist das Verfahren nach dem Gesprächstermin für die Betroffenen meist nach kurzer Zeit abgeschlossen.
Beide Modelle sehen eine Lotsenfunktion vor, also die bedarfsgerechte Er- und Vermittlung von Leistungen anderer (Sozial-)Systeme. Personen, die sich beim Fonds Heimerziehung angemeldet hatten, nutzten die Anlaufstelle als Lotse bei der Vermittlung zusätzlicher Hilfen häufiger als Personen, die sich bei der Stiftung Anerkennung und Hilfe gemeldet hatten.
Unterschiede in der familialen Situation: Heimeinweisung aufgrund Beeinträchtigung im Lebensumfeld versus persönlicher Beeinträchtigung
Ehemalige Heimkinder, die im Rahmen der Kinder- und Jugendhilfe untergebracht waren, hatten oftmals wenig Kontakt zu ihren Herkunftsfamilien oder wurden in Lebensbedingungen hineingeboren, die zu einer Heimeinweisung führten. Dabei spielten auch die damaligen gesellschaftlichen Moralvorstellungen eine wichtige Rolle. Bereits eine uneheliche Geburt konnte zu einer Unterbringung führen. Diese Voraussetzungen führten oft zu gebrochenen Biographien und Schwierigkeiten, sich im gesellschaftlichen Gefüge zurechtzufinden.
Betroffene, die sich bei der Stiftung Anerkennung und Hilfe meldeten, wurden wegen ihrer Behinderung in Heimen untergebracht. Viele von ihnen hatten regelmäßigen Kontakt zu ihren Herkunftsfamilien und konnten auch nach der Unterbringung auf familiäre Ressourcen zurückgreifen. Auch im Beratungs- und Antragsverfahren der sind viele Angehörige als Unterstützerinnen und Unterstützer oder als rechtliche Betreuerinnen und Betreuer eingebunden.
Unterschiede in der Lebensführung: Heutiges Leben in einer Einrichtung versus eigenständiges Leben nach der Unterbringung
Wie im Text über die Arbeit der Anlaufstelle der Stiftung Anerkennung und Hilfe in Bayern geschildert, lebt ein großer Teil der Menschen, die in Einrichtungen der Behindertenhilfe untergebracht war, auch heute noch in Einrichtungen; nicht wenige sogar in den Einrichtungen, in denen sie als junge Menschen Leid und Unrecht erfahren haben. Diese Tatsache hat mehrere Konsequenzen: Die Gespräche im Rahmen der Antragstellung bei der Stiftung Anerkennung und Hilfe werden vielfach in den Einrichtungen geführt. Bei Betroffenen und Angehörigen stellen sich aufgrund dieser besonderen Konstellation manchmal Loyalitätskonflikte ein, denn viele berichten heute über gute Erfahrungen und empfinden Dankbarkeit gegenüber der Einrichtung und dem Personal.
Im Rahmen des Verfahrens im Fonds Heimerziehung suchten viele Betroffene die Anlaufstelle persönlich auf oder wurden von den Beraterinnen und Beratern zuhause besucht. Unter anderem führte dies dazu, dass es vergleichsweise wenig Kontakte von Seiten der Anlaufstelle zu Einrichtungen gab. Die jungen Menschen von damals haben mit Erreichen der Volljährigkeit in der Regel die Einrichtung verlassen und sich ein eigenständiges Leben aufgebaut. Die Vorstellung, im Alter noch einmal in einer Einrichtung untergebracht zu werden, löst bei vielen Betroffenen große Besorgnis aus.
Dies ist wiederum auch bei den gehörlosen Betroffenen der Fall und somit ein gemeinsames Anliegen verschiedener Betroffenengruppen, im Alter mit diesem Thema nicht alleine gelassen zu werden.
Zitierhinweis: Annina Börgmann, Melanie Seitz, Daniela Singer, Die Arbeit der Anlaufstelle der Stiftung Anerkennung und Hilfe in Bayern, in: Heimkindheiten, URL: […], Stand: 21.02.2022.
Teilen
 leobw
leobw