Gedanken zur Aufarbeitung in der Johannes-Diakonie Mosbach
Von Richard Lallathin
![Porträt Richard Lallathin [Quelle: Richard Lallathin]. Zum Vergrößern bitte klicken. Porträt Richard Lallathin [Quelle: Richard Lallathin]. Zum Vergrößern bitte klicken.](/documents/10157/19373997/Lallathin_Bild+3+-+R.+Lallathin_vor.jpg/5842018e-372a-4ebe-afa9-ed63f28f28cb?t=1648195423285)
Zu Beginn dieses Textes geht es zunächst allgemeiner um kirchliche Einrichtungen im Bereich der Behindertenhilfe in Baden-Württemberg. Nachfolgend schildert der Autor seine Gedanken zur Aufarbeitung in der Johannes-Diakonie Mosbach.
Bis weit in die Zeit nach dem 2. Weltkrieg waren kirchliche Einrichtungen die einzigen Anbieter von institutionalisierter und spezialisierter Hilfen für Menschen mit Behinderungen. Diese Einrichtungen waren in der Regel geschlossene Einheiten oder dörfliche Gemeinschaften. Das Leben folgte dem Rhythmus des Kirchenjahres; der Tagesablauf wurde durch Andachten und Gottesdienste strukturiert. Bewohner*innen und Mitarbeitende verstanden sich als christliche Hausgemeinschaft. Jeder und jede hatte seinen und ihren festen Platz mit je eigener Aufgabe und Rolle in dieser Gemeinschaft.
Der Betonung der christlichen Grundhaltung entsprach auf der anderen Seite die Erwartung von Menschen mit Behinderung bzw. deren Angehörigen, hier einen „guten Ort“ zum Leben zu finden.
Der alles überstrahlende Name ist bis heute die „v. Bodelschwinghsche Stiftungen Bethel“ in Bielefeld. In Württemberg sind insbesondere zu nennen: Als evangelische Einrichtungen die Pfingstweide bei Tettnang und Mariaberg/Gammertingen als die ältesten Einrichtungen, die Zieglersche in Wilhelmsdorf, Stetten im Remstal und als katholische Einrichtung die Stiftung Liebenau/Ravensburg; auf badischer Seite das Josefshaus in Herten/Lörrach (katholisch) und auf evangelischer Seite das Epilepsiezentrum Kork sowie die 1879 in Karlsruhe gegründete und 1880 in Mosbach errichtete Johannes-Diakonie.
Ich habe als junger Mensch als Ferienhelfer in der Johannes-Diakonie Mosbach und als Student und ehrenamtlicher Mitarbeiter in den v. Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel in Bielefeld prägende Zeiten und intensive Begegnungen mit Menschen mit Behinderung und auch mit Mitarbeitenden erfahren dürfen. Ich habe diese beiden Großeinrichtungen der Diakonie als Orte erlebt, an denen der christliche Geist Gestalt annahm in Form der tätigen Nächstenliebe und der Hilfe für den „geringsten Bruder“ bzw. „die geringste Schwester“ (Matthäus-Evangelium 25,40).
Mit besonderer Betroffenheit habe ich deshalb die Diskussionen um Gewalt und Missbrauch verfolgt, die Menschen erleiden mussten, die sich der Fürsorge und Unterstützung in kirchlichen Einrichtungen anvertraut haben. Die zusammenfassende Erkenntnis vieler Studien ist, dass Gewalt generell und strukturell in stationären Einrichtungen der Behindertenhilfe vorkam und vorkommt. Im Zusammenhang der Diskussionen um Erziehungsheime wurden diese einmal so beschrieben: Sie waren eine Mischung aus Kloster, Kaserne und Gefängnis.
Um das Jahr 2010 wandte sich ein ehemaliger Bewohner an die Johannes-Diakonie: Er berichtete davon, als Jugendlicher Ende der 1960er Jahre bei uns Gewalt erfahren zu haben. Daraufhin gaben wir eine Studie in Auftrag, mit dem Ziel, den Alltag in den 1950er und 1960er Jahren und das Vorkommen von Gewalt in dieser Zeit zu untersuchen. Die Studie wurde am Sozialwissenschaftlichen Frauenforschungsinstitut der Evangelischen Hochschule Freiburg unter der Leitung von Professorin Cornelia Helfferich erstellt. Der Abschlussbericht wurde im Oktober 2012 unter dem Titel „Historische Aufarbeitung: Der Alltag in den 1950er und 1960er Jahren in der Johannes-Diakonie Mosbach und das Vorkommen von Gewalt“ vorgelegt.
Diese Studie bestätigte das bereits in weiteren Studien zu anderen Einrichtungen gewonnene Bild: Die besondere Situation der ersten Nachkriegsjahre begünstigte die Exklusion von Menschen mit Behinderung. Das nationalsozialistische Rasse-, „Euthanasie“- und Herrenmenschen-Denken war mit Kriegsende keineswegs verschwunden. Bis weit in die 1960er Jahre fand die Arbeit mit behinderten Menschen unter katastrophalen Bedingungen statt. Die bauliche Situation hatte sich praktisch seit Beginn des 20. Jahrhunderts nicht geändert. Es gab zu wenig Mitarbeitende und diese waren fachlich kaum ausgebildet. Manche waren durch den Krieg traumatisiert oder sie praktizierten Erziehungsmethoden, die sie sich im Nationalsozialismus angeeignet hatten. Und heute wissen wir auch, dass pädophil veranlagte Menschen gezielt ihren Arbeitsplatz dort gesucht haben, wo sie abhängigen Menschen nahe sein konnten. Verschärfend kam hinzu, dass sehr schwer behinderte Menschen nicht verbalisieren können, was ihnen an Unrecht angetan wird – oder es wurde ihnen nicht geglaubt, wenn sie von erfahrenem Unrecht und von Gewalt berichteten. Zugleich waren die Arbeitsbedingungen für Mitarbeitende durch Personalnot, Überlastung und mangelnde Qualifikation bestimmt.
Zu dieser katastrophalen Situation konnte es dadurch kommen, dass in den ersten Nachkriegsjahren die Behinderteneinrichtungen keinen Anteil bekamen an dem wirtschaftlichen Aufschwung und an der schnellen Verbesserung der Lebensverhältnisse in Deutschland. So waren auch die Einrichtungen Teil der strukturellen Exklusion und Vernachlässigung von Menschen mit Behinderung. Dennoch sollte gewürdigt werden, dass viele Mitarbeitende in dieser Zeit ebenfalls unter den Bedingungen litten und mit hohem Einsatz zumindest die elementaren Lebensbedürfnisse der Bewohnerinnen und Bewohner zu erfüllen versuchten.
In den vergangenen Jahren haben sich mehrere Menschen an mich gewandt, die in den 1950er Jahren in unserer und in anderen Einrichtungen Gewalt erfahren haben. Die Bandbreite geht dabei von Schlägen und körperlicher Züchtigung über Zwangsmaßnahmen beim Essen bis hin zur Erzeugung von für Kinder existenzieller und lebensbedrohlicher Angst. Es wird von schlechtem Essen berichtet. Die Kinder sind gezwungen worden, es einzunehmen und den Teller vollständig leer zu essen. Wenn sich ein Kind übergeben hat, musste es das Erbrochene aufessen. Kinder bloßzustellen und vor anderen herabzuwürdigen, war verbreitet. Eine Person berichtete mir, dass sie vor die offene Ofentür gehalten wurde. Ihr wurde gedroht, beim nächsten Fehlverhalten in den Ofen geworfen zu werden. Als besonders belastend wurde von allen genannt, dass ihnen mit Konsequenzen gedroht wurde, falls sie von dem Geschehenen außerhalb der Einrichtung, z.B. den Eltern, berichten. Zugleich hatten sie aber auch den Eindruck, dass ihnen, hätten sie damals davon erzählt, nicht geglaubt worden wäre. Für die meisten ist es eine große Entlastung und Befreiung, dass sie heute von ihrem erlittenen Unrecht berichten können – und ihnen geglaubt und in vielen wissenschaftlichen Studien bestätigt wird, dass ihre kindliche Wahrnehmung richtig war.
Davon unabhängig zeigten sich mache unzufrieden mit den aktuellen kirchlichen und staatlichen Regelungen zur Wiedergutmachung ihres erfahrenen Leides.
In einigen Gesprächen war ich überrascht, wie schnell wir auf ganz andere Themen zu sprechen kamen, die nichts mehr mit dem erfahrenen Unrecht zu tun hatten. Offensichtlich war das Aussprechen dessen, was sie als Kind erlebt und jahrzehntelang mit sich herumgetragen haben, ein guter Abschluss einer schweren und viele Jahre andauernden Belastung.
In den zurückliegenden Jahrzehnten haben sich die Rahmenbedingungen der Arbeit mit behinderten Menschen grundlegend geändert. Mit der Einführung des Bundessozialhilfegesetzes im Jahr 1961 wurde sie endlich auch materiell besser ausgestattet. Ab Mitte der 1960er Jahre erfolgte ein geradezu explosionsartiger Aus- und Umbau der traditionellen Anstalten zu modernen Rehabilitationszentren. Es wurden neue Wohnheime gebaut und die Großgruppen mit Schlafsälen für 20 und mehr Bewohnerinnen und Bewohnern wurden abgeschafft. Seit 2009 gilt in Baden-Württemberg die Regelung, dass jeder Mensch in einer stationären Einrichtung das Recht auf ein Einzelzimmer mit angeschlossener Nasszelle hat. Es entstanden in den Werkstätten neue Arbeitsplätze. Die diagnostischen und therapeutischen Angebote wurden weiter ausgebaut. Die Mitarbeitenden wurden qualifiziert; in den neu geschaffenen Fachschulen wurden sie zu Heilerziehungspflegerinnen und -pflegern ausgebildet. Ein breites Spektrum an Fächern, von Medizin über Psychologie und Pädagogik bis hin zu Religion und Ethik, befähigt sie, Menschen mit Behinderung angemessen und fachlich kompetent zu begleiten. Weitere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anderer Professionen erweitern das Spektrum der Assistenzleistungen für Menschen mit Behinderung.
Inzwischen ist Inklusion das Leitbild der Eingliederungshilfe (wie die Arbeit mit behinderten Menschen in der Fachsprache heißt) geworden. Die UN-Behindertenrechtskonvention, vom Bundestag 2009 verabschiedet, erklärt die Inklusion zur Grundlage der Behindertenarbeit. Im Zentrum der Konvention steht das Recht von Menschen mit Behinderung, ein möglich selbstbestimmtes Leben zu führen. „Behinderung“ wird jetzt nicht mehr vornehmlich medizinisch, sondern gesellschaftlich verstanden. Es wird nicht mehr vorrangig gefragt, welche körperlichen und geistigen Einschränkungen ein Mensch hat, vielmehr wird der Blick auf die gesellschaftlichen Gegebenheiten gerichtet, die ihn davon abhalten, am Leben umfassend teilhaben zu können. Die Arbeit mit behinderten Menschen wird in dieser Perspektive zu Menschenrechtsarbeit.
Dennoch ist es eine bleibende Aufgabe, auch unter den verbesserten Rahmenbedingungen darauf zu achten, dass Menschen in Einrichtungen der Behindertenhilfe keine Form von Gewalt oder Unfreiheit erleiden müssen. In Aus- und Fortbildung werden Mitarbeitende hierfür sensibilisiert, Gewaltschutzkonzepte werden erarbeitet und in der Praxis umgesetzt. Kein Mensch darf Lebenssituationen ausgesetzt werden, in denen er Gewalt erlebt oder von Ängsten bestimmt ist. Das gilt für jeden Menschen – aber ganz besonders für Menschen, die Aufgrund ihrer Behinderung von anderen Menschen abhängig und auf ihre Fürsorge angewiesen sind.
Richard Lallathin war von 1989-2000 Gemeindepfarrer in Freiburg und ist seit 2000 als Pfarrer in der Johannes-Diakonie Mosbach tätig.
Literaturhinweise:
- Cornelia Helfferich: Historische Aufarbeitung: Der Alltag in den 1950er und 1960er Jahren in der Johannes-Diakonie Mosbach und das Vorkommen von Gewalt, Freiburg 2012
- Schmuhl, Hans-Walter; Winkler, Ulrike, „Als wären wir zur Strafe hier“. Gewalt gegen Menschen mit geistiger Behinderung. Der Wittekindshof in den 1950er und 1960er Jahren, Bielefeld 2011
Zitierhinweis: Richard Lallathin, Gedanken zur Aufarbeitung in der Johannes-Diakonie Mosbach, in: Heimkindheiten, URL: […], Stand: 21.03.2022.


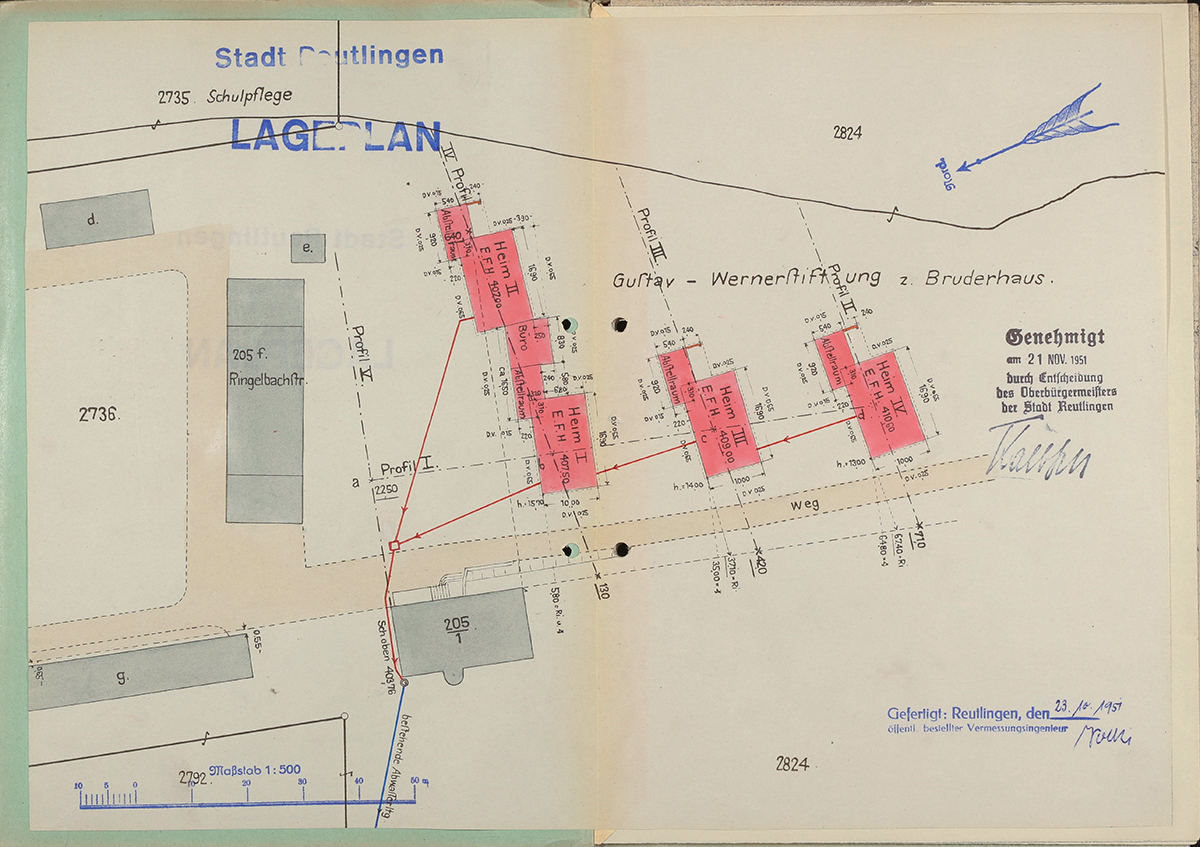


 leobw
leobw