Weil am Rhein
![Weil am Rhein-Ötlingen und Binzen, Luftbild von Süden 1983]()
Weil am Rhein-Ötlingen und Binzen, Luftbild von Süden 1983 [Copyright: Landesmedienzentrum Baden-Württemberg; 01.06.1983] /
Zur Detailseite ![Luftbild: Film 77 Bildnr. 683, Bild 1]()
Luftbild: Film 77 Bildnr. 683, Bild 1 [Quelle: Landesarchiv BW] /
Zur Detailseite ![Vitra Design Museum in Weil am Rhein 2002]()
Vitra Design Museum in Weil am Rhein 2002 [Copyright: Landesmedienzentrum Baden-Württemberg; 26.03.2002] /
Zur Detailseite ![Luftbild: Film 81 Bildnr. 476, Bild 1]()
Luftbild: Film 81 Bildnr. 476, Bild 1 [Quelle: Landesarchiv BW] /
Zur Detailseite ![Luftbild: Film 81 Bildnr. 477, Bild 1]()
Luftbild: Film 81 Bildnr. 477, Bild 1 [Quelle: Landesarchiv BW] /
Zur Detailseite ![Rheinhafen von Weil am Rhein 1982]()
Rheinhafen von Weil am Rhein 1982 [Copyright: Landesmedienzentrum Baden-Württemberg; 20.07.1982] /
Zur Detailseite ![Luftbild: Film 81 Bildnr. 473, Bild 1]()
Luftbild: Film 81 Bildnr. 473, Bild 1 [Quelle: Landesarchiv BW] /
Zur Detailseite ![Weil am Rhein (Stadt LÖ), Bild 1]()
Weil am Rhein (Stadt LÖ), Bild 1 [Quelle: Landesarchiv BW] /
Zur Detailseite ![Weil am Rhein: Kirche 1960]()
Weil am Rhein: Kirche 1960 [Copyright: Landesmedienzentrum Baden-Württemberg; 1960] /
Zur Detailseite ![Luftbild: Film 81 Bildnr. 470, Bild 1]()
Luftbild: Film 81 Bildnr. 470, Bild 1 [Quelle: Landesarchiv BW] /
Zur Detailseite ![Luftbild: Film 77 Bildnr. 681, Bild 1]()
Luftbild: Film 77 Bildnr. 681, Bild 1 [Quelle: Landesarchiv BW] /
Zur Detailseite ![Luftbild: Film 71 Bildnr. 460, Bild 1]()
Luftbild: Film 71 Bildnr. 460, Bild 1 [Quelle: Landesarchiv BW] /
Zur Detailseite ![Vitra Design Museum]()
Vitra Design Museum [Copyright: Vitra Design Museum Foto: Thomas Dix] /
Zur Detailseite ![Luftbild: Film 71 Bildnr. 473, Bild 1]()
Luftbild: Film 71 Bildnr. 473, Bild 1 [Quelle: Landesarchiv BW] /
Zur Detailseite ![Weil am Rhein: OT Ötlingen, St. Galluskirche, Nische im Chor mit Sakramentshäuschen 1978]()
Weil am Rhein: OT Ötlingen, St. Galluskirche, Nische im Chor mit Sakramentshäuschen 1978 [Copyright: Landesmedienzentrum Baden-Württemberg; 01.01.1978] /
Zur Detailseite ![Weil Autobahnbaustelle 1963]()
Weil Autobahnbaustelle 1963 [Copyright: Landesmedienzentrum Baden-Württemberg; 1963] /
Zur Detailseite ![Weil der Stadt: Eingang zum Pfarrhaus "Domhof" um 1960]()
Weil der Stadt: Eingang zum Pfarrhaus "Domhof" um 1960 [Copyright: Landesmedienzentrum Baden-Württemberg; 1960] /
Zur Detailseite ![Wappen von Weil am Rhein]()
In Silber (Weiß) über einem erniedrigten blauen Wellenbalken eine blaue Traube mit acht sichtbaren Beeren und grünem Blatt. /
Zur Detailseite ![Luftbild: Film 71 Bildnr. 466, Bild 1]()
Luftbild: Film 71 Bildnr. 466, Bild 1 [Quelle: Landesarchiv BW] /
Zur Detailseite ![Weil am Rhein, OT Ötlingen, Luftbild 1983]()
Weil am Rhein, OT Ötlingen, Luftbild 1983 [Copyright: Landesmedienzentrum Baden-Württemberg; 1983] /
Zur Detailseite ![Weil am Rhein-Ötlingen und Binzen, Luftbild von Süden 1983]()
Weil am Rhein-Ötlingen und Binzen, Luftbild von Süden 1983 [Copyright: Landesmedienzentrum Baden-Württemberg; 01.06.1983] /
Zur Detailseite Previous Next Die Große Kreisstadt liegt an der südwestlichen Ecke des Landkreises Lörrach im Dreiländereck von Deutschland, Frankreich und der Schweiz. Das Stadtgebiet mit seinen vier Teilorten erstreckt sich vom Rhein über die extrem breit ausgebildete Markgräfler Rheinebene auf den rd. 150 m steil aufsteigenden Tüllinger Berg hinauf, der das südliche Ende des Markgräfler Hügellandes markiert. Dort wird an der Stadtgrenze mit 456 m über NN das Höhenmaximum erreicht, das zum Rhein hin auf 230 m (Gemarkung Märkt) abfällt. Eine besondere Zäsur bildet das bis 20 m hohe Hochgestade, mit dem sich die Niederterrasse über die heute ebenso dicht besiedelte einstige Aue erhebt. Lediglich in den Naturschutzgebieten ‚Krebsbachtal‘ und ‚Kiesgrube Käppelin‘ blieb naturnahe Vegetation erhalten. Die ursprünglich mehrzellige Kernstadt nimmt die gesamte Breite der Ebene bis zum Tüllinger Berg ein. Einst Winzerdorf, Eisenbahnersiedlung und Textilindustriezentrum, hat sie sich zum weithin ausstrahlenden Dienstleistungs- und Versorgungsstandort entwickelt, der zusammen mit dem benachbarten Lörrach die Funktion eines Oberzentrums erfüllt. Das Vitragelände und seit 2007 die Dreiländerbrücke sind neue Wahrzeichen. Der Hafen ist heute in das Schweizer Rheinhafensystem integriert. Die B3 und die B317 enden in der Kernstadt, die A5 setzt sich ab der Schweizer Grenze als A2 fort. Der zum Badischen Bahnhof gehörende riesige Verschiebebahnhof ist seit 1999 DB-Containerumschlagbahnhof Weil/Basel. Die Rheintalbahn läuft die Kernstadt seit 1856 an; von hier geht eine Verbindung nach Lörrach ab. 1809 kamen alle Teilorte vom Oberamt Rötteln zum Bezirksamt bzw. Landkreis (1939) Lörrach.
Teilort
Wohnplatz
aufgegangener Ort
Wüstung
Das Stadtgebiet im äußersten Südwesten der Bundesrepublik wird naturräumlich hauptsächlich von fluvialen Ablagerungen geprägt, so im Südosten durch den breiten Schwemmfächer der Wiese, an den sich im Nordwesten die Rheinniederterras-senschotter des Weil-Efringer Hochgestades und die darin deutlich eingetiefte Rheinaue anschließt. Im Nordosten nimmt das Gemeindegebiet den Westhang des aus tertiären Kalken aufgebauten Tüllinger Berges ein, der die Grenze zum Verwaltungsraum Lörrach bildet. Die landwirtschaftliche Nutzung entspricht außerhalb der flächenhaften Bebauung weitgehend dem Untergrund: feuchte Standorte mit Grünlandnutzung in der Rheinaue und dem Wieseschwemmfächer, Ackerbau auf der vom Schwemmlöß bedeckten Niederterrasse; der Tüllinger Berg ist seiner günstigen Exposition wegen dem Weinbau vorbehalten.
![]()
Wanderungsbewegung Weil am Rhein
![]()
Natürliche Bevölkerungsbewegung Weil am Rhein
![]()
Bevölkerungsdichte Weil am Rhein
![]()
Altersstruktur Weil am Rhein
![]()
Bundestagswahlen (ab 1972) Weil am Rhein
![]()
Europawahlen Weil am Rhein
![]()
Landtagswahlen (ab 1972) Weil am Rhein
![]()
Schüler nach Schularten Weil am Rhein
![]()
Übergänge an weiterführende Schulen Weil am Rhein
![]()
Beschäftigte nach Wirtschaftsbereichen (aktuell) Weil am Rhein
![]()
Aus- und Einpendler Weil am Rhein
![]()
Bestand an Kfz Weil am Rhein
Previous Next 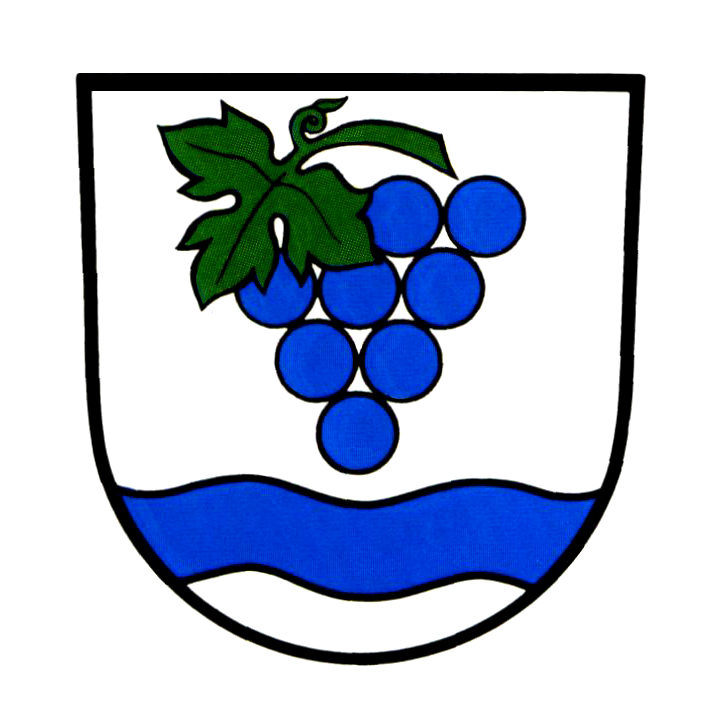
In Silber (Weiß) über einem erniedrigten blauen Wellenbalken eine blaue Traube mit acht sichtbaren Beeren und grünem Blatt.
Beschreibung Wappen
1929 wurde der zum bedeutenden Industriestandort gewordene Ort Weil zur Stadt erhoben. Im 18. Jahrhundert galt als Wappen der Gemeinde ein Rebmesser und die Initiale W, „weilen ihr mehrerste Arbeit in denen Reeben ist." Auch die Gemeindesiegel ab 1811 zeigen als Weinbausymbol eine Traube. Erst nach der Stadterhebung wurde das Siegelbild in einen schwülstigen Wappenschild gesetzt. Bemühungen um eine Neugestaltung des Wappens seit 1952 führten zur Verleihung des heutigen Wappens durch das Innenministerium am 6. August 1962. Der neben dem Weinbausymbol aufgenommene Wellenbalken verdeutlicht die Lage der Gemeinde am Rhein und dessen wirtschaftliche Bedeutung für die Stadt. Auch die Wappen der 1971 und 1975 eingemeindeten Orte enthalten Bilder des Weinbaues (Haltingen und Otlingen) oder einen Bezug zum Rhein (Markt).
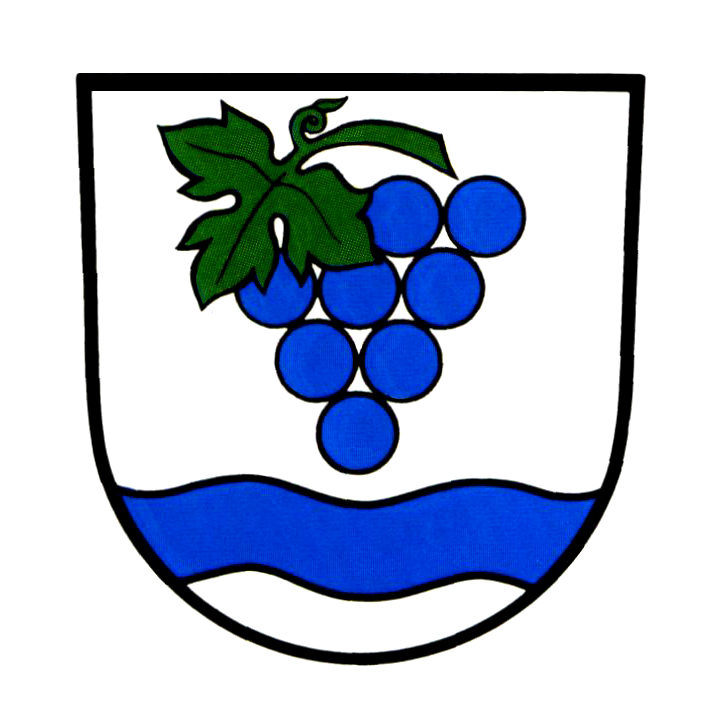























































































 leobw
leobw