Eschenburg, Theodor Rudolf Georg
| Geburtsdatum/-ort: | 24.10.1904; Kiel |
|---|---|
| Sterbedatum/-ort: | 10.07.1999; Tübingen |
| Beruf/Funktion: |
|
| Kurzbiografie: | 1911-1913 Privatschule in Cuxhaven 1913-1922 Gymnasium in Kiel 1922-1924 Gymnasium in Lübeck 1924-1926 Studium Universität Tübingen 1926 Studium Universität Berlin 1928 Promotion Universität Berlin 1929-1933 Wissenschaftlicher Referent VDMA, Berlin 1933-1945 Geschäftsführer industrieller Verbände 1945-1947 Staatskommissar für das Flüchtlingswesen Württemberg-Hohenzollern 1947-1952 Ministerialrat/Staatsrat Innenministerium Württemberg-Hohenzollern 1949-1952 Honorarprofessor Universität Tübingen 1952-1969 ordentlicher Professor für Politikwissenschaften Universität Tübingen 1961-1963 Rektor der Universität Tübingen |
| Weitere Angaben zur Person: | Religion: evangelisch Auszeichnungen: Schillerpreis der Stadt Mannheim (1960) Karl-Bräuer-Preis des Bundes der Steuerzahler (1962) Mitglied des Ordens Pour le mérite für Wissenschaft und Künste (1968) Mitglied des PEN Zentrums der BRD (1971) Heinz-Herbert-Karry-Preis (1983) Aschendorfer Historikerpreis (1984) Großkreuz des Bundesverdienstkreuzes (1986) Verheiratet: 1. 1934 Erika, geb. Kempf (1908-1976), Juristin 2. 1982 Ingrid, geb. Uebelmesser Eltern: Theodor (1876-1968), Konteradmiral Ellen, geb. Wieler (1883-1918) Geschwister: 3 Brüder, 1 Schwester Kinder: aus 1. Ehe Ellen Kemmler (1935-1983), Ärztin; Christine Eschenburg-Schricker (1939), Rechtsanwältin; Ulrike Störring (1943), Ärztin; Susanne (1949), Lehrerin |
| GND-ID: | GND/118682377 |
Biografie
| Biografie: | Hans-Georg Wehling (Autor) Aus: Baden-Württembergische Biographien 3 (2002), 66-74 Eschenburgs Biografie wird durch drei unterschiedliche Karrieren markiert, die sich im Zeitverlauf nahezu nahtlos aneinander gereiht haben, stets die nächste Karriere auch bereichernd. Die erste Karriere, die des Verbandsfunktionärs, geht bis zum Ende von Nationalsozialismus und II. Weltkrieg. Die zweite Karriere ist die des politischen Beamten im Land Württemberg-Hohenzollern. Sie reicht von seiner Ernennung zum Flüchtlingskommissar 1945 bis zur Gründung des Südweststaates 1952. Hier bekam er die Chance, die Bildung des neuen Landes Baden-Württemberg mit zu ermöglichen. Die dritte Karriere ist die des Tübinger Professors für Politikwissenschaft, die ihm bundesweite Aufmerksamkeit und Anerkennung verschaffte, gerade auch weil er aus dem Erfahrungsschatz voraufgegangener Karrieren politisch kommentierend und (be)ratend tätig sein konnte. Er wurde hier zum „praeceptor Germaniae“ – und blieb es eigentlich bis zu seinem Tode. Seine Bedeutung für die Politikwissenschaft lag nicht in seinem Beitrag zur wissenschaftlichen Theoriebildung, sondern in seiner – wertenden – Analyse politischer Realität mit hohem Praxisbezug. Sein Ziel war der gute Staat, mit einer guten Verfassung und gut funktionierenden Institutionen, innerhalb deren die politisch Handelnden sich funktionsgerecht verhalten. Damit zielte er nicht nur auf die politischen Eliten: Für eine stabile Demokratie hielt er eine demokratische politische Kultur für unerlässlich. Von daher sein Einsatz für die politische Bildung von Anfang an: Der demokratische Staat kann nur Bestand haben, wenn seine Bürger ihn verstehen und sich entsprechend verhalten. Als Institutionalismus und vielleicht auch als Funktionalismus läßt sich so am ehesten der theoretische Ansatz bezeichnen, der seinem Denken implizit zu Grunde liegt. Eine gewisse Nähe zum Staatsrecht ist unverkennbar. Zugleich aber zeichnet sein Denken eine ausgeprägte historische Tiefendimension aus. Sein historisches Interesse und seine Kenntnisse waren beeindruckend. Mit einer zeitgeschichtlichen Studie hatte er bereits promoviert: „Das Kaiserreich am Scheidewege“ hieß der Titel seiner Dissertation von 1928, in der er – aus den nachgelassenen Papieren des liberalen Politikers Ernst Bassermann den beinahe erfolgreichen Weg zur Parlamentarisierung des Kaiserreichs untersucht hatte. Hier schon zeigte sich seine Vorliebe für griffige Formulierungen und zugkräftige Titel: „Bassermann, Bülow und der Block“ hieß der Untertitel. Aus geschichtlicher Erfahrung heraus, aus dem Bedürfnis nach Bearbeitung einer katastrophal verlaufenen jüngsten Vergangenheit, hat er Politikwissenschaft begründet und betrieben. Sowohl konkret bezogen auf die Erfahrungen als auch abstrahierend-generell sah er die Aufgabe von Politikwissenschaft und politischer Bildung darin, Lehren aus der Geschichte zu ziehen. Mit seiner Art, Politikwissenschaft zu betreiben, war immer ein „pädagogischer“ Impetus verbunden: Politikwissenschaft vor dem Hintergrund geschichtlicher Erfahrung gleichsam aus dem Geist politischer Bildung heraus, die drei tiefgreifende Regimewechsel in Deutschland geformt hatte. Nicht nur sein pädagogischer Impetus, auch seine wissenschaftliche Fragerichtung zielte darauf, wie eine dauerhafte, gute Staatsordnung zu errichten sei, wie die Institutionen konstruiert sein müßten, um dieses Ziel zu gewährleisten. Das traf sich mit den Erwartungen der damals Studierenden in der Aufbauphase nach 1945. Damit hat Eschenburg einen dauerhaften Beitrag zur Etablierung der demokratischen Ordnung in der Bundesrepublik Deutschland geleistet – und war so auch in seiner wissenschaftlichen Tätigkeit mehr als ein Wissenschaftler. Man hat immer wieder versucht, das wissenschaftliche Leben Eschenburgs an drei Disziplinen fest zu machen: Eschenburg als Politikwissenschaftler, als Historiker, als Staatsrechtslehrer. Und Eschenburg als Mann der politischen Bildung, müßte man noch ergänzend hinzufügen (auch wenn das kein Universitätsfach ist). So hat Eschenburg das Münchener „Institut für Zeitgeschichte“ mitbegründet und dessen renommierte Zeitschrift „Vierteljahreshefte für Zeitgeschichte“ mit herausgegeben. Ferner war Eschenburg über Jahre hinweg Richter am Staatsgerichtshof von Baden-Württemberg. Kennzeichnend für ihn ist jedoch, daß er stets die drei genannten Fächer miteinander verbunden hat. Geographisch läßt sich Eschenburgs Existenz an vier Städten festmachen: am Geburtsort Kiel, mehr noch Lübeck als der „Stammsitz“ der Familie, wo er u. a. auch zur Schule ging (auf das traditionsreiche Gymnasium „Katharineum“): Es ist die Welt von Thomas Manns „Buddenbrooks“, aus der er kommt. Sodann Berlin, jene auch von ihm als politisch, gesellschaftlich und kulturell an- und aufregend empfundene Stadt, in die er zum Abschluß seines Studiums ging, wo er seine Berufstätigkeit begann, heiratete und wo er Drittes Reich und II. Weltkrieg erlebte. Und schließlich Tübingen, wo er sein Studium begonnen hatte und in das er nach Kriegsende zurückkehrte, erst als hoher Beamter, dann als Universitätslehrer. Wenn man Eschenburg heißt und die Familie aus Lübeck kommt, wird man bereits mit einem goldenen Löffel geboren. Die Eschenburgs sind Lübisches Patriziat. Der Großvater Georg war als Bürgermeister von Lübeck quasi das Staatsoberhaupt der Freien Hansestadt (der „Konsul Huneus“ der „Buddenbrooks“). Insgesamt 30 Jahre lang war er Mitglied des Senats der Hansestadt Lübeck, also der Regierung dieses Mitgliedstaates des Deutschen Reiches. Der „Gotha“ führte denn auch die Eschenburgs unter der Rubrik „regierendes Haus“ auf. Auch Eschenburg hatte dem äußeren Auftreten nach zeitlebens etwas Aristokratisches an sich, lässig zur Schau getragen, wirkungsvoll unterstrichen durch die hünenhafte Gestalt. Der Großvater mütterlicherseits war hauptamtlicher Stadtrat von Kiel, Leiter des Tiefbaudezernats. Er stammte zwar aus einer ostpreußischen Großgrundbesitzerfamilie, war aber wie schon sein Vater linksliberal, wohl wegen seiner Wertschätzung der kommunalen Selbstverwaltung. Seine Frau stammte zudem aus einer mennonitischen Familie aus dem ostpreußischen Elbing mit egalitär-pazifistischem Hintergrund. Der Vater, Offizier der Kaiserlichen Marine, wurde als militärischer Fachmann in die Marine der Weimarer Republik übernommen, trotz seiner bekannt kaisertreuen, politisch eher reaktionären Gesinnung. 1923 wurde er Marinekommissar für den Kaiser-Wilhelm-Kanal (heute Nord-Ostsee-Kanal) und den Hafen von Kiel. Da er – auch wörtlich – ein Freund des abgedankten Kaisers war und daraus auch keinerlei Hehl machte, wurde er 1926 verabschiedet, im Rang eines Konteradmirals. Fortan besuchte er Wilhelm II. regelmäßig in dessen Exil in Doorn in den Niederlanden und half ihm, Kaiser zu spielen; dafür wurde er von Wilhelm II. in den Rang eines Generaladjutanten erhoben. Eschenburg war von Jugend auf historisch und politisch hoch interessiert. Mit seinem Vater hat er, der Älteste, viel diskutiert, trotz voneinander abweichenden Meinungen. Politisch prägender war der Großvater in Lübeck, schon von den dortigen politischen Gegebenheiten her ein Republikaner, ein liberalkonservativer. Der Konflikt mit dem Vater nahm zu nach dem plötzlichen Tod der Mutter in Folge der Grippe-Epidemie 1918, ein Schlag, der Eschenburg als Heranwachsenden sehr getroffen hatte. Vor allem trug die Radikalisierung des Vaters nach dem verlorenen Krieg zur Verschärfung des Konflikts bei. Eschenburgs politische Einstellung damals wird charakterisiert dadurch, daß sein Leib- und Magenblatt die liberal-konservative „Frankfurter Zeitung“ wurde, an der er stets festhielt. Auch als Student in Tübingen wurde diese Zeitung ins Verbindungshaus abonniert. Zeitlebens hat Eschenburg leidenschaftlich gerne Zeitung gelesen. Später, als Professor, konnte er Examenskandidaten schrecken, indem er nach den neuesten Zeitungsberichten fragte. Noch unmittelbar vor seinem Tod lagen um ihn herum ausgebreitet Zeitungen. Und er konnte noch – dramatisch ausgedrückt: im Angesicht des Todes – mit dem Besucher über die Haushaltspolitik von Finanzminister Eichel diskutieren. Als Brillenträger taugte Eschenburg, zum Verdruß des Vaters, nicht für die Offizierslaufbahn. Er, der zeitlebens allen sportlichen Aktivitäten Abgeneigte, hätte dazu auch keine Lust gehabt. Blieb ein Studium. Eschenburg war zwar kein guter Schüler, weil er sich für bestimmte Fächer nicht interessierte: Doch Geschichte und Deutsch gehörten zu seinen Lieblingsgebieten. So wollte er Geschichte studieren. Zum Studium schickten die deutschen Herrscherhäuser ihre Söhne an die Universität Bonn. Das war selbst bei den studierten Eschenburgs aus dem republikanischen Lübeck so. Doch wegen der Rheinlandbesetzung durch die Franzosen nach dem I. Weltkrieg wich man auf andere Universitäten aus. Die Reichsregierung warnte die Familien von Berufsoffizieren, im Falle einer Zuspitzung des Konflikts mit Frankreich könnten im besetzten Rheinland Offizierssöhne als Geiseln genommen werden. Eschenburg entschied sich für Tübingen, „weil ich grade Mörike las.“ Wie die Mehrheit der damals Studierenden wurde er Mitglied in einer Verbindung, nicht in einem Corps, sondern in einer liberaleren Burschenschaft, der farbentragenden und schlagenden Verbindung „Germania“. In Tübingen lernte er eine Lebensform kennen, die ihm so nicht vertraut war, die man als süddeutsch, schwäbisch-altwürttembergisch, egalitär, liberal, parteidistanziert charakterisieren könnte. Man saß am Wirtshaustisch über alle Standesunterschiede hinweg beisammen, und in der Verwaltung spielten parteipolitische Unterschiede – wenn sie überhaupt da waren – keine Rolle. Der süddeutsche Liberalismus, wie er ihn in Tübingen vorfand, hat ihn denn auch zeitlebens mit geprägt. In Tübingen studierte er bei den Historikern Johannes Haller und Adalbert Wahl. Vor allem lernte Eschenburg an der Alma Mater auch für das Leben. Bei allem politischen Konservatismus, bei aller Vorurteilsbelastung durch das Trauma des verlorenen Krieges und eines als Schmach empfundenen Friedensvertrages konnte man es in Tübingen sich leisten, an der Universität offener über die politische Lage zu diskutieren. So wagte es Eschenburg, der von seiner Verbindung in den Tübinger Hochschulring geschickt worden war (einer formell überparteilichen Einrichtung, die aber weitgehend deutschnational von Berlin aus gesteuert wurde), Reichsaußenminister Gustav Stresemann, von dem er begeistert war, nach Tübingen als Redner einzuladen. Sechs Semester blieb Eschenburg in Tübingen. Im Umfeld der Tübinger Studentenhilfe (als Vorgängerorganisation des Studentenwerks) unter Vorsitz des Staatsrechtslehrers Karl Sartorius lernte er Kommilitonen kennen, denen er zeitlebens verbunden blieb: allen voran Paul Binder, der ihn nach Kriegsende 1945 nach Tübingen in die dortige Landesregierung holte. Ferner Wilhelm Hoffmann, Theodor Pfizer, den späteren Ulmer Oberbürgermeister und Vorsitzenden der Arbeitsgemeinschaft „Der Bürger im Staat“ (als Vorgänger der Landeszentrale für politische Bildung), den Heidenheimer Fabrikantensohn Werner Plappert sowie den Katholiken Albert Sauer. Das Interesse an der Politik zog Eschenburg zur Fortsetzung seines Studiums nach Berlin, damals die führende Universität in Deutschland. Hier studierte und promovierte er bei dem Verfassungshistoriker Fritz Härtung, dem er wohl auch sein Interesse an der Bedeutung von Institutionen mit ihrer langzeitlichen Prägekraft verdankt. Den für sein Thema unerlässlichen Kontakt zur Witwe von Ernst Bassermann – er benötigte dessen Nachlaß – knüpfte für Eschenburg Reichaußenminister Gustav Stresemann. Der schrieb ihm auch ein Vorwort zur Doktorarbeit und ermöglichte mit einer Abnahme des Buches dessen Druck. Mit Stresemann blieb Eschenburg eng verbunden, verehrte ihn geradezu, wie später nur noch Carlo Schmid. Eschenburg trat auch der Deutschen Volkspartei (DVP) Stresemanns bei. Nach dessenTod kandidierte er in der Septemberwahl 1930 für den Reichstag, für die Deutsche Staatspartei. Seine berufliche Laufbahn begann Eschenburg im November 1929 als Referent in der Grundsatzabteilung des Vereins Deutscher Maschinenbau-Anstalten (VDMA), eine Tätigkeit, die auch von Berufs wegen den Kontakt mit Politik und Verwaltung erforderte. Im Verbandswesen überlebte Eschenburg die Zeit des Nationalsozialismus. Er vertrat eine Reihe von Verbänden, deren Mitgliedsfirmen u. a. Knöpfe, Reißverschlüsse, Zelluloid-Puppen und Taschenlampen-Batterien herstellten. Die Funktion der Verbände änderte sich im Dritten Reich, sie wurden zu Instrumenten des auf den Krieg gerichteten Wirtschaftsdirigismus. Da diese Branchen in hohem Maße für den Export produzierten, galten sie dem Regime als wichtige Devisenbringer. Auslandsreisen zur Kundenpflege waren für Eschenburg an der Tagesordnung. Zudem galt er als „unabkömmlich“, der Kriegsdienst blieb ihm erspart. Seine Frau Erika hatte er 1933 beruflich kennengelernt. Die Fabrikantentochter aus Geradstetten im Remstal konnte wegen des Niedergangs der Firma in Folge der Weltwirtschaftskrise als Juristin ihr Referendariat nicht antreten (damals noch unbezahlt!). Sie war bei einer gewerkschaftseigenen Bank untergekommen, stand aber nach der Besetzung der Gewerkschaftshäuser buchstäblich auf der Straße. Da Eschenburg gerade einen Juristen benötigte, stellte er sie ein. Die Machtergreifung Adolf Hitlers am 30. Januar 1933 veränderte das Leben Eschenburgs äußerlich kaum. Wie andere Zeitgenossen auch empfand er die Regierungsübernahme durch die Nationalsozialisten als etwas Vorübergehendes. Doch bald konnte er bemerken, wie Machtergreifung sich in vielen Bereichen vollzog: unspektakulär, auf einer schiefen Ebene, von der alles in eine – falsche – Richtung rutschte: Zuerst waren in gesellschaftlichen Vereinigungen die Juden beispielsweise noch voll dabei, dann saßen sie für sich, dann meldeten sie sich nicht mehr zu Wort, schließlich kamen sie nicht mehr – und die Vereinigung löste sich von selbst auf, ohne daß die neuen Machthaber das verfügen mußten. Das Klima hatte sich verändert. Jeder versuchte, mit den neuen Verhältnissen zurecht zu kommen, sich anzupassen, manchmal seine Haut zu retten, auch mit Verstellung, mit Lügen und Anpassungsleistungen, die man als Verrat an Freunden und Bekannten verstehen konnte. Eschenburg war kein Held, eingestandenermaßen. Um vor Gefährdungen auch beruflich gesichert zu sein, trat er, der Funktionär eines Industrieverbandes, als Autobesitzer in die Motor-SS ein, machte deren Übungen mit, konnte aber auch ohne Komplikationen wieder austreten, als seine Geschäftsreisen und die Anforderungen der SS sich nicht mehr zeitlich miteinander vertrugen. Er hatte nicht nur in seinem eigenen politischen Diskussionsclub, den „Quinten“, verkehrt, sondern auch im eher reaktionären „Herrenclub“. Seine Kontaktpflege ging auch im Dritten Reich unbeirrt weiter: Man wußte, wem man vertrauen durfte. Zu seinen Bekannten aus dieser Zeit gehörten beispielsweise Ludwig Erhard und Karl Blessing. Gegen Kriegsende machte er seine letzte Auslandsreise in die Schweiz, seinen eigenen Angaben zu Folge in Sachen Reißverschlüsse. Deren Produzenten hatten sich als Kartell den Weltmarkt aufgeteilt. Dieses Kartell überstand auch Nationalsozialismus und Krieg, wie im I. Weltkrieg schon das Aluminium-Kartell, beides hat Eschenburg seinen Schülern zu deren Erstaunen immer wieder verdeutlicht. Das Kriegsende erlebte er so zufällig in der Schweiz, kehrte – mit Schwierigkeiten – zu seiner Familie im Salzkammergut zurück und ging von dort nach Plochingen in einen mittelständischen Betrieb, formal als Betriebsleiter, denn der Betriebsinhaber war Mitglied der NSDAP gewesen und brauchte zur Fortführung seines Unternehmens einen „Strohmann“. Die Verbindung hatten Eschenburgs Schwiegereltern aus dem Remstal hergestellt. Eschenburg fühlte sich in der Funktion als Betriebsleiter nicht wohl und schaute sich, seine alten schwäbischen Verbindungen aus der Studienzeit nutzend, nach etwas anderem um. Nach dem Zusammenbruch des „Dritten Reiches“, in der Aufbauphase nach dem II. Weltkrieg war der Bedarf an Fachleuten groß, zumal an solchen, die als politisch unbelastet galten. Eschenburg gehörte dazu. So verwundert es nicht, daß er von Plochingen (wenngleich amerikanische Zone) sehr schnell nach Tübingen in die Verwaltung kam. Sein alter Studienfreund Dr. Paul Binder, inzwischen Landesdirektor für Finanzen (= Finanzminister) im Staatssekretariat (= Regierung) für den französischen Teil Württembergs (als Land später Württemberg-Hohenzollern genannt) holte ihn als Flüchtlingskommissar (1945-1947). Als die Franzosen Eschenburg wegen „Eigenmächtigkeiten“ entlassen hatten, wurde er oberster Beamter im Innenministerium (1947-1952), zunächst im Range eines Ministerialrates, dann als Staatsrat (ab 1951). Die dominierende Gestalt auf der Tübinger Bühne war in dieser Zeit der Staatsrechtler und SPD-Politiker Carlo Schmid, zunächst als von den Franzosen eingesetzter Präsident des Staatssekretariats, dann – als Wahlen der CDU eine eindeutige Mehrheit brachten – stellvertretender Staatspräsident. Hier in Tübingen hatte Eschenburg entscheidenden Anteil an der Gründung des neuen Südweststaates. Daß der Artikel 29 des neuen Grundgesetzes mit seinen Modalitäten eine Neugliederung des Bundesgebietes nur schwer möglich machen würde, lag auf der Hand, zumal die neuen Landesregierungen sich überall als Besitzstandswahrer etabliert hatten. Man kann den Artikel 29 durchaus als „Neugliederungs-Verhinderungs-Artikel“ bezeichnen. Im deutschen Südwesten war die Situation anders: Die Teilung Württembergs wie Badens wollte hier niemand, das kleine preußische Hohenzollern war seit der Liquidierung Preußens durch die Alliierten „herrenlos“ geworden – warum also nicht gleich eine großzügige Lösung? Die drei Regierungschefs, Leo Wohleb, (Süd-)Baden, Reinhold Maier, Württemberg-Baden und Gebhard Müller, (Süd-)Württemberg-Hohenzollern, hatten unterschiedliche Vorstellungen: Während Maier die große Südweststaats-Lösung anstrebte, wollte Wohleb die Wiederherstellung der alten Länder. Müller war in dieser Frage eher offen, mit einer Präferenz für die Südweststaats-Lösung. Den Status quo jedenfalls wollte keiner. So konnte Maier die drei Regierungschefs zur denkwürdigen, legendär gewordenen Konferenz auf den Hohenneuffen einladen (2. August 1948). Das wichtigste Ergebnis bestand in einer Kommission zur Vorbereitung eines Staatsvertrags zwischen den drei Ländern; Vorsitzender wurde Gebhard Müller, Eschenburg zuständiger Beamter. Mit der Südweststaats-Problematik war Eschenburg bereits familiär vertraut: Seine Schwiegermutter im schwäbischen Geradstetten stammte aus Hornberg im Schwarzwald, einer badischen Stadt mit württembergischer Vergangenheit, zudem nicht weit weg von der württembergischen Grenze. Die Verhandlungen gestalteten sich als schwierig, zumal die badische Regierung in Freiburg auf der Wiederherstellung des alten Landes Baden beharrte und alles tat, die Südweststaats-Gründung zu blockieren. Bis zuletzt war deshalb E. auf Leo Wohleb – gelinde ausgedrückt – nicht gut zu sprechen; er hat ihn auch immer wieder in seinen persönlichen Schwächen dargestellt. Ganz modern rief deshalb E. – als Beamter wohlgemerkt – mit dem Stuttgarter Staatsrat und Vertrauten Reinhold Maiers, Konrad Wittwer (bekannt als Buchhändler) einen Unterstützungsverein für die Bildung des Südweststaates ins Leben. Mehr noch: Anonym verfaßte er ein Pamphlet mit dem Titel: „Baden 1945-1951: Was nicht in der Zeitung steht“ (1951 erschienen). Als Norddeutscher verstand Eschenburg wohl als erster hier, daß ein beabsichtigter umfassender „Südweststaat“, der mehrere bislang selbständige Länder vereinigen sollte, in Hamburg und Bremen, in Schleswig-Holstein und Niedersachsen als ein unerwünschter Präzedenzfall verstanden werden könnte. Folglich mußte die Südweststaats-Gründung als Ausnahmefall deklariert und entsprechend politisch angegangen werden – mit einem Ausnahmeartikel (Art. 118 GG), den Eschenburg mit Hilfe des Mitglieds im Parlamentarischen Rat Fritz Eberhard (dem späteren Intendanten des Süddeutschen Rundfunks) und formal abgesichert durch den Staatspräsidenten von Württemberg-Hohenzollern, G. Müller, in das Grundgesetz bringen konnte. Eschenburg hatte diesen Artikel aus dem Stand heraus formuliert und statt des fehlenden Tisches die Tür benutzt, um mit dem Bleistift die Formulierung aufzuschreiben, die dann nahezu wörtlich in das Grundgesetz eingegangen ist. Oft genug hat er später das vor seinen Schülern demonstriert. Trotzdem wäre die Gründung eines Südweststaates beinahe noch gescheitert: am anhaltenden Widerstand Leo Wohlebs und an der Zurückhaltung Konrad Adenauers, der ganz einfach die CDU-Stimmen im Bundesrat unter den Bedingungen des Status quo und eines Südweststaates miteinander verglichen hatte – mit negativem Ergebnis. Die Gründung Baden-Württembergs 1952 erfolgte – entsprechend den Modalitäten von Art. 118 Grundgesetz – durch ein Bundesgesetz mit einer Volksabstimmung, die in drei der vier Stimmbezirke eine klare Mehrheit für den Südweststaat erbracht hatte. Bei einer getrennten Auszählung nach den – aktuell jedoch nicht existierenden – Vorkriegsländern hätte sie in Baden eine knappe Mehrheit für die Wiederherstellung des alten Landes erbracht. Das blieb als Geburtsfehler, der bis heute nicht völlig überwunden scheint. Reinhold Maier, der erste Ministerpräsident des neu gegründeten Bundeslandes Baden-Württemberg, und Eschenburg verstanden sich nicht, trotz gleicher Nähe zum politischen Liberalismus. Somit war klar, daß Eschenburg in der neuen Landesregierung in Stuttgart keine seinem Rang entsprechende Beschäftigung finden konnte. So machte man ihn, schon seit 1946 in Tübingen Lehrbeauftragter (ab 1949 als Honorarprofessor), an dieser Universität zum ersten Lehrstuhlinhaber eines neuen Faches, das zunächst Wissenschaftliche Politik benannt wurde. Die so begonnene dritte Karriere als Hochschullehrer begleitet Eschenburg mit einer umfangreichen publizistischen Tätigkeit. Nach der Zeit des „Handelns“ begann für Eschenburg die Zeit des „Wirkens“, auch über die Hochschule hinaus, in der deutschen Öffentlichkeit, in der Politik. Seine Aufnahme als Lehrstuhlinhaber des neuen Fachs wird nicht durchweg bei allen positiv ausgefallen sein, zumal es für viele Ordinarien – und nicht nur für sie – verdächtig nach „re-education“ roch, nach der von den Alliierten verordneten „Umerziehung“ des deutschen Volkes. Mancher mag auch in ihm den Ministerialbeamten gesehen haben, der mit 47 Jahren untergebracht werden mußte – und der zudem nicht einmal habilitiert war. Jedoch ist der Berufungsvorgang – wie die Akten zeigen – korrekt abgelaufen. Vor allem aber konnte sich Eschenburg sehr schnell Wertschätzung und Vertrauen seiner Kollegen erwerben, nicht zuletzt angesehener, liberaler Wissenschaftler wie des Historikers Hans Rothfels, des Altphilologen Wolfgang Schadewaldt, des Kulturphilosophen und Erziehungswissenschaftlers Eduard Spranger. Überdies war Eschenburg längst Bestandteil der Honoratiorengesellschaft in der kleinen Tübinger Welt. Eschenburg wurde drei Jahre später bereits Dekan, damals noch nicht ein Reih-um-Posten, sondern Ausdruck von Wertschätzung. Die Juristische Fakultät kooptierte ihn. Zweimal hintereinander war Eschenburg später Rektor der Universität (1961-1963), ein Amt, das er mit Autorität und Sachverstand nach Außen wie Innen wohl zu vertreten wußte. Als erfahrener Verwaltungsmann gewann er den Eindruck, daß angesichts der „Bildungsexplosion“ eine laienhafte Selbstverwaltung der Universitäten nicht mehr zeitgemäß und problemadäquat war. Von daher wirkte er als Befürworter einer Präsidialverfassung, die 1973 dann eingeführt wurde. Eschenburg als Rektor war es auch, der dem 40jährigen Walter Jens 1963 zumindest eine außerordentliche Professur verschaffte, nachdem dieser sich schon 1949 in Tübingen habilitiert hatte. Stolz war Eschenburg darauf, daß er Ernst Bloch nach dessen Emigration in die Bundesrepublik 1961 nach Tübingen geholt hat – trotz des Widerstands einer konservativen Professorenschaft gegen einen Marxisten aus der DDR. Das alles, obwohl Eschenburg weder mit den politischen Ansichten von Walter Jens noch mit denen von Bloch übereinstimmte. Eschenburgs Lehrveranstaltungen waren ausgesprochen lebendig, an praktischen Problemen orientiert, aktualitätsbezogen, ohne daß aber die systematische Einordnung gefehlt hätte. Was ihn von anderen Lehrenden so deutlich abhob, hat Gerhard Lehmbruch bei einer Gedächtnisfeier für Eschenburg Ende 2000 auf den Punkt gebracht: „Bei Eschenburg nahmen wir nicht so sehr an den Schritten der Forschung teil, sondern wurden gewissermaßen teilnehmende Beobachter von politischen Prozessen.“ Hart getroffen hat Eschenburg die studentische Protestbewegung von 1968, die er als Revolution begriff. Zwar war er – schon aus Altersgründen – kaum unmittelbar betroffen. Doch er sah darin die Gefahr, daß der Staat, den er mit geschaffen hatte und dem er sich auch emotional verbunden fühlte, zerstört werden könnte. Resigniert und grollend zog er sich zurück. Das schriftstellerische, politikwissenschaftliche Lebenswerk von Eschenburg ist beeindruckend. Alles, was er schrieb, war gesättigt mit politischer Erfahrung und keine Schreibtisch-Wissenschaft. Vor allem legte er Wert auf Verständlichkeit, im Vortrag wie im geschriebenen Werk. Hervorragend – durchaus im doppelten Wortsinn – sind seine Darstellung des politischen Systems der Bundesrepublik („Staat und Gesellschaft in der Bundesrepublik Deutschland“, erstmals 1955 erschienen), seine Arbeiten zur „Herrschaft der Verbände“ (im Titel von ihm bewußt mit Fragezeichen versehen; erschienen erstmals 1955), zur Parteifinanzierung und „Über Autorität“ (erschienen erstmals 1965). Seine Adressaten waren nicht zuletzt die Betroffenen: Wenn man politisch Einfluß haben will, muß man verstanden werden. Jegliche fachsprachliche Exklusivität war ihm von daher fremd, er feilte geradezu an seinen Sätzen. Als Autor hat Eschenburg jedoch einen entscheidenden Fehler gemacht: Zu spät hat er sein Memoiren-Werk begonnen. Der dicke Geschichtsband über die Anfänge der Bundesrepublik „Jahre der Besatzung 1945-1949“ war ihm dazwischen gekommen, erschienen 1983 in der monumentalen sechsbändigen Reihe „Geschichte der Bundesrepublik Deutschland“ (zu deren Herausgebern er auch gehörte). Danach fehlte ihm die Kraft für seine Memoiren. Der Verleger Jobst Wolf Siedler hatte sich als Notlösung gedacht, man könnte im protokollierten Gespräch die Erinnerungen festhalten. So traf man sich, zusammen mit Joachim Fest und Johannes Gross, gut vorbereitet in Hotels, aß gut, trank und rauchte viel und ließ das Tonband mitlaufen. Was Eschenburg als Manuskriptentwurf auf den Tisch bekam, gefiel ihm nicht. Jeder weiß, daß man anders redet als schreibt. Die Situation ist eine andere, Vieles gerät allzu pointiert, persönlich zugespitzt und auch großsprecherisch. Eschenburg fing an, sein Manuskript neu zu schreiben. Wer ihn besuchte, konnte immer feststellen, an welchem Kapitel er gerade arbeitete: Es gab den Gesprächsstoff ab. Man konnte auch erleben, wie sorgfältig Eschenburg recherchierte, er verließ sich, was Fakten und Deutungen anging, nie ausschließlich auf sein Gedächtnis und seine frühere Einschätzung. Leider hat er nicht mehr alles zuwege gebracht, so daß der zweite Band seiner Memoiren als Fragment erschienen ist, ediert und ergänzt von seinem Schüler, dem Journalisten Hermahn Rudolph. Auch in der politischen Bildung, die recht eigentlich die Antriebskraft seiner wissenschaftlichen Tätigkeit und seines publizistischen Engagements war, hat er sich ganz pragmatisch seine eigenen Vorstellungen zurechtgelegt – nicht zuletzt aus seinen Erfahrungen heraus. Er setzte auf den informierten Bürger, der in der Lage ist, mit Hilfe seines Verstandes seine Interessenslage zu analysieren und – bei Bedarf- sich politisch einzubringen: „... ein so kompliziertes Gebilde wie die föderalistische Demokratie kann nur vom Verstand erfaßt, muß regelrecht gelernt werden.“, und er fährt fort: „Der mündige Bürger fällt nicht vom Himmel. Politische Bewegungen des Gemüts, ob positiv oder negativ, dürfen nicht unterschätzt werden. Sie sind in der praktischen Politik, vor allem bei Wahlen, ein wichtiger Faktor, der einkalkuliert werden muß. Aber sie verhelfen nicht zur Mündigkeit.“ (Erinnerungen I, 179). Seine didaktischen Vorstellungen, die er in seinen Lehrveranstaltungen vorexerzierte, gingen vom konkreten Fall, vom Konflikt aus, der vor dem Hintergrund der bestehenden demokratischen Spielregeln zu analysieren und zu beurteilen sei. Im Grunde hat Eschenburg die „Fallmethode“ von Hermann Giesecke, die dieser für die politische Bildung an Hand der „Spiegel-Affäre“ entwickelt hat (1965), schon vorweggenommen. In der politischen Bildung hat er sich selbstverständlich auch direkt betätigt: durch Gründung des „Büros für Heimatdienst“ als nachgeordneter Behörde „seines“ Innenministeriums in Tübingen, durch Mitwirkung bei der Ausgestaltung des neuen Faches „Gemeinschaftskunde“, dessen ersten Lehrplan er zusammen mit seinem Freiburger Fachkollegen Arnold Bergstraesser verfaßte. Der Landeszentrale für polische Bildung Baden-Württemberg blieb er genau so eng verbunden wie deren Vorgängerorganisation unter dem Namen „Arbeitsgemeinschaft Der Bürger im Staat“. Eschenburgs publizistische Tätigkeit war letztlich die Fortsetzung seiner Tätigkeit für die politische Bildung mit anderen Mitteln. Folgenreich blieb seine Begegnung mit der Herausgeberin der liberalen Wochenzeitung „Die Zeit“, Marion Gräfin Dönhoff. Sie gewann ihn 1957 als ständigen Autor. Möglicherweise ist von dieser über Jahrzehnte praktizierten journalistischen Tätigkeit seine größte Wirkung ausgegangen. Auch andere Medien haben sich bis zuletzt immer wieder an ihn gewandt, wenn es darum ging, Sachverhalte aufzuklären und zu kommentieren. Parteipolitisch hat sich Eschenburg nicht engagiert. Vertreter aller drei wichtigen Parteien haben sich um ihn bemüht, ihm auch – seinen Aussagen nach – ein Mandat angeboten. Er hielt sich raus – und war gerade derswegen um so einflußreicher. Man konnte ihn nicht einfach als Mann der jeweiligen Gegenseite abtun. Dafür konnte man sich, ohne sich verdächtig zu machen, seinen Rat holen. Das haben viele der führenden deutschen Politiker und Staatsmänner in der Tat getan; alle sahen in ihm einen interessanten Gesprächspartner. Zudem wurde er in viele Regierungskommissionen berufen: zu den Themen Wahlsystem, Parteiengesetz, Reform des auswärtigen Dienstes, Arbeit der Nachrichten-Dienste, Guillaume-Untersuchungsausschuß, auswärtige Kulturpolitik. Wohl nur ein einziges Mal trat er aus der parteipolitischen Zurückhaltung heraus, als er sich für die neue Ostpolitik der sozial-liberalen Koalition Brandt-Scheel engagierte, wohl wissend, daß es auch innerhalb der oppositionellen CDU viele Befürworter gab. So startete er eine Wählerinitiative zugunsten der F.D.P. bei der Landtagswahl 1972 in Baden-Württemberg, aus taktischen Überlegungen heraus: Zur Unterstützung der sozial-liberalen Koalition im Bundesrat wäre eine Regierungsbeteiligung der F.D.P in Baden-Württemberg hilfreich gewesen. Eschenburg absolvierte nur wenige Auftritte für die Wählerinitiative. Sie waren eher der Auftritt eines Professors im Kollegstil, mit honoriger und andächtiger Zuhörerschaft, als eine politische Auseinandersetzung. Wissenschaftler bilden „Schulen“, um ihren Denk- und Forschungsansatz zu perpetuieren. Die Bedeutung solcher Schulen-Bildung, deren wissenschaftliche wie u.U. auch politische Folgewirkungen sind bislang kaum untersucht worden. Eschenburg jedenfalls hat wenig getan, eine eigene Schule zu gründen. Sein Ansatz war wohl auch zu wenig in sich geschlossen. Zwar konnte man jederzeit auf seine Hilfe rechnen – aber nur wenn man sich bei ihm meldete. So sind vergleichsweise wenige „Eschenburg-Schüler“ auf Lehrstühlen untergekommen. Bezeichnend ist der Fall Ekkehard Krippendorf (Bologna), der bei Eschenburg studiert hatte, dann nach Berlin gegangen war, dort aber mit seiner Habilitation an der Freien Universität Schwierigkeiten hatte – aus politischen Gründen. Eschenburg konnte ihn in Tübingen – trotz dessen ausgesprochener Nähe zur 68er Bewegung – habilitieren. Politische Einwände wies Eschenburg im Habilitationsverfahren schroff zurück: Es gehe hier darum, die wissenschaftliche Qualität der Habilitationsschrift von Krippendorf zu beurteilen, nicht dessen politische Ansichten. Eschenburg setzte sich durch. Das Studium der Politikwissenschaft eröffnet viele Berufswege. Die meisten der Absolventen gingen zu Zeiten von Eschenburg in den Schuldienst, als Gemeinschaftskundelehrer. Hier haben sie bis heute einen prägenden Einfluß über die Eschenburg-Zeit hinaus. Etliche seiner Schüler sind in die politische Bildung gegangen. Weitere sind bekannte Journalisten geworden. Auch in den staatlichen Bürokratien sind Schüler von Eschenburg anzutreffen, vom diplomatischen Dienst bis in Landesministerien. Zeitlebens hat Eschenburg engen Kontakt mit seinen Schülern gehalten. Ihre Verehrung tat ihm sichtlich gut. Er liebte den Diskurs mit ihnen. Sie kannten seine Vorliebe für guten, schweren Rotwein. Ohne Pfeife oder Zigarre ist er auch in der Erinnerung nicht vorstellbar. Zahlreiche Anekdoten dazu erfreuen seine Schüler, Freunde und Bekannten bis heute. Bekannt ist auch seine Fähigkeit, jederzeit und überall schlafen zu können, auch bei Vorträgen. Seine Umgebung hat er immer damit verblüfft, hinterher genau Bescheid zu wissen. Man sah darin einen Trick oder eine entsprechende Anpassungsfähigkeit an die jeweilige Situation. Inzwischen weiß man aus der Hirnforschung, daß es Menschen gibt, die bei abgeschaltetem Bewußtsein die anfallenden sinnlichen und abstrakten Informationen durchaus aufnehmen können. Seinen Arbeitsplatz an der Universität hat er geliebt. Auch wenn er krank war, noch im hohen Alter hat er sich im Zweifelsfall in „sein“ Institut geschleppt. Es wird auch weiterhin mit seinem Namen verbunden sein, wie Politikwissenschaft in Deutschland überhaupt. Tübingen ist klein, alles findet sich dicht beieinander. Selbst auf dem Friedhof liegt Eschenburg nur drei Schritte entfernt von Ernst Bloch begraben, zur letzten Ruhe geleitet 1999 von seinem Nachbarn Hans Küng als katholischem Geistlichen, Eschenburg, der norddeutsche Protestant, der als erster seit Jahrhunderten in seiner Familie nicht einmal kirchlich geheiratet hatte. Wie mit Walter Jens hatte Eschenburg auch mit Hans Küng ein freundschaftlich-nachbarschaftliches Verhältnis gepflegt, das von wechselseitiger Wertschätzung – wissenschaftlich wie auch menschlich – bestimmt war. Eschenburgs öffentlicher Rang wurde bei der Trauerfeier unterstrichen durch die Anwesenheit der Bundesministerin der Justiz Herta Däubler-Gmelin, des Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg Erwin Teufel und zweier seiner Landesminister. |
|---|---|
| Quellen: | Nachlaß Eschenburg UA Tübingen; persönliche Gespräche mit Susanne Eschenburg, Gerhard Lehmbruch, Siegfried Schiele und Rosemarie Wehling |
| Werke: | Bibliographie der Werke und Aufsätze von Eschenburg, hg. vom Institut für Politikwissenschaft, Tübingen 2000 (http://www.uni-tuebingen.de/pol/eschenburg_bibliographie.htm) http://www.uni-tuebingen.de/ub/elib/tobias.htm) (Auswahl:) Die improvisierte Demokratie, 1951; Der Beamte in Partei und Parlament, 1952; Herrschaft der Verbände?, 1955; Staat und Gesellschaft in Deutschland, 1956; Über Autorität, 1965; Jahre der Besatzung 1945-1949 (Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, Bd. 1), 1983; Also hören Sie mal zu: Geschichte und Geschichten 1904-1933, 1995; Letzten Endes meine ich doch: Erinnerungen 1933-1999, 2000 |
| Nachweis: | Bildnachweise: Diverse Pressearchive |
Literatur + Links
| Literatur: | Ebd. Kap. Festschriften und Symposien zu Theodor Eschenburg |
|---|







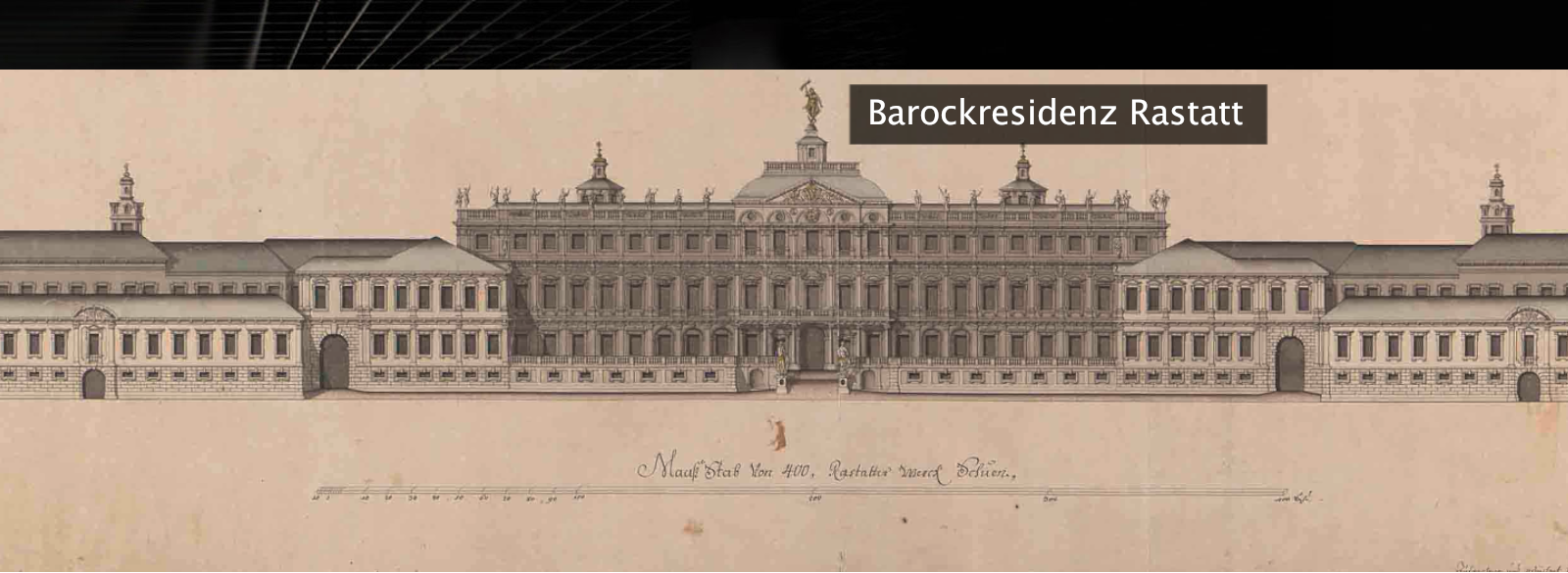



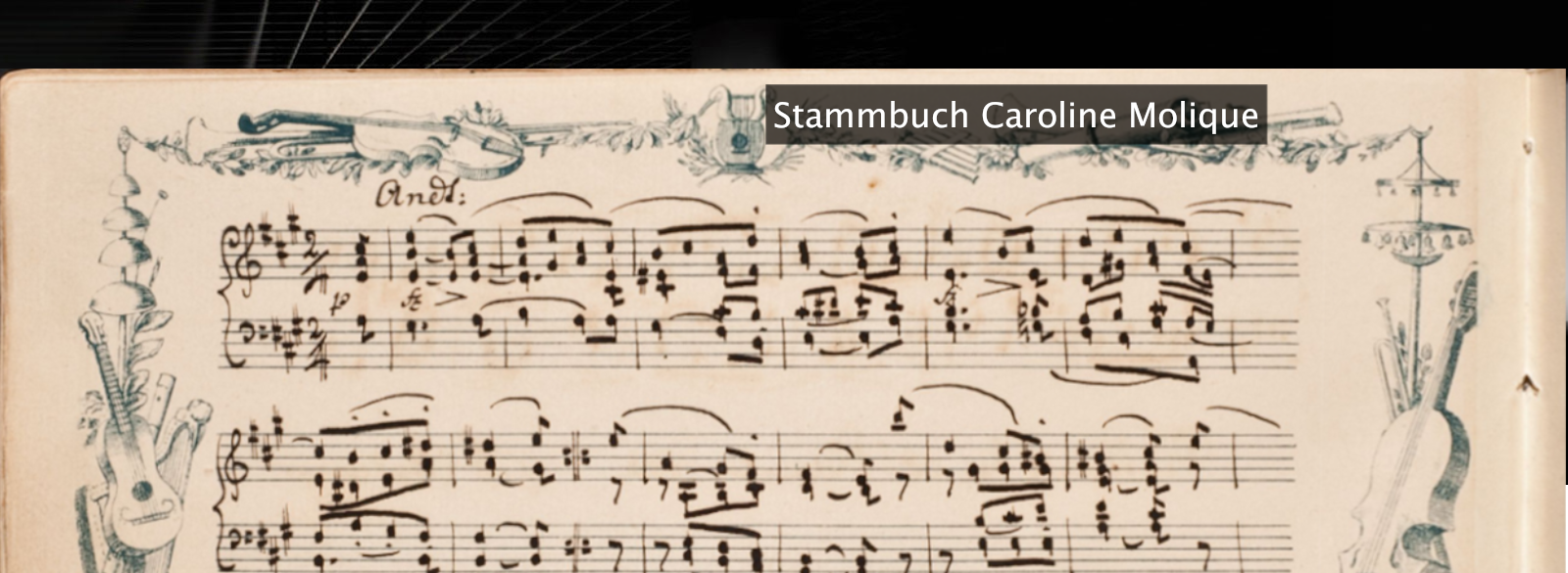



























 leobw
leobw