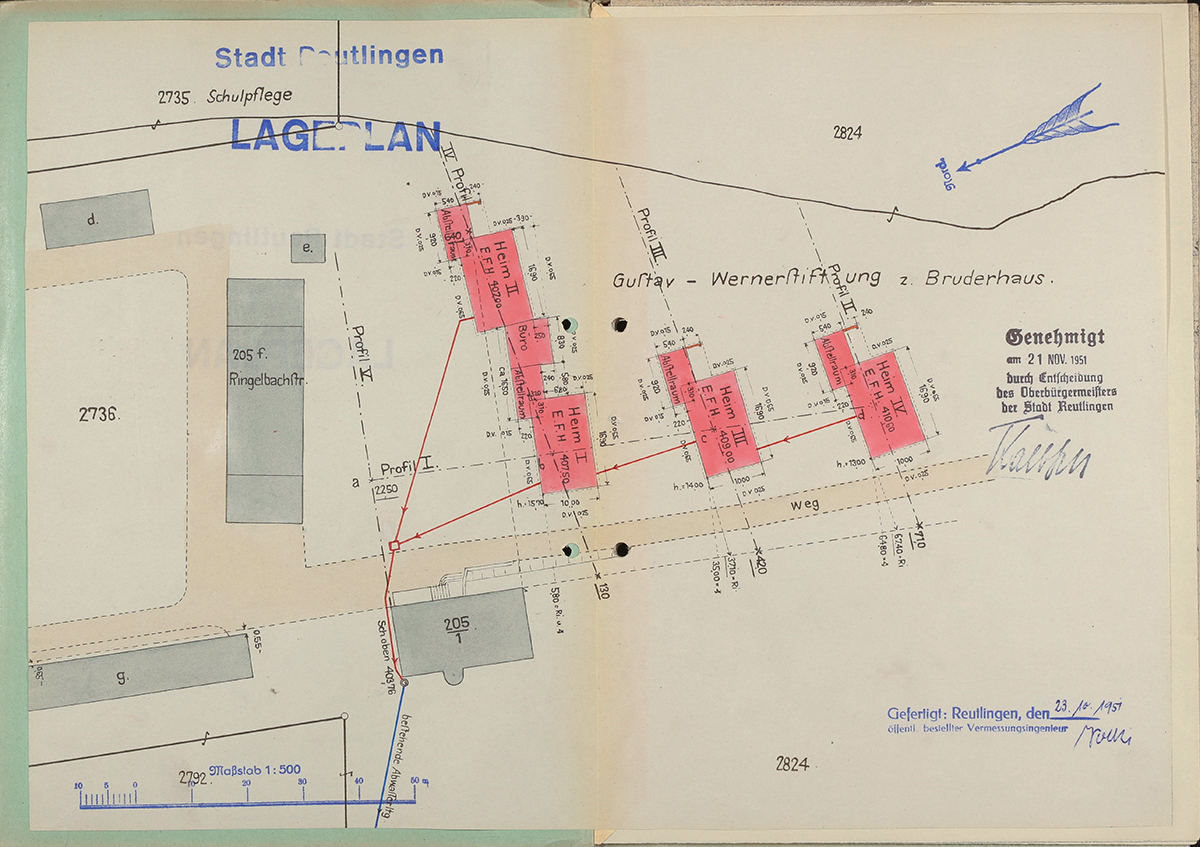Junge Patienten, die nicht in Schubladen passen. Die Kinder- und Jugendpsychiatrie in Tübingen
von Julia Klebitz
![Kinder- und Jugendpsychiatrie Tübingen [Quelle: Julia Klebitz] Kinder- und Jugendpsychiatrie Tübingen [Quelle: Julia Klebitz]](/documents/10157/19373997/kjp15.jpg/1ce456e9-9300-4d6f-91ba-855b92332da4?t=1648116726186)
Vor 100 Jahren öffnete in einer ehemaligen Fabrikantenvilla in Tübingen die erste kinderpsychiatrische Abteilung einer Universitätsklinik in Deutschland. Schon damals ging es darum, die Kinder in ihrem Alltag zu beobachten. Ein Gemeinschaftsraum bildete das Zentrum der Klinik. Dort gab es Platz für gemeinsames Essen, Spiel und Unterricht. Die räumliche Einteilung der Stationen ist noch heute ähnlich. Vieles aber hat sich seither geändert. Vor allem eines: Der Respekt vor dem Patienten.
„Komm da raus“, ruft Dr. Gottfried Maria Barth. Sein Blick ist unter die roten Kinosessel in seinem Büro gerichtet. Tina öffnet die Augen, räkelt sich kurz. Dann läuft die Hündin zu ihrem Herrchen. „Sie ist kein ausgebildeter Therapiehund“, sagt der Kinder- und Jugendpsychiater. „Sie wirkt trotzdem Wunder.“ Die Kinder haben keine Angst vor ihr. Gegenüber Menschen sind sie oft zurückhaltend. „Der Hund beruhigt sie“, erklärt Barth, der stellvertretende Leiter der Kinder- und Jugendpsychiatrie.
Mit Tina im Schlepptau geht er die dunkelbraunen Holzstufen im ehemaligen Direktorenhaus nach unten. Das Wartezimmer ist an diesem Spätnachmittag schon leer. Seit über 40 Jahren ist in dem alten Backsteinhaus die Ambulanz untergebracht. „Das Büro des Ärztlichen Direktors Prof. Tobias Renner war früher das Kinderzimmer der Klinikleitung“, erzählt Barth. Noch in den 1970er Jahren war es selbstverständlich, dass der Direktor der Psychiatrie auch an seinem Arbeitsplatz wohnt und lebt. 1977 haben Ärzte und Patientinnen und Patienten die Klinik an ihrem heutigen Standort in der Osianderstraße bezogen.
Die ersten Patientinnen und Patienten lebten in einer Fabrikantenvilla
Die erste Kinder- und Jugendpsychiatrie in Tübingen stand an anderer Stelle. Die ersten jungen Patientinnen und Patienten der Klinik wurden in einer ehemaligen Fabrikantenvilla behandelt – an der Ecke Frondsberg/Calwerstraße. Vor 100 Jahren, am 1. Juli 1920, eröffnete dort die erste kinderpsychiatrische Abteilung einer Universitätsklinik in Deutschland. Zuvor wurden psychisch kranke Kinder- und Jugendliche in Tübingen im Hauptgebäude der Psychiatrie behandelt. „Einige Monate lang gab es dort“, so erzählt Barth, „schon zwei Zimmer als vorläufige Kinderabteilung“. Etwa 80 Kinder wurden in diesem Provisorium therapiert. In der neuen Klinik, einem freistehenden Haus mit Garten, gab es dann ausreichend Platz. Von zehn Krankenzimmern und 30 Betten schreibt der erste Leiter, Dr. Werner Villinger in einem Aufsatz. Es geht schon damals hauptsächlich um die Beobachtung der Kinder im Alltag. Es gibt Zeiten für Unterricht, Spiel, gemeinsames Essen. Die Raumeinteilung – ein großer zentraler Wohnbereich in der Mitte – ist schon damals ähnlich wie in der heutigen Klinik in der Osianderstraße.
Der Einwegspiegel ist verschwunden
Vor deren Hauptgebäude mit den gelben Fensterrahmen stehen Gottfried Maria Barth und Hund Tina mittlerweile. Barth übergibt den Hund einer Kollegin, für Tina geht es in eine Therapiestunde einer Autisten-Gruppe, Barth geht zurück in sein Büro im Backsteinhaus. Mehrmals war er an diesem Tag schon auf den drei Stationen der Klinik unterwegs, hat sich unter anderem um eine magersüchtige Patientin gekümmert. Jetzt bekommt er Besuch von der Ärztin Ulrike Sünkel. Sie arbeitet in der Neurologischen Klinik, trifft sich regelmäßig mit Barth zum Austausch. Aus privatem Interesse befasst sie sich auch mit der Geschichte der Universitätsklinik und der Kinder- und Jugendpsychiatrie. „Vieles hat sich verändert in den vergangenen Jahren“, sagt sie. Das Beobachten spiele noch immer eine wichtige Rolle. „Auch, wenn es keine Einwegspiegel mehr gibt, durch die die Patienten beobachtet werden“. „Seit etwa fünf Jahren erst gibt es in der Kinder- und Jugendpsychiatrie eine Akutstation“ erzählt Sünkel. Bis zu drei Patientinnen und Patienten würden dort heute in einer Nacht eingeliefert. „Früher gab es laut Berichten vielleicht ein oder zwei nächtliche Aufnahmen im Monat“. Dem stimmt Barth zu. „In den letzten Jahren sind die Krisenfälle explodiert“, sagt der Psychiater. Seit 26 Jahren arbeitet er in der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Viele der Jugendlichen, die als Notfall kommen, dächten an Selbsttötung oder seien hochgradig aggressiv. „Es kommt vor, dass ein Achtjähriger von der Polizei in Handschellen gebracht wird“, sagt Barth. Die größte Zunahme sieht er aber bei Depressionen. „Die Hälfte der Patientinnen und Patienten auf der Akutstation sind depressiv“, sagt er. Die Depression sei häufig aber nicht alles, mit dem die Jugendlichen zu kämpfen hätten. „Oftmals ist beispielsweise eine Computersucht oder eine Essstörung Hintergrund oder kommt dazu“, sagt er.
„Diagnosen sind künstliche Einteilungen“
![Kinder- und Jugendpsychiatrie Tübingen [Quelle: Julia Klebitz] Kinder- und Jugendpsychiatrie Tübingen [Quelle: Julia Klebitz]](/documents/10157/19373997/kjp16.jpg/85d0151b-3d03-4a26-8421-c4e014cb3ecf?t=1648116727788)
„Jeder Patient ist einzigartig“. Diagnosen hält der Psychiater für künstliche Einteilungen, die es vor allem für die Abrechnung mit den Krankenkassen braucht. Für die Behandlung würden sie nur bedingt helfen. Auch Kollegin Sünkel hält nichts von „Checklistenpsychiatrie“, wie sie sagt. „Unsere Patienten passen nicht in Schubladen“, sind beide überzeugt. Dafür, dass die Patientenzahlen steigen, sehen sie zwei Gründe: Eine Depression oder auch Autismus wurden vor einigen Jahren noch sehr viel seltener diagnostiziert. Gleichzeitig sei der Druck vor allem auf Jugendliche aber auch schon auf Kinder und auch deren Eltern gestiegen. „Vieles ist in den vergangenen Jahren scheinbar liberaler geworden“, sagt Barth. Die Anforderungen seien allerdings gestiegen. „Wir haben heute weniger mit schlagenden Eltern zu tun, als mit orientierungslosen Eltern“, sagt Barth. Eltern seien oftmals mit ihren Kindern überfordert. Erfreulicherweise sinke aber die Hemmschwelle, sich in der Kinder- und Jugendpsychiatrie Hilfe zu holen, zunehmend. Auch der Kontakt zu einigen ehemaligen Patientinnen und Patienten sei so gut, dass diese manchmal auch von sich aus in der Klinik anrufen würden, wenn es ihnen wieder schlecht geht. „So können wir oft Schlimmeres verhindern“, ist Barths Erfahrung. Und dennoch: „Auch heute noch können wir nicht jedem helfen“. In sehr vielen Fällen gelingt die Hilfe jedoch und ist immer auch Hilfe zur Selbsthilfe.
Bei seinen Studierenden muss der Psychiater oft Überzeugungsarbeit leisten
„Vor zehn Jahren hätte ich noch gesagt: Autisten in einer Gruppe? Und das auch noch mit Hund? Das geht nicht.“, erzählt der Psychiater. Heute sieht er das anders. Wie so vieles. Fernbehandlung zum Beispiel. Vor ein paar Jahren noch war sie nicht erlaubt. Heute schwört Barth in bestimmten Fällen auf die Telemedizin. Er erzählt von einer jungen Patientin im Schwarzwald. Die Videokonferenzen mit dem Kinder- und Jugendpsychiater seien wichtig und gut für sie – vor allem dann, wenn der Weg nach Tübingen zu weit wäre. Aber auch so. Die Gespräche über Video seien anders. Oft intensiver. Ein klingelndes Telefon zum Beispiel lenke im Videogespräch viel mehr ab, als wenn sich Psychiater und Patientin oder Patient in einen Raum gegenübersitzen. Bei seinen Studierenden muss Barth, was neue Methoden betrifft, oft Überzeugungsarbeit leisten. „Das ist noch ungewohnt“, sagt er.
Respekt als oberstes Gebot
Eins aber sei immer entscheidend, egal, nach welcher Methode die Kinder und Jugendlichen therapiert und gefördert werden. „Respekt ist das oberste Gebot. Psychologisch pädagogisches Wissen ist immer in Gefahr Macht auszuüben, wie Beispiele nationalsozialistischer oder auch Übergriffe aus neuerer Zeit zeigen. Dem ist Respekt und Ernstnehmen der Patientinnen und Patienten, ihrer Familien entgegenzusetzen“. Auch dann, wenn Jugendliche um sich schlagen und es an Respekt von ihrer Seite mangelt. Man versuche heute mehr mit den Patientinnen und Patienten zu sprechen als über sie. Das Ziel von Barth und seinen Kollegen: Gemeinsam mit ihnen Ideen entwickeln für neue Verhaltensformen. Mit ihnen in die Zukunft blicken, nicht in die Vergangenheit. „Das Bild vom Psychiater, der passiv auf einem Stuhl sitzt und nur zuhört und, wenn der Patient nichts sagt, schweigt, ist überholt“. Diese Hilfe beim Blick in die Zukunft brauchen viele. Bis zu fünf Patientinnen und Patienten muss Barth heute in einem Zimmer unterbringen. Der Platz reicht kaum aus und oftmals müssen die Kinder- und Jugendlichen bis zu einem halben Jahr warten, bis sie eine ambulante Anschlusstherapie bekommen. „Bald bekommen wir einen Anbau, dann wird es besser“, sagt er. Kurz nach 18 Uhr hebt er Hündin Tina in seinen Fahrradanhänger und radelt davon, bevor er am nächsten Morgen wieder nach seinen Akutpatienten sehen geht.
Zitierhinweis: Julia Klebitz, Junge Patienten, die nicht in Schubladen passen. Die Kinder- und Jugendpsychiatrie in Tübingen, in: Heimkindheiten, URL: […], Stand: 21.02.2022.
Teilen
 leobw
leobw