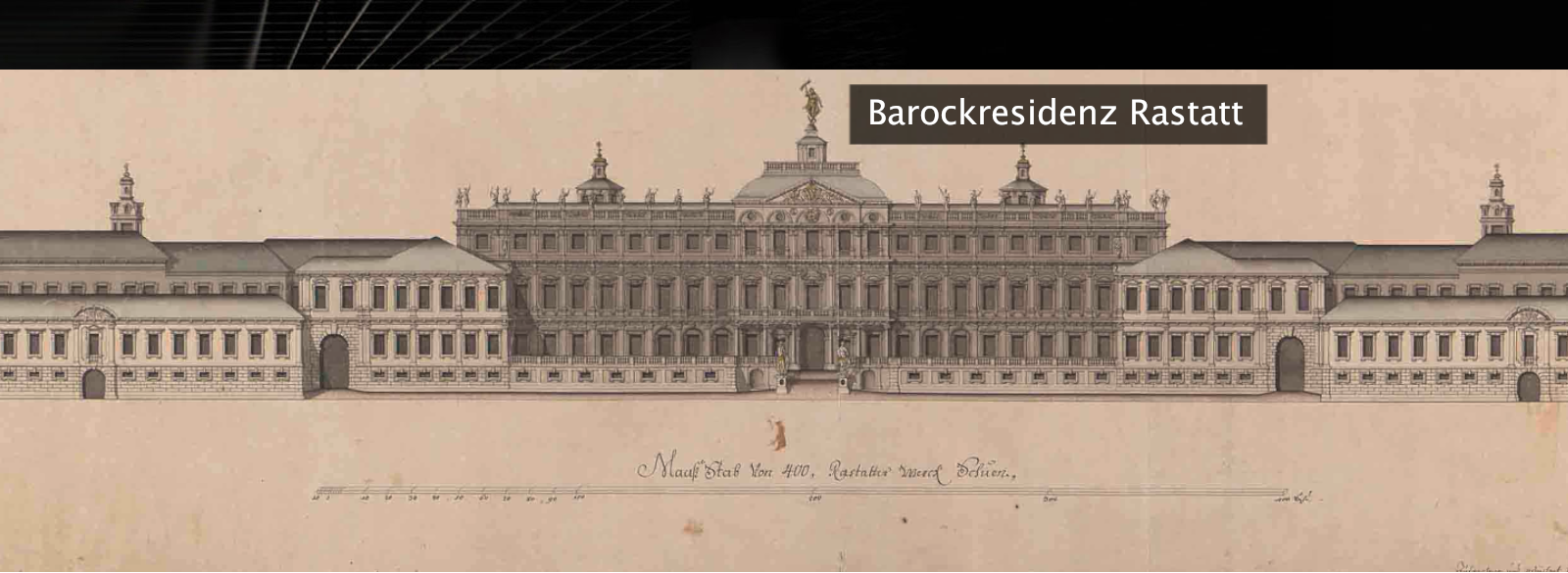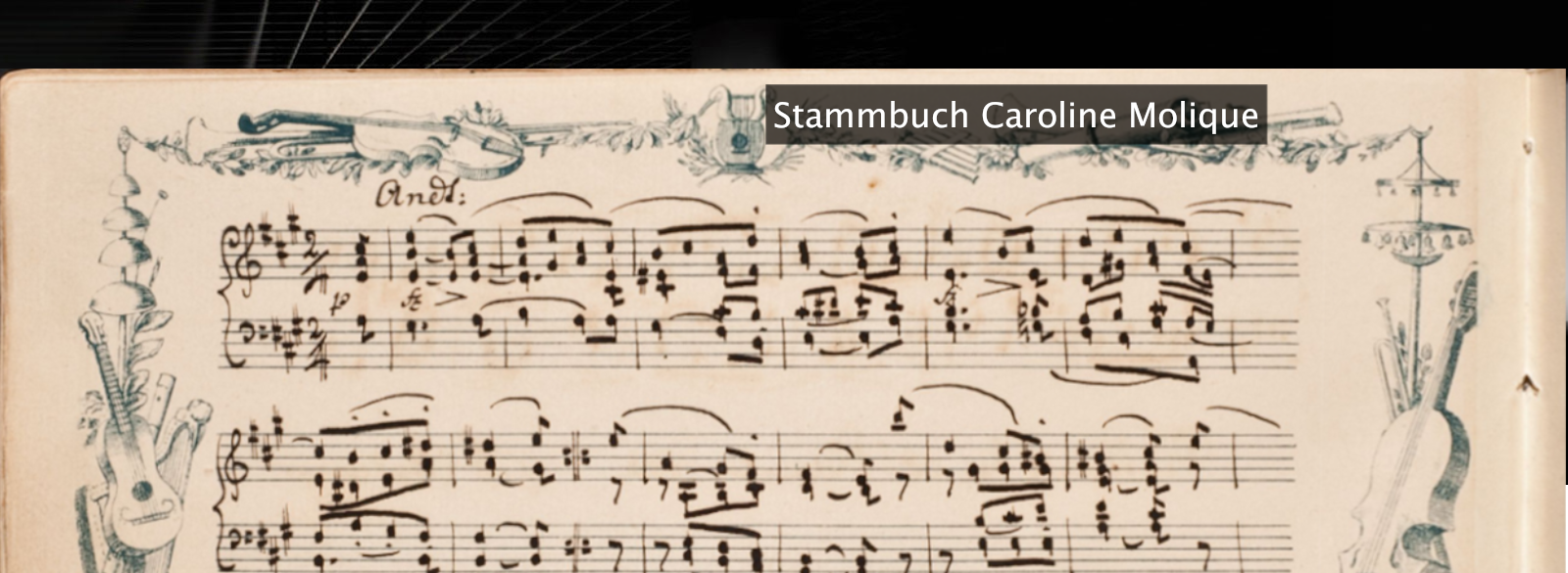Das Schwedengrab in Mühlheim an der Donau
Eine besondere Gedenkstätte
Das Schloss in Mühlheim an der Donau aus der Glasplattensammlung des Landesdenkmalamts. Die Grabstelle befindet sich links neben dem Fuß des Schlosshügels, Quelle: Landesarchiv BW, StAL EL 228 a II Nr 904
Mühlheim an der Donau ist ein kleines Städtchen im Landkreis Tuttlingen. Der Ort hatte sich bis zum 14. Jh. unter der Herrschaft der Zollern zu einem Wirtschafts- und Verwaltungszentrum mit eigenem Territorium entwickelt. Ab dem 15. Jh. residierten die Herren von Enzberg am Ort, der nun im Windschatten von Tuttlingen lag. Im Dreißigjährigen Krieg litten die Stadt und die gesamte Region. Besonders schlimm wurde es ab 1629. Durchziehende kaiserliche Truppen lagerten während des ganzen Jahres in und um das Städtchen und mussten verpflegt werden. Als im Juni 1632 die ersten Schweden nach Mühlheim kamen, flohen die Einwohner. Schweden war 1630 in den Krieg eingetreten und drang ab 1631 immer weiter nach Süddeutschland vor. Währenddessen wurde der Krieg immer brutaler. Gewalttaten, Plünderungen und Zerstörung eskalierten, in Mühlheim wie anderswo. Doch auch die scheinbar unangreifbaren Schweden blieben nicht verschont. Im Februar des folgenden Jahres kam es durch kaiserliche Reiterei zu einem Blutbad, dem rund 500 schwedische Soldaten zum Opfer fielen. Etwa 300 fanden in Mühlheim den Tod, 200 Geflüchtete wurden wenige Kilometer entfernt bei Nendingen niedergemetzelt, dazu französische Verbündete in Fridingen. Für die Toten von Mühlheim entstand ein Massengrab unweit des Donauufers. Rund ein halbes Jahr später, im August 1633, siegte die mächtige kaiserliche Reiterei bei neuerlichen Kampfhandlungen in der Nähe von Nendingen. Die wenigen verbliebenen Einwohner Mühlheims streiften herum, hungerten und wurden Opfer von Seuchen.
Nach der Schlacht bei Nördlingen 1634 zog sich die schwedische Armee aus Süddeutschland zurück. Das Ende für die französische Armee kam 1643 mit der Niederlage in der Schlacht bei Tuttlingen. 1649, kurz nach dem Ende des Dreißigjährigen Krieges, entstand die Wallfahrt zur Kirche Maria Hilf auf dem nahen Welschenberg. Der Ort erholte sich allmählich. Mitte des 18. Jh. ließen die Herren von Enzberg anstelle der alten Burg ein Schloss errichten.
Das „Schwedengrab“ an der Donau, das seit 1933 eine Kupferplatte kennzeichnet, wurde 2007 neu gestaltet, mit Informationstafeln ausgestattet und ist heute eine überregional bekannte Gedenkstätte. Das sehenswerte Mühlheim in der Naturregion Obere Donau wird gerne von Touristen besucht, auch aus Schweden.
Mehr zum Dreißigjährigen Krieg, seinem Verlauf, wichtigen Personen und Ereignissen, finden Sie im gleichnamigen Themenmodul auf LEO-BW.
Mehr Infos zum Schwedengrab gibt’s beim Heimatverein Mühlheim (externer Link).
Der „König von England“ oder ein steinernes Bilderbuch der Stadtgeschichte
Das Städtische Lapidarium in Stuttgart
Garten der Villa Ostertag-Siegle um 1909, Quelle: Wikimedia commons, gemeinfrei (externer Link)
Im Zuge der Industrialisierung des 19. Jh. wuchsen die Städte. Gegen Ende des Jahrhunderts wollten viele heraus aus den alten, stickigen und engen Zentren. Gartenstädte entstanden, auch für die weniger Wohlhabenden. An den Hängen der Residenzstadt Stuttgart wurden Panoramastraßen angelegt. Wer es sich leisten konnte, ließ hier eine Villa erbauen. Eine davon ist das Palais Ostertag-Siegle in der Mörikestraße, das in den 1880er Jahren entstand. Im angrenzenden Gelände ließ der Unternehmer einen prächtigen Terrassengarten im Renaissance-Stil anlegen, der heute neben seiner römischen Antikensammlung das Städtische Lapidarium beherbergt. Die Villa war ursprünglich ein Geschenk von Gustav Siegle an seine Tochter Margarete und den Schwiegersohn Karl Ostertag. Ostertag, Mitbegründer der Badischen Anilin- & Soda-Fabrik, wurde 1909 geadelt und führte seitdem den Namen Karl von Ostertag-Siegle.
Das erste Städtische Lapidarium Stuttgarts befand sich im Kreuzgang der Hospitalkirche. Im Zuge des Baubooms und der Altstadtsanierung um das neue Stuttgarter Rathaus herum waren um die Jahrhundertwende viele der alten Häuser abgerissen worden. Einige historisch bedeutsame Bauteile wurden aufbewahrt und im Kreuzgang aufgestellt. Im Zweiten Weltkrieg fiel das Lapidarium zusammen mit Kreuzgang und Kirche den Bombenangriffen zum Opfer. Einige Überreste konnten geborgen werden und kamen zusammen mit weiteren Trümmerfunden und ausgelagerten Objekten in das Anwesen Ostertag-Siegle, das die Stadt 1950 erworben hatte. Im selben Jahr wurde das neue Lapidarium eröffnet. 1961 starb Gustav Wais, der erste Leiter der Einrichtung und Kurator für die steinernen Bauzeugen in Stuttgart. Danach schien sich niemand mehr für das „alte Zeugs“ zu interessieren. Erst in den 1990er Jahren begann sich ein Freundeskreis um die Anlage zu kümmern, die mit städtischer Unterstützung in Stand gesetzt und wieder zugänglich gemacht wurde.
Heute ist das Lapidarium, das zum Museum „StadtPalais“ gehört, ein „steinernes Bilderbuch“ der Stadtgeschichte und eine grüne Oase mit Terrassen, Brunnenhof sowie alten Bäumen. Zu den gezeigten Stücken gehören Fragmente vom Wohnhaus des Baumeisters Heinrich Schickhardt (1596-1602), Plastiken bedeutender Bildhauer wie Heinrich Dannecker (1758-1841) aber auch Relikte von Gebäuden, die Eingang in literarische Werke fanden, wie das Portal des Gasthofs „König von England“ aus Wilhelm Hauffs „Die Bettlerin vom Pont des Arts“. Im Garten finden auch Musikveranstaltungen, Lesungen und Theateraufführungen statt. Das Städtische Lapidarium ist nicht zu verwechseln mit dem Römischen Lapidarium des Landesmuseums Württemberg.
Das Städtische Lapidarium hat von Mai bis September geöffnet, der Eintritt zum Garten ist frei, weitere Infos auf der Homepage von StadtPalais - Museum für Stuttgart (externer Link)
Eine bebilderte Zusammenstellung der gezeigten Stücke gibt es auf Wikipedia (externer Link)
Lageplan von Baden-Baden mit Gebäuden und Gärten in der Umgebung der Pfarrkirche um 1900. Eingezeichnet sind u.a. das Gast- und Badhaus „Roter Löwe“ [links in der Mitte] sowie weitere Badeanlagen. Quelle: Landesarchiv BW, GLAK H Baden-Baden 14 https://t1p.de/7dlvw
Die Geschichte des jüdischen Lebens in Baden-Baden ist eine wechselvolle. Zwar wurden Angehörige jüdischen Glaubens schon in der Frühen Neuzeit gerne in der Kurstadt gesehen, doch tat sich die Obrigkeit schwer mit einem dauerhaften Niederlassungsrecht. Schon im 17. Jh. kamen jüdische Badegäste in den Ort. Die beiden damals existierenden Gasthäuser „Zum Trompeter“ und „Zum Greifvogel“ hatten das Wasserrecht an einer der Hauptquellen. Die Namen gingen auf die Quelle über, die gleichzeitig als „Judenbrühbronnen“ oder „Judenquelle“ bezeichnet wurde. Es ist also wahrscheinlich, dass die Einrichtungen der jüdischen Klientel zur Verfügung standen. Ab 1740 wurde das Wasser in den „Hirschen“ und den „Roten Löwen“ geleitet, wo die jüdischen Gäste logierten. Die Quelle zählte zu den ergiebigsten in Baden-Baden. Im 19. Jh. wurde sie mit weiteren in einem Hauptstollen als „Friedrichsquelle“ zusammengefasst. Bis über die Mitte des 19. Jh. waren nur wenige bis gar keine jüdischen Personen dauerhaft in der Stadt ansässig. Einige wenige Familien, die vermutlich die Badhäuser bewirtschafteten, sind zu Beginn des 18. Jh. nachweisbar. Eine ähnliche Situation erscheint rund 100 Jahre später mit zwischenzeitlichen Unterbrechungen. Immerhin wurden jüdische Gäste in dem 1809 neu erstellten Armenbad der Stadt zugelassen. Doch die Gemeinde gehörte auch zu denjenigen, die die Beschränkungen im 19. Jh. am längsten aufrechterhielten. Selbst einem Baron Rothschild wurde das Bürgerrecht verweigert. Die Familie Rothschild besaß von 1842 bis 1854 ein Adels-Palais in Baden-Baden, einstmals Sitz der schwedischen Königin Friederike, heute „Kulturhaus LA8“.
Eine Aufhebung der Restriktionen erfolgte erst 1862. Im Anschluss daran entstanden zahlreiche jüdische Betriebe und Geschäfte. Drei der Hotels – Tannäuser Hof, Hirsch-Herz und Odenheimer - boten eine koschere Küche an. 1891 wurde die jüdische Gemeinde offiziell gegründet. 1913 öffnete das von einem Mainzer Verein getragene und durch Mathilde von Rothschild unterstützte Erholungsheim für jüdische Frauen und Mädchen. Im Konversations- und heutigen Kurhaus war ein jüdisches Leseinstitut eingerichtet, in dem das gebildete Publikum zusammenkam. Zu den bekannten jüdischen Persönlichkeiten zählten die Schauspielerin Charlotte Eggarter, der Schauspieler und Theaterintendant Gerhard Fischer sowie der städtische Musikdirektor Ernst Mehlich.
Diese erfreulichen Entwicklungen fanden noch vor 1933 ein Ende, als Baden-Baden zum Schauplatz nationalsozialistischer Hetze wurde. Organisierte Pöbeleien und Belästigungen zielten auf die Vertreibung von Ortsansässigen und die Abschreckung jüdischer Gäste, sodass eine Bürgerversammlung, die um den Ruf der internationalen Kurstadt fürchtete, sich öffentlich dagegen wandte. Die schwieriger werdende Situation ab 1937 erreichte mit den in Baden-Baden von SS-Angehörigen durchgeführten Aktionen während der Pogrome im November 1938 einen ersten traurigen Höhepunkt. Neben der Inbrandsetzung der Synagoge waren die Gemeindemitglieder grausamen Demütigungen und Internierungen betroffen. Von den in Baden-Baden verblieben Personen jüdischen Glaubens wurden 1940 über 100 nach Gurs deportiert, weitere bei nachfolgenden Transporten verschleppt.
Ausführliche Informationen zur jüdischen Gemeinde in Baden-Baden finden Sie im Portal Alemannia Judaica (externer Link).
„Die Macht des Gesanges“
Lieder für Demokratie und Miteinander
Ansicht gegen Plochingen und die Alb um 1820 , Grafik von Carl Dörr, Quelle: Württembergische Landesbibliothek, Graphische Sammlung Schef.qt.6154
Am 4. Juni 1827 fand in Plochingen das erste schwäbische Liederfest statt, eine große Veranstaltung mit rund zweihundert Sängern und vielen weiteren Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Als der Esslinger Lehrer und Historiker Karl Pfaff (1795-1866) seine berühmte, politisch ausgerichtete Festrede hielt, kam das zwar unerwartet aber nicht überraschend. Längst hatten sich Forderungen nach Mitbestimmung und Verbesserung der sozialen Verhältnisse erhoben, die nicht mehr zu unterdrücken waren. Eine Schlüsselstellung kam dabei den Vereinen zu, die den Rahmen boten um sich auszutauschen und zu organisieren. Gesangsvereine eröffneten außerdem die Möglichkeit, Inhalte über Liedtexte zu vermitteln, ein Vorteil gegenüber den ebenfalls politisch aktiven Turn- und Schützenvereinen.
Singen war „in“ und schon der allseits verehrte Schiller hatte 1796 in seinem Gedicht „Die Macht des Gesanges“ verkündet: „Wer kann des Sängers Zauber lösen/Wer seinen Tönen widerstehn?“ In seiner Rede ging Karl Pfaff zwar nicht direkt darauf ein, doch nahm er Passagen aus anderen Liedern und Gedichten auf, die die Anwesenden aufhorchen ließen. Zitate aus Gustav Schwabs „Der Gesang“ bildeten den Kern seiner Botschaft: „Niedersinken vor des Gesanges Macht der Stände lächerliche Schranken/Eine Familie, vereint in Eintracht, Freude und Begeisterung bildet der ganze Chor.“ Deutlicher ging es fast nicht.
Auch andere Schriftsteller wie Wilhelm Hauff hatten sich gesellschaftskritisch geäußert. Wesentliche Impulse für das südwestdeutsche Sangeswesen kamen jedoch aus der Schweiz. Der Zürcher Musikpädagoge, Komponist und Verleger Hans Georg Nägeli hatte 1824 den „Appenzellischen Sängerverein“ ins Leben gerufen. Eine Vortragsreise durch Süddeutschland im selben Jahr führte ihn auch nach Stuttgart. Hier trafen seine Ideen auf langgehegte Wünsche und Hoffnungen, denn Nägelis Vorstellungen reichten weit über die bloße Freude am Singen hinaus. Der Chorgesang, erst recht mit den entsprechenden Liedtexten, sollte verbindend, geradezu völkerverbindend und „demokratisch“ wirken. Gleich 1824 wurde der erste „Liederkranz“ in Stuttgart gegründet, der seinen Namen in Abgrenzung zur norddeutschen „Liedertafel“ erhielt. Als weiterer zentraler Begriff der Bewegung wirkte sich die „Eintracht“ namensgebend bei den Vereinsgründungen aus.
Und noch ein Ereignis der Musik- und Chorgeschichte fiel ins Jahr 1824. Am 7. Mai, rund einen Monat vor den Ereignissen in Plochingen, war in Wien die berühmte 9. Sinfonie Ludwig van Beethovens uraufgeführt worden. Mit der Vertonung von Schillers „Ode an die Freude“, dargebracht von Solo- und Chorsängern im vierten Satz, hatte der Komponist die erste bekannte Sinfoniekantate geschaffen.
„Freude, schöner Götterfunken, Tochter aus Elysium,
Wir betreten feuertrunken, Himmlische, dein Heiligtum!
Deine Zauber binden wieder Was die Mode streng geteilt;
Alle Menschen werden Brüder, Wo dein sanfter Flügel weilt.“
Zu den zahlreichen, nach 1824 entstandenen Gesangsvereinen gehört der Liederkranz in Esslingen, der 1827 von Karl Pfaff mitbegründet wurde. Das erste Schwäbische Liederfest in Plochingen leitete viele weitere ein, auf denen Pfaff für Einheit, Recht und Freiheit in ganz Deutschland sprach. Er war 1831 Mitbegründer der Esslinger Bürgergesellschaft und federführend bei der Entstehung des Schwäbischen Sängerbunds, zu dem sich die südwestdeutschen Gesangsvereine 1849 zusammenschlossen.
Zum Weiterlesen:
- Einen ausführlichen Beitrag zu Karl Pfaff und der Sängerbewegung finden Sie im Portal „Demokratie geschichten“ (Teil I und II - externe Links)
- Eindrücke von Liederfesten, wie dem an Pfingsten 1840 in Heilbronn, wurden gerne bildlich festgehalten
Protest des Kleinaspacher Pfarr- und Schultheißenamts gegen die Annahme und Beeidigung der geschworenen Frau Hedwig Hornung als Hebamme im Kleinaspacher Ämtlein bei [Groß-]Bottwar, Quelle: Landesarchiv BW, HStAS A 213 Bü 4669
Ein elementarer Bestandteil des Frauenlebens waren schon immer Geburten. Mit der Tätigkeit als Hebamme hatten viele Frauen bereits vor der Einführung von klassischen Frauenberufen Gelegenheit, eine Bezahlung und sogar eine Ausbildung zu bekommen - unabhängig von den Ehemännern und auch für solche aus einfacheren Verhältnissen. Hinweise dazu finden sich in kirchlichen Unterlagen. Die Pfarrgemeinden führten nicht nur Familienregister, sondern erfüllten auch soziale Aufgaben und legten dies schriftlich nieder.
Aus Kirchenbüchern, Kirchenkonventsprotokollen und Visitationsberichten sind Einzelheiten in verschiedenem Umfang zu entnehmen. Dass das Amt, denn um ein solches handelte es sich, wichtig war, belegt die Tatsache, dass es in den Kirchenbüchern zusätzlich zum Namen der Hebamme aufgeführt ist. Dazu kam die Amtszeit, die sich über mehrere Jahrzehnte erstrecken konnte und die Anzahl der begleiteten Geburten. Neben diesen eher sachlichen Angaben sind in Kirchenkonventsprotokollen und Visitationsberichten Details über Organisation und Praxis enthalten. So standen der Hebammen eines oder mehrere „Geschworene Weiber“ zur Seite. Diese wurden von den Frauen in gebärfähigem Alter gewählt und sorgten dafür, dass die Hebamme nicht die alleinige Verantwortung aber auch nicht die alleinige Gewalt innehatte. Der Stellenwert der Hebammen lässt sich überdies daran erkennen, dass ihre Bezahlung, auch Wartgeld genannt, geregelt war. Dafür musste die Hebamme nicht nur für die Geburt, sondern auch in der Zeit unmittelbar davor und während der Pflege im Wochenbett zur Verfügung stehen. Ferner, da ebenfalls schriftlich festgehalten, wurde auf die Ausbildung geachtet. Es gab den traditionellen Weg des Lernens und Hospitierens bei einer erfahrenen Frau. Erst danach durfte die neue Hebamme selbst anpacken. Zuweilen wird die Unterweisung durch männliches Personal, etwa Chirurgen, empfohlen. Auch wurde von kirchlicher Seite vermerkt, wenn die Hebamme eine amtliche Prüfung vor einem Arzt abgelegt oder ein ärztliches Auswahlverfahren stattgefunden hatte. Überliefert sind Eide, die die Hebamme auf Gott oder die Bibel schwören musste. Zu ihren Pflichten gehörte es, die Geburten, auch uneheliche und totgeborene Kinder, zu melden. Verschiedentlich finden sich Hinweise, dass die Hebammen angehalten wurden Aberglauben zu unterbinden. Daneben wurden in den kirchlichen Unterlagen Konflikte oder fehlerhafte Verhältnisse vermerkt. Dazu zählen die mangelnde Akzeptanz bestimmter Hebammen und die Suche nach Ersatz oder das Nichtvorhandensein des geforderten einwandfreien Leumunds, etwa in Form einer alkoholabhängigen Hebamme. Mit zunehmender staatlicher Organisation wuchs die Professionalisierung des Hebammenwesens, zu der die Einführung zentraler Hebammenschulen und, wie im Königreich Württemberg, eine Dienstanweisung gehörte.
Tipps zum Weiterlesen mit interessanten Quellendarstellungen:
Der obige Text entstand auf Grundlage des Beitrags von Uwe Heizmann „hat empfangen 1500 Kinder“ – Quellen zu Hebammen aus dem 17. bis 19. Jahrhundert im Blog Württembergische Kirchengeschichte online (externer Link).
Ergänzende Informationen stammen aus "Storch, Storch, du guter, bring mir au en Bruder! Storch, Storch, du bester, bring mir au a Schwester!" von Judith Maier, online verfügbar in den Heimatkundlichen Blättern für den Kreis Biberach, 20 (1997) Nr. 1, S. 30 – 38 (PDF, externer Link)
Affichage des résultats 51 - 55 parmi 606.
LEO-BW-Blog

Herzlich willkommen auf dem LEO-BW-Blog! Sie finden hier aktuelle Beiträge zu landeskundlichen Themen sowie Infos und Neuigkeiten rund um das Portalangebot. Wir freuen uns auf Ihre Kommentare zu den einzelnen Posts.
Über den folgenden Link können Sie neue Blog-Beiträge als RSS-Feed abonnieren: