Kindererholungsheim Stieg bei Albbruck im Schwarzwald
von Harald Bauer

Ich bin Jahrgang 1949. Meine Eltern wohnten zunächst in Hockenheim. Meine Mutter und ihre Eltern kamen von dort. Als zweijähriges Kind musste ich erstmals an einem Leistenbruch operiert werden. 1952 sind meine Eltern nach Mannheim umgezogen, wo mein Vater als Vertreter einer Arzneimittelgroßhandlung gearbeitet hat. Meine Mutter, gelernte Drogistin, hatte ihren Beruf aufgegeben und hat in Heimarbeitet meinem Vater zugearbeitet. Ich bin ein Einzelkind geblieben.
In Mannheim ging es mit meinem Kranksein weiter. Jährliche Mittelohrentzündungen und auch Mittelohrvereiterungen haben meine Kindheit begleitet. 1954, mit vier Jahren, wurde bei mir eine Lungentuberkulose festgestellt. Erst hoffte der Kinderarzt, dass mir gute Luft helfen könnte. So verbrachten meine Mutter und ich im tiefsten Winter vierzehn Tage im Schwarzwald in der Nähe von Triberg. Geholfen hat das nicht. Die Tuberkulose wurde nach und nach heftiger. In der Folge wurde ich ins Kinderkrankenhaus nach Mannheim in die Grenadierstraße gegenüber der amerikanischen Kaserne eingeliefert.
Dort kam ich auf die Isolierstation. Die Zimmer waren mit maximal drei Kindern belegt. Es waren Glaskästen, die durch Glasscheiben auch zum Gang hin abgetrennt waren. Durch die Glasscheiben am Gang konnten Besucher – zum Beispiel meine Eltern – mich sehen und auch sprechen. Hier verbrachte ich fünf Monate. Zwischenzeitlich hatte ich mir dort noch die Masern und die Windpocken eingefangen. Wie die Tage vergingen, das weiß ich nicht mehr. Ich weiß nur noch, wie die Schwestern sagten, wo sollen wir bei dem Kleinen noch eine Spritze setzen? Mein Hintern war durch die täglichen drei Spritzen grün und gelb. Am schlimmsten war wohl die Langeweile und die Sehnsucht, nach Hause zu kommen.
Nach fünf Monaten wurde ich aus dem Kinderkrankenhaus entlassen. Ich war aber nur einen Tag zuhause, denn ich musste gleich meine Kur antreten; das war vermutlich im Juli 1954. Meine Eltern hatten mir schon neue Kleider gekauft. Sie und meine Hockenheimer Oma brachten mich zum Abholplatz. Dort nahm uns ein neuer VW-Bus auf. Mein drei Jahre älterer Freund Dieter, den ich aus dem Krankenhaus kannte, war auch dabei. Ab ging es nach Stieg bei St. Blasien (Albbruck) im Schwarzwald, in die schlimmste Zeit meiner Kindheit.
An die Fahrt kann ich mich nicht erinnern, aber an den VW-Bus. Autos haben mich schon früh fasziniert. Es war ein VW-Bus, den man später Samba-Bus nannte, also das Modell mit Oberlichtern. Es war ein Komfortreisebus im Kleinformat. Bei der Ankunft wurden alle neuen Kinder von den Nonnen, die uns erwartet hatten, in ein großes Dachzimmer, das Taubenschlag genannt wurde, gebracht. Wir saßen alle auf dem Boden. Als Begrüßungsessen gab es grünen Wackelpeter mit aufgespritzter Sahnegarnitur. Wackelpeter – Gelatinepudding – kannte ich nicht. Und grün war mir unheimlich. Heute weiß ich, dass grün Waldmeistergeschmack bedeutet. Ich habe das Zeug nicht gegessen, fand aber schnell einen begeisterten Abnehmer. Die meisten anderen Kinder kamen aus dem Ruhrpott oder „Pott“, wie sie sagten. Ich habe mein Spielzeug, einen Jaguar mit Federwerk zum Aufziehen, den mir die mit meinen Eltern befreundeten Nachbarn geschenkt hatten, ausgepackt. Sofort stürzten sich alle Kinder darauf. Am Ende war er kaputt.
Danach wurden wir in den Hof hinters Haus geschickt. Dort war ein großer Stapel mit Anfeuerholz gelagert. Dazwischen fand ich ein hölzernes Zigarrenkästchen. Meinen Fund fanden auch andere Kinder toll, also gab es Streit um das Ding. Ich weiß nur, dass ich letztlich noch den Deckel in der Hand hielt. Mit diesem wollte ich eine Wespe vertreiben, die im Holzhaufen auf mich lauerte. Die Wespe war aber schneller und hat mich gestochen. Ich habe geschrien und geweint, wurde dann von der Aufsicht habenden Nonne auf das Zimmer geführt – einen großen Schlafsaal, in dem ich dann allein in dem mir zugewiesen Bett meiner Pein überlassen wurde. Mein erster Tag verlief somit alles andere als glücklich. Und ich war gleich als „schnegisches“ Kind - badischer Ausdruck für ein verwöhntes Kind, das nicht alles isst, abgestempelt, wo doch der Pudding so gut war. Ich hatte mir bei den Nonnen einen Namen gemacht.
Wie schlimm die Zeit – fast ein halbes Jahr – für mich wurde, will ich an einigen Beispielen zeigen. Mein Freund Dieter wurde sofort, da er älter war als ich, in eine andere Gruppe gesteckt. Beziehungsweise wurden bestehende Freundschaften von Anfang an unterbunden. Ich habe ihn nur noch einmal – so meine Erinnerung – im Speisesaal aus der Ferne gesehen.
Stieg, so hieß das Kinderheim. Es war ein ehemaliger Bauernhof; dort gab es meines Wissens damals noch einen Kuhstall. Stieg war, wie meine Eltern meinten, ein Ortsteil von St. Blasien. Heute gehört es zu Albbruck.
Einmal die Woche, so hieß es, aber meines Erachtens waren die Intervalle länger, mussten wir unter die Dusche. Ich erinnere mich an einen grauen, fensterlosen Raum im Keller. Ein mir unheimlicher Ort. Alles andere als eine Wellness-Oase. Das Geduscht- und Abgewaschen werden von einer Nonne war schon schlimm genug. Am Ende der Reinigungsprozedur wurden unsere Haare mit Essigwasser gespült (gegen Läuse, wie ich heute vermute). Natürlich kam Essigwasser in die Augen und ich war halbblind. In diesem Zustand wurden wir in die große Küche geschickt und mussten dort warme Milch trinken. Zur Erholung!? Ich habe nie gerne warme Milch getrunken. Aber da musste man in dem Heim durch. Problem: Es gab in der Küche für die Milchtrinker und -trinkerinnen nur eine Sitzgelegenheit, einen Küchenhocker. Den konnte ich aber nie erobern, da ich zu den Kleinen gehörte. Einmal erspähte ich eine Tür, die von der Küche aus in einen mir nicht bekannten Raum führte. Es war – wie ich mir später zusammenreimte – das Refektorium der Nonnen. Ich öffnete die Tür zu dem dunklen Raum und ergriff den großen, geschnitzten Stuhl am Kopfende der Tafel. Ich habe ihn ganz stolz zu den Milchtrinkern gezerrt und meine Position auf dem Thron eingenommen. Nicht lange, bis eine Nonne kam… Ich wurde so verhauen, dass ich blutete. Das Ende habe ich in Bewusstlosigkeit nicht mehr mitbekommen.
Kinder suchen die Schuld bei sich. So habe ich es zumindest durch meine Erziehung empfunden. Und sicher hätten auch meine Eltern das so gesehen: Wenn Du so böse warst, dann geschieht es dir recht. Also habe ich schuldbewusst geschwiegen zu diesen und noch anderen Vorkommnissen, die vielleicht noch unglaubwürdiger anmuten.
Meine Eltern haben mir immer erzählt, wie nett die Schwestern gewesen seien – insbesondere Maria-Ursula, genannt: Ma-Ursula. Die mich so gerne gehabt hätte. Meine Eltern haben mich nur einmal dort besucht. Sie hatten damals schon einen VW. Sie hätten, so erzählten sie mir, den lieben Schwestern Kaffee und weiteres mitgebracht.
Gesundwerden hieß in den 50er-Jahren zunehmen, Pausbacken bekommen, stämmig werden. Das Rezept dafür: Essen, essen und nochmal essen. Der Gesundungsprozess wurde in Pfund und in Kilogramm gemessen. Wir Kinder wurden gestopft wie Mastgänse. Oft konnte oder wollte ich nicht essen. Wie jedes Kind hatte ich meine Vorlieben und Abneigungen. Als ich wieder einmal vor meinem vollen Teller mit Grießbrei und Dörrobst saß, nahm mich die diensthabende Nonne Ma-Ursula auf den Schoß, klemmte meine Beine in ihre Beinschere und fütterte mich zwangsweise, bis ich alles wieder erbrach. Nicht genug. Sie fütterte mich danach mit dem Erbrochenen, bis der Teller leer war. Die anderen Kinder hatten in der Zwischenzeit den Speisesaal längst verlassen. Ich wusste von dieser Prozedur bereits von anderen Kindern.
Aber dazu gab es noch eine Steigerung. Wenn man nicht essen wollte oder konnte, wurde einem von der „Medizin-Nonne“ der Magen ausgepumpt. Einige Kinder hatten mich davor gewarnt. Irgendwann war es aber soweit. Die Nonne wurde gerufen und ich wurde von ihr in den leeren Schlafsaal gebracht. Ich musste mich auf mein Bett setzen. Dann hat sie vor mir ein Tuch ausgebreitet und eine Nierenschale daraufgestellt. Sie öffnete zwangsweise meinen Mund und schob mir einen roten Gummischlauch in den Hals. Ich muss mich aber derart heftig gewehrt haben, dass sie die Prozedur nicht durchführen konnte. Aber allein der Versuch ließ mich zukünftig in Panik essen. Noch heute kann ich mich an den Geruch des Gummischlauchs erinnern.
Wenn ich nachdenke, dann waren es vielleicht die gleichen Menschen, die auch schon zwischen 1933 und 1945 in diesem Heim gearbeitet haben. Zu meiner Zeit schrieb man ja erst das Jahr 1954. Wer waren die Menschen, die seinerzeit das Kindererholungsheim in verantwortlicher Position führten?
Ich erinnere mich auch an die täglichen Liegekuren, wie sie genannt wurden. Frischluft atmen auf dem Balkon des Sanatoriums. Mit der guten Schwarzwaldluft ist seinerzeit die Kinderverschickung für uns Lungenkranke begründet worden. Auf einem Feldbett, in eine Wolldecke eingewickelt und damit wir nicht fortliefen und schön brav auf dem Rücken liegen blieben, wurden wir angeschnallt. Und wehe, es ist einem in der Liegezeit ein Malheur passiert. Schlafen konnte ich bei der Prozedur nie. Die Zeit wollte nicht vergehen. Alternativ zu den Liegekuren gab es Spaziergänge. Die gingen sehr diszipliniert vor sich. Wir mussten Zweierreihen bilden und dann ging es los. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich mich dafür immer mit dem gleichen Kind zusammengefunden hätte. Ich kann mich auch nicht erinnern, dass ich – im Gegensatz zum Krankenhaus – mit einem Kind Freundschaft geschlossen hätte. Die Spaziergänge waren für mich keine freudigen Ereignisse. Wir sind durch die Gegend geschlappt.
Damit die Eltern sahen, wie gut es uns angeblich ging, wurde hin und wieder ein Fotograf einbestellt. Wir wurden rausgeputzt, bekamen unser Spielzeug, das sonst weggesperrt war, und wurden als glückliche, lächelnde Kinder fotografiert – ein Abzug ging an die Eltern. Danach wurde die Sonntagskleidung wieder ausgezogen und das Spielzeug eingesammelt. Der Alltag mit all seinen Schikanen und Brutalitäten ging weiter. Meine Eltern hatten mir zu Weihnachten, oder war es zu meinem Geburtstag im November, ein Spielzeug-Flugzeug geschenkt. Es war ein Blechmodell der Boeing 377 Stratocruiser, die ich später einmal im Original bei einem Ausflug mit meinen Eltern auf dem Flughafen in Frankfurt gesehen habe. Es wurde mit anderen guten Spielsachen von anderen Kindern oben auf den Kachelofen gestellt. Spielen durfte man damit nicht. Ich habe nach der Kur das Spielzeug mit nach Hause nehmen dürfen.
Am Nikolaustag wurde vor dem großen Ereignis bis zur einbrechenden Dunkelheit ein Spaziergang gemacht. Dabei ging es auch rund ums Haus. Das Haus hatte von außen einen Kellerzugang. Wir alle wussten, dass die Älteren, wenn sie ungezogen waren, dort eingesperrt wurden. Man erzählte sich von Dunkelheit und Ratten, die dort umherlaufen würden. Mit großer Angst sind auch wir Kleinen an dem Eingang vorbeigelaufen, zumal wir ja nicht wussten, wie schlimm uns der Nikolaus ins Gebet nehmen würde.
Ich weiß nicht zu welcher Gelegenheit oder zu welchem Feiertag, aber irgendwann bekamen alle einen Rosenkranz geschenkt. Ich wusste nicht, was das ist. Ich hatte eine Spielkiste, in der einige alte, meist kaputte, kleine Spielzeugautos waren. Ob es meine Kiste war oder ob sie der Allgemeinheit gehörte, kann ich heute nicht mehr sagen. Jedenfalls habe ich mit der Kette des Rosenkranzes die Autos abgeschleppt. Das wurde natürlich von einer Nonne beobachtet und es setzte Ohrfeigen. Allerdings nicht so schlimm wie beim Milchtrinken nach dem Duschen.
An den Tag im Frühjahr, an dem mich meine Eltern abgeholt haben, kann ich mich noch erinnern. Mein Vater hatte das Schiebedach des VW-Käfers geöffnet. Ich sah den Himmel und in St. Blasien eine Heuerampel. Ich empfand den Tag als Befreiung. Meine Eltern kamen mir fremd vor. Wir mussten uns erst wieder aneinander gewöhnen. Sie haben bestimmt ein sehr eigenartiges Kind zurückbekommen.
In Mannheim angekommen, wurde ich in den nächsten Tagen neu eingekleidet. Es war ja alles zu klein geworden und sicher auch verschlissen. Rechnet man die Zeit, die ich im Krankenhaus und im Erholungsheim verbracht habe, zusammen, so war das fast ein Jahr. Schon wenige Monate nach der Rückkehr aus Stieg kam ich wieder ins Krankenhaus. Ich musste mich hintereinander drei Operationen unterziehen: Einer Leistenbruch-OP, einer Blinddarm-OP und der OP zur Behebung eines Magennetzhautrisses. Letztere, so sagten mir Ärzte später, könne von häufigem Erbrechen herrühren oder von Gewalteinwirkung.
Mit etwa sieben Jahren zeigte sich meine Lungen-Tuberkulose wieder in leichter Form. Ich musste viel ruhen und an die frische Luft gehen. Das hat wohl geholfen. Mit sieben Jahren, nach einer Impfung – so die Vermutung – habe ich eine Hirnhautentzündung bekommen. Da ich nicht bewegungsfähig war, tippte unser Hausarzt zunächst auf Kinderlähmung. Ich kam in das mir bekannte Kinderkrankenhaus, erneut vier Wochen. Diese Krankheit war sehr schmerzhaft. Danach kam ich in keine Kur.
Es gibt noch weitere Geschichten. Vergessen werde ich das alles nie. Es bleiben Bilder im Kopf, die ich für Sekunden abrufen kann. Ich habe alles nach bestem Wissen, nach bester Erinnerung und entsprechend den Bildern in meinem Kopf aufgeschrieben.
Zitierhinweis: Harald Bauer, Kindererholungsheim Stieg bei Albbruck im Schwarzwald, in: Heimkindheiten, URL: […], Stand: 21.02.2024.


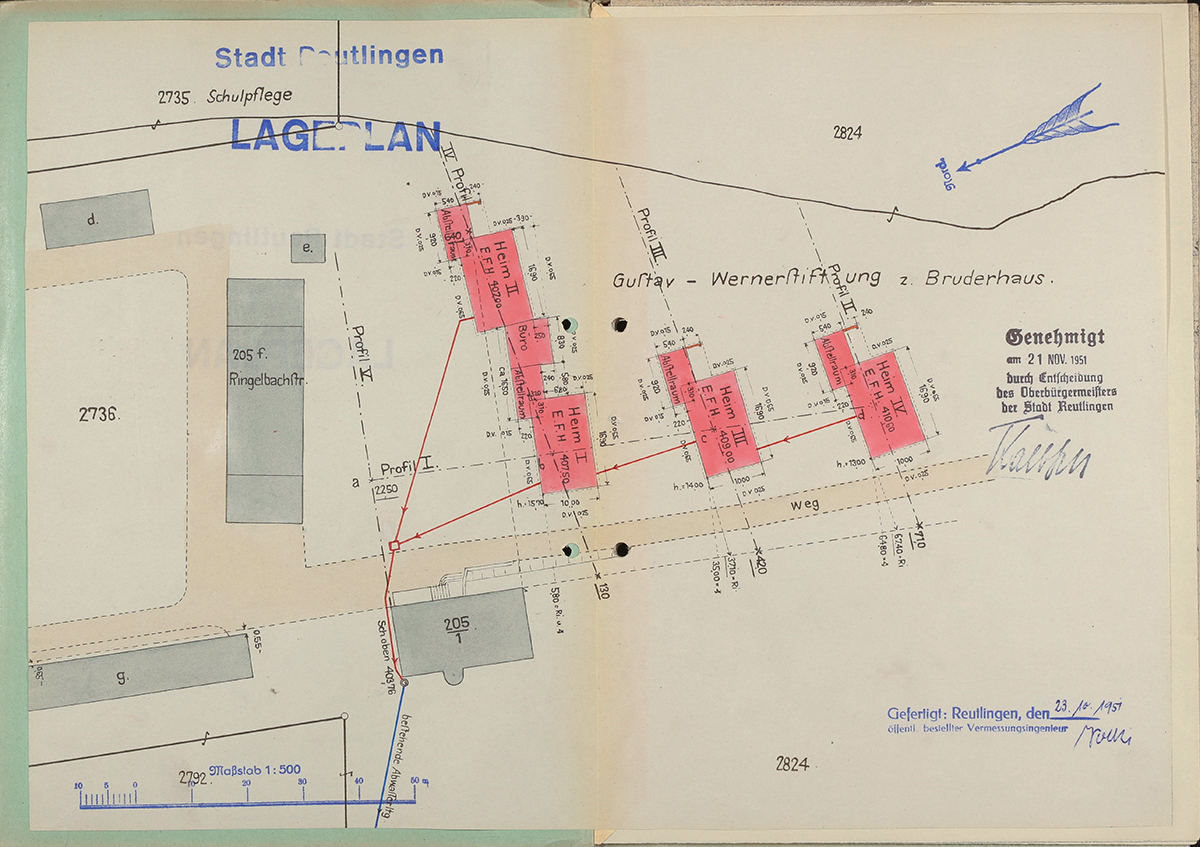



 leobw
leobw