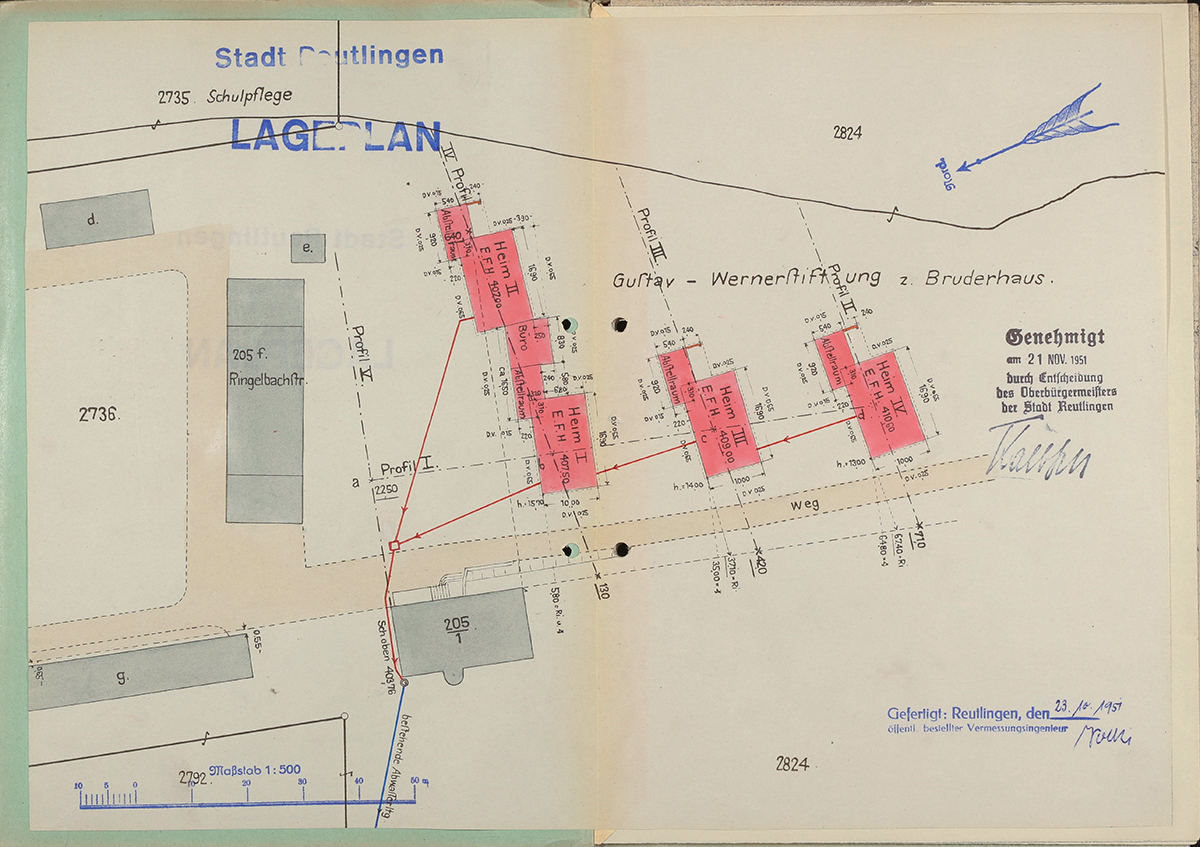Die Aufarbeitung aus Archivsicht – Einblicke und Grenzen
von Ewald Graf
![Hinter Aktendeckeln bzw. in Archivboxen der Einrichtungen von Jugendhilfe, Behindertenhilfe oder Psychiatrie verbergen sich oft bewegende Lebensschicksale – auch wenn hier oft nur wenige Dokumente aufbewahrt sind [Quelle: Archiv Stiftung St. Franziskus]. Zum Vergrößern bitte klicken. Hinter Aktendeckeln bzw. in Archivboxen der Einrichtungen von Jugendhilfe, Behindertenhilfe oder Psychiatrie verbergen sich oft bewegende Lebensschicksale – auch wenn hier oft nur wenige Dokumente aufbewahrt sind [Quelle: Archiv Stiftung St. Franziskus]. Zum Vergrößern bitte klicken.](/documents/10157/19373997/Akten+Ausgetretene+1958-80+2_vor.jpg/c6ce4341-479f-4178-8e39-2ef3d966ab33?t=1648455313357)
Der Beitrag der Archive zur Aufarbeitung der Heimkinderzeit mag je nach Umfang der Bestände begrenzt sein, ist aber wichtig und vor allem vielfältiger, als viele denken. Im Rückblick – nach 50 bis 70 Jahren – lässt sich die „Heimkinderzeit“ außer in persönlichen Erinnerungen oft nur noch durch die Unterlagen aus den Archiven untersuchen. Für viele ehemalige Heimkinder und ihre Angehörigen oder Vertrauenspersonen können sie eine konkrete Hilfe bedeuten.
Zunächst waren die Archive in starkem Maße gefragt, als es um die wissenschaftlichen Studien der letzten Jahre sowie die Gesprächs- und Entschädigungsangebote für die Betroffenen ging. Eine Bestätigung des Heimträgers oder seines Rechtsnachfolgers über den stationären Aufenthalt in einer Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe, Behindertenhilfe oder Psychiatrie zur fraglichen Zeit war Voraussetzung für Leistungen im Rahmen des Fonds Heimerziehung und bzw. der Stiftung Anerkennung und Hilfe – und vielfach die erste Hürde. Setzte es doch den Erhalt von Akten oder Schülerlisten voraus, was nicht immer der Fall ist. Aufbewahrung wiederum heißt noch nicht Aufarbeitung. Vor allem dort, wo es noch kein Archiv gab, mussten erst vorhandene Unterlagen gesucht und darin recherchiert werden – womöglich ohne Register und Namenslisten und damit auch mit einigem Zeitaufwand.
Das vom Landesarchiv erarbeitete „Heimverzeichnis“ dieser Jahrzehnte diente nicht nur der Antragstellung, sondern stellt auch einen Verdienst für die Forschung dar und zeigt auf, welche Lücken der Überlieferung in dieser Hinsicht bestanden und vermutlich immer noch nicht geschlossen sind.
Doch bei der Frage nach den nackten Daten des Aufenthalts bleiben die ehemaligen Heimkinder oder ihre Angehörigen meist nicht stehen. Sie wollen – je größer die eigenen Lücken der Erinnerung oder des Weitererzählten sind – mehr von „damals“ wissen und ihre persönliche Biographie aufarbeiten. Hier können Archive helfen und sollten darauf vorbereitet sein. In erster Linie natürlich mit den persönlichen Akten aus der Betreuung oder Behandlung. Als personenbezogene Unterlagen unterliegen sie zwar besonderen Schutzfristen. Archiv- wie Datenschutzgesetze geben Betroffenen jedoch ausdrücklich das Recht auf Auskunft oder Einsicht.
Doch was ist überhaupt in solchen Kinder- oder Schülerakten enthalten? Hier ist eine Warnung angebracht, um falsche Erwartungen zu vermeiden. Die „Zöglings“-Akten sind in den Einrichtungsverwaltungen entstanden und berichten meiner Erfahrung nach daher in der Regel kaum etwas vom Schul- und Internatsleben, also aus dem Alltag der Schülerinnen und Schüler. Sie beinhalten vor allem die Vorgänge, die sich in der Verwaltung niedergeschlagen haben: der Schriftwechsel mit Eltern und Behörden zu den Kosten des Heimaufenthalts, zur Aufnahme bzw. der anschließenden Unterbringung, ärztliche Untersuchungen und Berichte, teilweise auch psychologische Gutachten oder die Entwicklungsberichte der Schule, die an den Kostenträger oder die Nachfolgeeinrichtung gesandt wurden. Auch die Schulzeugnisse oder Ausbildungsverträge sind oft zu finden. Gibt es Abrechnungsbögen, sind dann noch z.B. die Abwesenheiten in Ferien, Krankheitszeiten oder Krankenhausaufenthalte aufgeführt, weil dies für die Berechnung der Kosten wichtig war.
![Die Schulzeit in der Heimkinderzeit war oft noch geprägt von Ordensschwestern – Blick in den Schulhof der Gehörlosen- und Schwerhörigenschule in Heiligenbronn bei Schramberg [Quelle: Klosterarchiv Heiligenbronn]. Aus rechtlichen Gründen wurden die Gesichtszüge der abgebildeten Personen anonymisiert. Zum Vergrößern bitte klicken. Die Schulzeit in der Heimkinderzeit war oft noch geprägt von Ordensschwestern – Blick in den Schulhof der Gehörlosen- und Schwerhörigenschule in Heiligenbronn bei Schramberg [Quelle: Klosterarchiv Heiligenbronn]. Aus rechtlichen Gründen wurden die Gesichtszüge der abgebildeten Personen anonymisiert. Zum Vergrößern bitte klicken.](/documents/10157/19519563/YY_Schulhof+H%C3%B6rgesch%C3%A4digtenschule+1960.jpg/a88d51e8-531b-45c4-bbdb-b7f85da183c0?t=1650958241171)
So lässt sich schon einiges über die Geschichte dieses ehemaligen Schülers oder dieser Schülerin herauslesen. Man erfährt, wie die Schule, Ärztinnen und Ärzte oder auch Eltern sie beurteilt haben. Man erfährt aber wenig über den Alltag und meist gar nichts aus Sicht der Kinder und Jugendlichen. Diese Erwartung darf man an die Kinderakten nicht haben. Dies gilt auch für die vielleicht erlebten Situationen von Gewalt- und Leid, die normalerweise nicht schriftlich festgehalten wurden oder eben nicht in die Akte gewandert sind. Dennoch lohnt sich der Blick in die Originalakten. In ihnen können Betroffene mehr über die eigene Familie und ihre Situation, über die Gründe der Aufnahme usw. erfahren – von überraschenden Fundstücken einmal ganz abgesehen. Neben den Archivunterlagen sind aufgrund der lückenhaften Überlieferung auch wissenschaftliche Studien und Selbstzeugnisse unverzichtbar für ein angemessenes Bild vom früheren Heimalltag.
„Nur wenn erfahrenes Leid und Unrecht wahrgenommen, gehört, ausgesprochen und anerkannt wird, besteht für die betroffenen Menschen die Möglichkeit, die notwendige Hilfe zu bekommen, die Verletzungen in ihrer Lebensgeschichte zu heilen und in ihr Leben zu integrieren“, schreiben Dr. Thorsten Hinz und Johannes Magin im Vorwort zur Studie „Heimkinderzeit“ unter Leitung von Annerose Siebert. In diesem Sinne bieten wir in unserer Einrichtung gemeinsam mit dem Kloster eine weitergehende Unterstützung mit persönlichen Gesprächen über diese Zeit an. Auch wenn die Gesprächspartnerinnen und -partner diese Zeit selbst nicht erlebt haben, lassen sich dabei bedrückende Erfahrungen an- und aussprechen und Erläuterungen zu den Zeitumständen geben. Hier ist außerdem Raum zur (selbst-) kritischen Stellungnahme der heute in der Einrichtung tätigen Personen, was für die Betroffenen oft wichtig ist.
Unterstützung durch oder mit dem Archiv kann noch weitere Formen annehmen, vor allem, wenn keine Kinderakten erhalten sind: beim Betrachten von Fotoalben (oder anderer Medien) wird der Geist der Zeit recht anschaulich, beim Besichtigen der alten Gebäude – wenn noch vorhanden – bzw. ihrer Nachfolgebauten und des Geländes werden Erinnerungen wach oder lässt sich auch Angehörigen ein Eindruck vermitteln. Im Gespräch mit anderen Ehemaligen oder anderen Personen, die diese Zeit selbst erlebt haben, kann vieles zur Sprache kommen. Die eigene Kinder- und Jugendzeit in allen ihren Facetten wird durch solche Angebote vielleicht wieder lebendiger und als wichtige Lebensepoche verständlicher.
Das Archiv kann dies in der Regel nicht alleine leisten, doch ganz wesentlich unterstützen. Diese Bemühungen zeigen Archivarinnen und Archivaren auch, worum es in der Grundlagenarbeit für solche Betreuungseinrichtungen geht: die Erinnerung an die Menschen in ihnen und ihre Schicksale zu bewahren. An ihnen wird immer Interesse sein.
Literatur
- Siebert, Annerose u.a., Heimkinderzeit. Eine Studie zur Situation von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen der katholischen Behindertenhilfe in Westdeutschland (1949-1975), Freiburg 2016.
Zum Autor: Ewald Graf leitet seit 2018 das Archiv der Stiftung St. Franziskus. Zuvor war er Leiter des Referats Kommunikation und Mitbegleiter einiger geschichtlicher Projekte und Publikationen der Stiftung.
Zitierhinweis: Ewald Graf, Die Aufarbeitung aus Archivsicht –Einblicke und Grenzen, in: Heimkindheiten, URL: […], Stand: 09.02.2022.
Teilen
 leobw
leobw