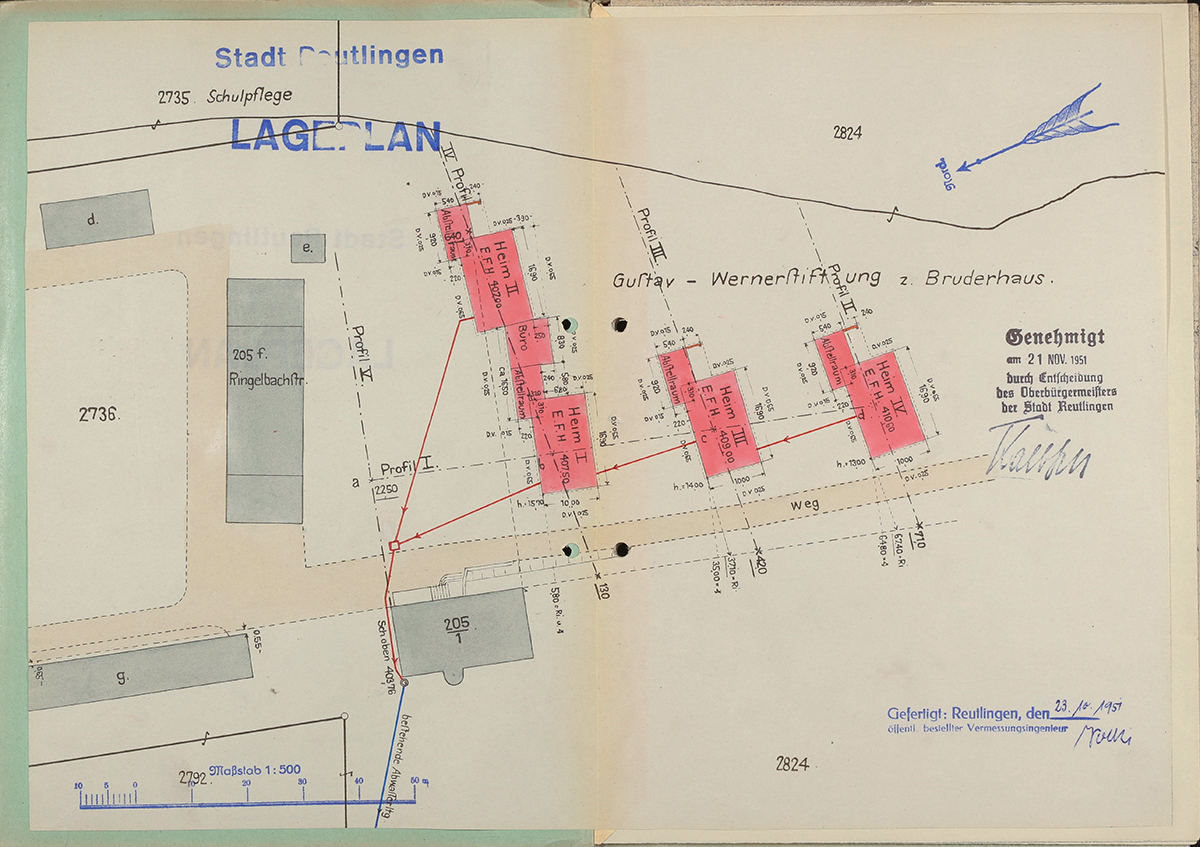Arbeit und Schule
von Nadine Seidu und Nora Wohlfarth
Viele Kinder besuchten die an die Heime angegliederten Schulen. Diese waren häufig auf dem Niveau von Sonder- oder Hauptschulen und ermöglichten keine höheren Schulabschlüsse. Eine individuelle Förderung fand nur selten statt. Dies hing auch mit der verbreiteten Vorstellung zusammen, Heimkinder seien naturgemäß unterdurchschnittlich lern- und leistungsfähig oder hätten eine höhere Qualifizierung nicht verdient. Ausbildungen wurden häufig nach Bedarf des Arbeitsmarktes vor Ort und nicht nach den Wünschen oder Fähigkeiten der Jugendlichen ausgewählt.
Dies war noch stärker ausgeprägt in Einrichtungen der Behindertenhilfe. Zum einen waren Kinder mit Behinderungen oft über sehr lange Zeiträume ohne medizinische Notwendigkeit in Kliniken untergebracht. Diese waren für eine pädagogische Betreuung, geschweige denn individuelle Förderung der Kinder, nicht ausgestattet. Zum einen verhinderten vage Diagnosen und damit verbundene negative Prognosen die angemessene Betreuung von Kindern, die damals als bildungsunfähig klassifiziert wurden. Diesen Kindern wurden damit Chancen verbaut. In vielen Einrichtungen der Behindertenhilfe wurden nicht einmal grundlegende Kulturtechniken vermittelt, wie das Essen mit Messer und Gabel.
Schulen mit Internaten für Kinder mit Sinnesbehinderungen, also gehörlose oder blinde Kinder, dienten der zielgerichteten Beschulung dieser Kinder. Die Einrichtungen waren oft weit vom Zuhause der Kinder entfernt. Häufig wurden gehörlose Kinder, unabhängig davon, ob weitere Behinderungen vorlagen, gemeinsam in diesen Einrichtungen beschult, so dass sie auch hier letztlich nicht individuell gefördert werden konnten. Für Gehörlose bedeutete Schule in erster Hinsicht, dass sie die Lautsprache lernen sollten. Darüberhinausgehende Qualifikationen standen lange im Hintergrund.
Die Quelle aus dem Jahr 1958 zeigt, wie wenig die Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen, beachtet wurden, wenn es um ihre Ausbildung ging. Dort heißt es, der Junge könne keine kaufmännische Lehre durchhalten. Und dann: „Wir wollen es nun einmal versuchen mit dem Bäckerhandwerk. Wir haben uns deshalb bereits mit einigen Pforzheimer Bäckereien in Verbindung gesetzt und bei dem großen Bedarf […] ist es möglich, dass wir ihn gut unterbringen.“ Der Betroffene berichtete später, dass er damals nicht Bäcker werden wollte. Ihm hat diese Entscheidung, die für das Pforzheimer Bäckerhandwerk gut gewesen sein mag, nicht gutgetan.
Doch Arbeit wurde nicht nur im Rahmen der Ausbildung geleistet. In der Regel mussten Heimkinder in den Einrichtungen viele Aufgaben übernehmen. Bereits vor dem Frühstück wurden die Schlafräume und die Bäder gereinigt, am Nachmittag dann im Garten, auf dem Feld oder in der Wäscherei geholfen. Arbeit galt als wichtiges Erziehungsmittel und die Ausführung der Dienste wurde penibel kontrolliert. Arbeitsdienste erledigten viele Betroffene nicht nur für die Heime, sondern auch für externe Betriebe. Für die häufig schwere körperliche Arbeit erhielten nur die wenigsten einen Lohn. Die Arbeit, die in den Einrichtungen und Betrieben geleistet wurde, war zum Teil schwere körperliche Arbeit, wie viele Betroffene berichten.
Literatur
- Dreier-Horning, Anke, Pädagogische Gewalt und Lebensalltag, in: Leid und Unrecht. Kinder und Jugendliche in Behindertenhilfe und Psychiatrie der BRD und DDR 1949 bis 1990, hg. von Heiner Fangerau, Anke Dreier-Horning, Volker Hess, Karsten Laudien, Maike Rotzoll, Köln 2021, S. 153 – 191.
- Pilz, Nastasja/Seidu, Nadine und Keitel, Christian (Hg.), Verwahrlost und gefährdet? Heimerziehung in Baden-Württemberg 1949-1975, Stuttgart 2015.
Zitierhinweis: Nadine Seidu, Nora Wohlfarth, Arbeit und Schule, in: Heimkindheiten, URL: […], Stand: 22.03.2022.
Teilen
 leobw
leobw