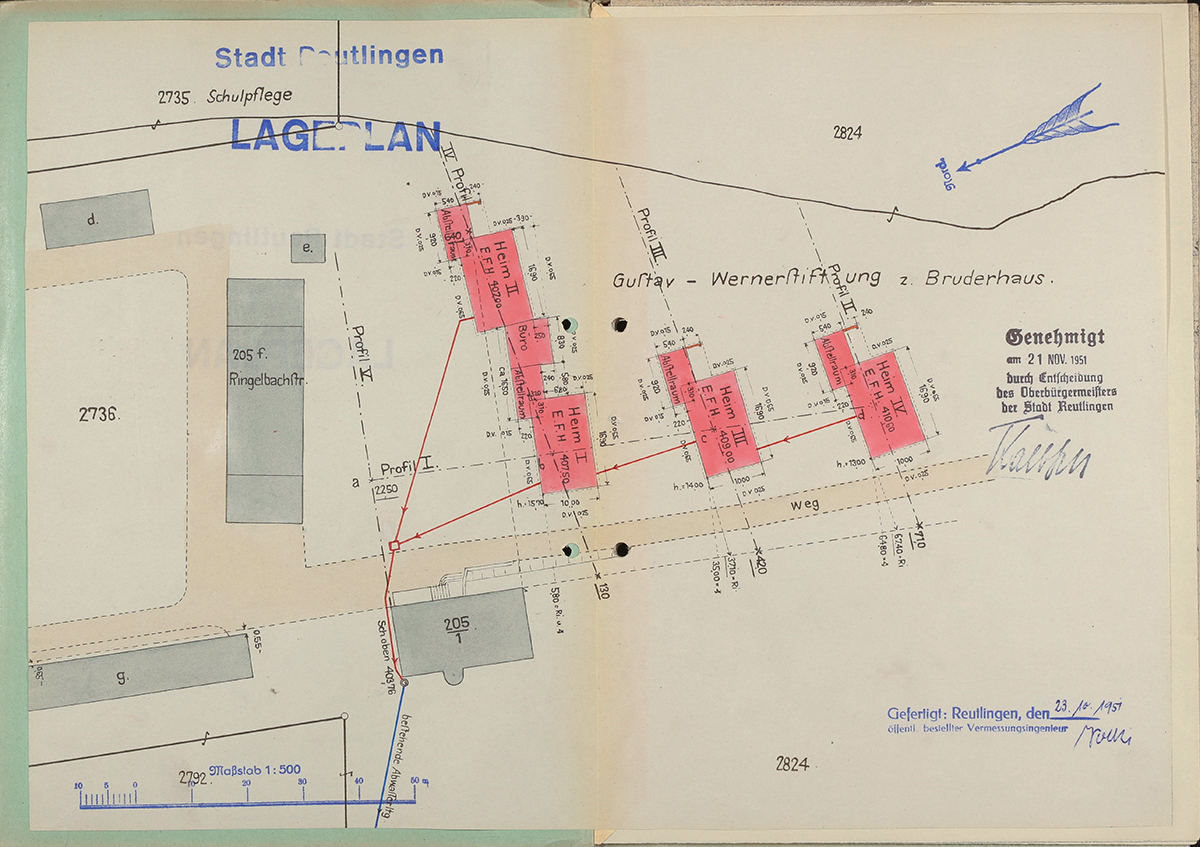Brown Babies
von Max G. Gaida
![Elfi Fiegert als Toxi an der Binnenalster, 1952 [Quelle: Verein Film- und Fernsehmuseum Hamburg e.V., Foto: Peter Michael Michaelis]. Zum Vergrößern bitte klicken. Elfi Fiegert als Toxi an der Binnenalster, 1952 [Quelle: Verein Film- und Fernsehmuseum Hamburg e.V., Foto: Peter Michael Michaelis]. Zum Vergrößern bitte klicken.](/documents/10157/19373997/Elfi_Fiegert_als_TOXI_1952_an_der_Binnenalster_Foto_Peter_Michael_Michaelis_vor.jpg/cab4846d-32b7-0382-23b4-1f1baa46277e?t=1661412365029)
Waren Kinder von deutschen Müttern und afroamerikanischen Soldaten zu ihrer Kindheit noch im Fokus der Öffentlichkeit, ist ihre Geschichte heute fast vergessen.
Im Nachkriegsdeutschland gab es fast 100.000 sogenannter „Besatzungskinder.“ Eine Minderheit von ungefähr 5.000 nahm aus einem einfachen Grund in der öffentlichen Debatte eine disproportional große Rolle ein: Ihre Hautfarbe war schwarz. Ihre Mütter waren Deutsche, ihre Väter ausländische Soldaten.
Im Unterschied zu anderen Kindern von Besatzungssoldaten fielen die sogenannten Brown Babies durch ihre Hautfarbe auf und konnten ihre Herkunft nicht verbergen. Zu einer Zeit, in der Deutschsein ausschließlich mit Weißsein assoziiert wurde, war dies keine gute Voraussetzung für ein leichtes Leben. Überdies wurde die Hautfarbe der Kinder von Deutschen zum Teil als eine Erinnerung an die Niederlage des Krieges wahrgenommen.
Da die deutschen Mütter oft unverheiratet waren, befanden sich Mutter und Kind in einer schwierigen, von sozialer Ächtung und Armut geprägten Lage. Zudem erwies sich das US-Militär als nicht gewillt, den deutschen Müttern zu helfen. Angehende Väter wurden oft schon lange vor der Geburt aus dem Land versetzt. Somit konnten sie oft für Sorgerecht oder Unterhaltsansprüche nicht ausfindig gemacht werden. Aus diesen Gründen wurden viele der Brown Babies in Waisen- und Kinderheime geschickt und zur Adoption freigegeben.
Internationales Interesse zeigte sich insbesondere seitens der USA, denn die afroamerikanische Presse verfolgte gespannt, wie mit den dunkelhäutigen Kindern kurze Zeit nach dem Ende des Nazi-Regimes umgegangen würde. Folglich wurden auch Privatpersonen auf das oft schwierige Schicksal der Kinder aufmerksam und die Nachfrage nach Adoptionen stieg.
Mabel Grammer, eine damals in Mannheim lebende afroamerikanische Journalistin, ermöglichte circa 500 Adoptionen in die USA und nahm selbst zwölf Brown Babies auf. Dabei handelte sie jedoch meistens in einer rechtlichen Grauzone, da die Kinder als „Displaced Persons“ klassifiziert wurden. Als Staatenlose konnten sie leichter adoptiert werden. Die komplizierte Geschichte von Grammer ist jüngst zum Thema wissenschaftlicher Forschung geworden, die ihre Beziehung mit den deutschen Behörden und ihre Zeit in Mannheim zu durchleuchten versucht.
Viel Aufmerksamkeit erlangten die Brown Babies außerdem durch den Film Toxi (1952). Auch wenn dieser heute wenig bekannt ist, gehörte er in seinem Erscheinungsjahr zu den zehn meistgesehenen Filmen in Deutschland und prägte die Wahrnehmung so sehr, dass schwarze Besatzungskinder danach in der Öffentlichkeit oft als „Toxis“ bezeichnet wurden. In dem Film stirbt die Mutter eines Brown Baby und da der Vater sich schon lange in den USA befindet, wird die kleine Toxi im Film von einer deutschen, weißen Familie aufgenommen. Der Film setzt sich mit Rassismus auf aus heutiger Sicht eher problematischer Weise auseinander. Das kleine Mädchen wird von Familienmitgliedern offen diskriminiert. Besonders der Onkel möchte nicht, dass sie mit seinen Töchtern spielt. Durch ihr hervorragendes Benehmen und altersuntypische Reife schafft Toxi es jedoch, die Familie von sich zu überzeugen. Unabsichtlich zeigt der Film damit auf, wie schwer es von Rassismus betroffene Menschen haben. Zum Ende des Films geschieht aber, ausgerechnet an Weihnachten, ein Wunder: Toxis Vater erscheint, um das Mädchen mit in die USA zu nehmen. Diese abrupte Wendung illustriert das gängige Denken der Fünfzigerjahre, denn Toxi wird „nach Hause“ gebracht. Ein naheliegender Subtext ist, dass Brown Babies in Deutschland nicht zuhause sein können und es ihnen in ihrer angeblichen Heimat, den USA, besserginge.
Die Brown Babies wuchsen in einer Zeit auf, die auch für ihre weißen Altersgenossen von den Entbehrungen der Nachkriegszeit geprägt war. Für die schwarzen Kinder kamen noch Rassismus und Ausgrenzung dazu. Die Behörden nannten sie oft „Mischlingskinder,“ ein abfälliger Begriff, der in der NS-Zeit verwendet wurde, um Kinder von jüdischen und nicht-jüdischen Eltern zu beschreiben und daher auch in den Fünfzigerjahren noch äußert negativ konnotiert war.
Sinnbildlich stehen die Brown Babies auch für die Prägung der Nachkriegsjahre durch die militärische Besatzung. Nach der Historikerin Heide Fehrenbach ermöglichte die besondere Aufmerksamkeit auf die Kinder von afroamerikanischen Soldaten in der öffentlichen Debatte die Verlagerung vom Begriff der „Rasse“ auf das Konzept des „Anderssein“. Die Gleichsetzung von Deutschsein mit Weißsein blieb jedoch bestehen.
Allerdings war und ist das spätere Leben der Brown Babies nicht nur von Schwierigkeiten geprägt. Erwin Kostedde, womöglich eines der berühmtesten Kinder afroamerikanischer Soldaten in Deutschland, brillierte im Fußball und wurde 1974 der erste schwarze deutsche Nationalspieler. Doch der Rassismus der deutschen Bevölkerung war in dieser Zeit noch zu groß, als dass Kostedde akzeptiert werden konnte. Er wurde, obwohl er in der Bundesliga mitunter die meisten Tore schoss, in der Deutschen Fußball-Nationalmannschaft nur in vier Spielen eingesetzt. In einer eindrücklichen Passage des Dokumentarfilms „Schwarze Adler“ (2021) erinnert er das Publikum daran, dass die älteren Jugendlichen der Fünzigerjahre fast alle in der Hitlerjugend gewesen waren. Anstelle eines Neubeginns in der angeblichen „Stunde Null“ sahen sich die Brown Babies mit Kontinuitäten und Überresten der NS-Zeit konfrontiert.
Die Adoptionen in die USA verliefen auch nicht immer problemlos, denn die Leben von Afroamerikanern waren von Rassismus und den Jim-Crow-Gesetzen, die Rassentrennung in der Öffentlichkeit erzwangen, geprägt. Viele Brown Babies fanden zudem erst spät im Leben heraus, dass sie eine deutsche Herkunft hatten. Einige kehrten nach Deutschland zurück, um ihre persönliche Geschichte aufzuarbeiten. So auch Peggy Blow, die von einem Dokumentarfilmteam begleitet wurde und deren Erfahrungen im Film „Brown Babies – Deutschlands verlorene Kinder“ festgehalten wurden.
Die heute erwachsenen Brown Babies verstehen und organisieren sich als Afrodeutsche. Ihre Geschichte erinnert an ein schwieriges Kapitel Nachkriegsdeutschlands, dessen Aufarbeitung noch aussteht. Seit einigen Jahren sind sie vermehrt Thema einer akademischen Auseinandersetzung, öffentlich sind ihre Erfahrungen jedoch selten im Fokus. Möglicherweise auch, weil sie nicht in die Mythen der Fünfzigerjahre, der sogenannten „Stunde Null“, passen und weder Deutschland noch die USA ihnen eine unbeschwerte Kindheit und ein sorgloses Leben ermöglichten.
Literatur
- Black German Cultural Society, URL: http://afrogermans.us/german-brown-babies-2/ (aufgerufen am 21.02.2022)
- Körner, Torsten, Schwarze Adler, Broadview Picture. 2021, URL: https://www.schwarzeadler-film.com/ (aufgerufen am 21.02.2022)
- Kirst, Michael, Brown Babies – Deutschlands verlorene Kinder, BR/Arte /WDR 2021, URL: https://www.tangram-film.de/film/128/Brown-Babies--Deutschlands-verlorene-Kinder (aufgerufen am 21.02.2022)
- Fehrenbach, Heide, Race after Hitler: Black Occupation Children in Postwar Germany and America, Princeton 2005.
Zitierhinweis: Max G. Gaida, Brown Babies, in: Heimkindheiten, URL: […], Stand: 21.02.2022.
Teilen
 leobw
leobw