Eine Einschätzung der Kinderkuraufenthalte aus entwicklungspsychologischer Sicht
Interview mit Prof. Dr. Andreas Mayer, Professor für Psychologie an der Evangelischen Hochschule Freiburg

Fragen von Johanna Weiler und Corinna Keunecke
Viele ehemalige Verschickungskinder setzen sich heute aktiv mit ihrer eigenen Biographie auseinander. Manche können sich noch im Detail an ihren „Erholungsaufenthalt“ erinnern, andere lässt ihr Gedächtnis im Stich. Sie alle eint die Frage, inwiefern sich das Erlebte nachhaltig auf ihre Persönlichkeit und ihren weiteren Lebensweg ausgewirkt hat. Pauschal lassen sich solche Fragen nicht beantworten, so viel ist sicher. Jedoch hat sich Andreas Mayer, Professor für Psychologie an der Evangelischen Hochschule Freiburg, bereit erklärt, uns einige Hintergrundfragen zu beantworten. Prof. Mayer ist spezialisiert auf Entwicklungspsychologie und klinische Psychologie des Kindes- und Jugendalters.
Herr Mayer, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für unsere Fragen nehmen. Wie Sie wissen, dauerten die meisten Verschickungsaufenthalte ungefähr sechs Wochen. Oft waren die Kinder zum ersten Mal überhaupt von zu Hause weg. Wie würde man eine solche plötzliche mehrwöchige Trennung von den Eltern aus heutiger Sicht entwicklungspsychologisch beurteilen?
Mayer: Unvorbereitete und damit abrupt stattfindende Trennungen im Kindesalter würde man aus heutiger Sicht sicher kritisch sehen und zu vermeiden versuchen. Ganz besonders in der frühen Kindheit. Plötzlich stattfindende Trennungen führen dazu, dass Kinder die Ursachen der Trennung nicht verstehen und die Trennung selbst ohnmächtig über sich ergehen lassen müssen. Bespricht man bevorstehende Trennungen mit Kindern altersgerecht, können sie sich besser darauf einstellen, sich dazu positionieren, die eigenen Gedanken und Gefühle mit den Eltern teilen. All das hilft dabei, ihnen ein Gefühl von Vorhersehbarkeit und Kontrolle zu vermitteln. Der Gedanke an den Spruch „lieber kurz und schmerzlos“ ist hier völlig fehl am Platz. Ihre Frage bezieht sich aber auch auf die Dauer der Trennung. Wie Kinder Trennungen erleben und verarbeiten, hängt sehr stark von ihrem Alter ab - und natürlich auch davon, wer während der Trennung an ihrer Seite steht und wie einfühlsam das Kind dabei begleitet wird, eine Trennung zu überstehen. Man muss also unterscheiden zwischen den Folgen einer längeren Trennung an sich, und den Folgen von dem, was während der Trennung geschieht beziehungsweise nicht geschieht.
Konzentrieren wir uns zunächst auf die Trennung an sich. Inwiefern spielt das Alter der Kinder eine Rolle dafür, wie gut oder schlecht die Kinder diese Situation verarbeiten konnten? Kann man pauschal sagen: Je jünger das Kind zum Zeitpunkt des Aufenthalts, desto schwieriger die Verarbeitung?
Mayer: Kinder unterscheiden sich sehr voneinander, zum Beispiel im Temperament, in der Sensibilität oder auch hinsichtlich des Vorhandenseins von individuellen Schutzfaktoren. Daher darf man eine solche Aussage nicht als Gesetzmäßigkeit missverstehen, die auf jedes einzelne Kind anwendbar ist. Allerdings würde ich der getroffenen Aussage in der Tendenz zustimmen und mit Blick auf die Kinderverschickungen ist sie sicherlich passend. Eine Trennung von sechs Wochen ist lang und vor allem für Kinder unter drei bis vier Jahren viel zu lang. Kinder in diesem jungen Alter verfügen noch nicht über das, was man in der psychoanalytischen Tradition als „Objektkonstanz“ bezeichnet, das heißt, sie können sozusagen das „innere Bild“ der Bezugsperson noch nicht lange genug in sich lebendig halten, um eine so lange Trennung gut zu überstehen. Die Trennung fühlt sich in diesen jungen Jahren wie ein völliger Verlust an und es kann sein, dass die eigenen Eltern nach solch einer Trennung nicht wiedererkannt werden. Darüber hat beispielsweise der britische Kinderarzt und Psychoanalytiker Donald Winnicott berichtet. Wir Erwachsenen können das vielleicht nicht mehr nachvollziehen. Uns gelingt es über längere Zeit, das innere Bild einer geliebten Person lebendig zu halten, etwa wenn der Partner oder die Partnerin für Wochen oder Monate ins Ausland reist und wir innerlich die Verbindung zu dieser Person aufrechterhalten, in unseren Gedanken, Gefühlen und Fantasien. Kinder müssen die Fähigkeit hierzu allerdings erst entwickeln.
Aus Briefen der verantwortlichen Stellen an die Eltern, die diese im Vorfeld des Aufenthalts erhielten, wissen wir, dass ihnen teilweise geraten wurde, vor der Reise nicht mit ihrem Nachwuchs über mögliches Heimweh zu sprechen. Sonst könnten die Kinder meinen, sie „müssten“ Heimweh haben. Wie schätzen Sie diesen Ratschlag ein?
Mayer: Nun, auf einer sehr trivialen Ebene könnte man das vielleicht noch nachvollziehen: Die sprachliche Äußerung eines Wortes wie „Heimweh“ aktiviert das entsprechende Konzept beim Zuhörer. Das ist ein wenig so wie mit dem Satz „Denken Sie nicht an den rosa Elefanten“. Daraus aber abzuleiten, dass es besser ist, Kinder nicht auf schwierige Gefühle vorzubereiten und nicht mit ihnen ins Gespräch zu gehen, ist absurd. Im Gegenteil: Eltern vermitteln Kindern über ein entsprechendes Gespräch, dass Sie sich einfühlen können, dass Sie um die möglichen schwierigen Gefühle wissen, diese akzeptieren und dem Kind dennoch zutrauen, damit zurechtzukommen. Das vermittelt Nähe und Vertrauen. Natürlich ist es nicht ratsam zu sagen: „Du wirst auf jeden Fall Heimweh bekommen, lass uns daher jetzt darüber sprechen.“ Aber man kann das Kind ja fragen, wie es der Reise gegenübersteht, was es fühlt, usw. Ich möchte aber auch daran erinnern, dass es früher in vielen Familien allgemein nicht üblich war, über schwierige Gefühle miteinander zu sprechen. Die Schatten des vergangenen Krieges hatten sich als Schweigemantel über viele Familien gelegt. Der Rat, mit Kindern nicht über mögliches Heimweh zu sprechen, entsprach häufig einer ohnehin bestehenden Neigung innerhalb von Familien, nicht über schwierige Gefühle miteinander zu reden.
Der Kontakt der Kinder zu ihren Eltern wurde während des Aufenthaltes im Verschickungsheim sehr stark eingeschränkt. Aufgrund von Briefzensur hatten die Kinder keine oder fast keine Möglichkeit, die Eltern um Hilfe zu bitten. Gleichzeitig wurde den Eltern nahegelegt, von viel Post oder gar Besuchen abzusehen, um den Kindern die Eingewöhnung zu erleichtern und die Gruppendynamik nicht zu gefährden. Wie schätzen Sie diese Situation für ein Kind ein? Kann eine solche Situation die Bindung zwischen Eltern und Kind nachhaltig beschädigt haben?
Mayer: Hier müsste man zunächst einmal klären, was mit einer beschädigten Bindung gemeint ist, es handelt sich hierbei um keinen fest definierten Fachbegriff. Zunächst einmal: Natürlich kann das Gefühl von Hilflosigkeit in solch einer Situation, aus der einem die eigenen Eltern nicht heraushelfen, Folgen auch für die Beziehung zu den Eltern haben. Bindung vermittelt Sicherheit, in unsicheren oder ängstigenden Situationen sucht man demnach die Nähe der Bindungsperson beziehungsweise der Bindungspersonen. Genau das wurde mit den genannten Maßnahmen unmöglich gemacht, so dass sich das verinnerlichte Gefühl, sich auf die Eltern verlassen zu können, bei manch einem Kind vor dem Hintergrund langer Trennungen und schwieriger Erfahrungen während der Trennung womöglich verändert hat oder instabil wurde. Die Erforschung von solchen Fragen ist allerdings schwierig, man ist hier auf die mündlichen Berichte von Betroffenen angewiesen, ohne unabhängig von diesen Berichten die Bindungsqualität vor den Verschickungen einschätzen zu können.
Ihre Frage stellt aber auch eine Verbindung zur vorherigen her. Man dachte, dass ein Ansprechen von Heimweh zu Problemen führt, dass Besuche das Heimweh erst entstehen lassen oder verstärken könnten. In derselben Logik gefährden Besuche die Eingewöhnung oder eben die Gruppendynamik. Viele Verschickungsheime waren so rigide organisiert, dass negative Emotionen und Affekte die Abläufe störten. Man begegnete solchen Gefühlsäußerungen oft mit autoritärer Härte. Daher liegt die Vermutung sehr nahe, dass es den Verantwortlichen nicht darum ging, die Kinder vor schwierigen Gefühlen wie Heimweh zu schützen oder ihnen die Eingewöhnung zu erleichtern, sondern in erster Linie darum, sich selbst und die eigenen Abläufe vor „Störungen“ durch unliebsame Gefühle zu bewahren. Wenn ein solcher Zustand der forcierten Unterdrückung von Gefühlen über Wochen oder gar Monate der Trennung von den Eltern anhält, kann das gravierende psychische Folgen haben. Und sicherlich gab es noch einen weiteren Grund für die Kontakteinschränkungen beziehungsweise -verbote: Besuche hätten den Eltern Einblicke in die konkreten Bedingungen und in die zwischenmenschliche Atmosphäre vor Ort geben.
Zeitzeuginnen und Zeitzeugen berichten uns von einem kaltherzigen Umgang mit Heimweh in vielen Einrichtungen. Dieser reichte vom Verbot zu weinen bis hin zu Schlägen, wenn das Gefühl nicht unterdrückt werden konnte. Nicht wenige begannen während ihres Aufenthaltes, nachts einzunässen. Welche Auswirkungen auf die Psyche eines Kindes sind durch derartige Erfahrungen zu befürchten?
Mayer: Die Folgen können massiv sein. Das Einnässen ist selbst bereits ein Beispiel für eine gravierende psychische Folge, ein Hinweis auf eine große seelische Not, für die das Kind keinen anderen Ausdruck finden konnte oder durfte. Erfahrungen von Demütigung, Gewalt und Lieblosigkeit, und dann noch fern von den eigenen Eltern – so etwas vergisst man nicht, auch wenn das nicht heißt, dass man sich immer bewusst daran erinnert. Derartige Erfahrungen können sich in verschiedenen Gestalten später im Leben zeigen, zum Beispiel in Träumen, in diffusen Gefühlen von Leere, Verlassenheit, Ohnmacht, Angst, Traurigkeit oder auch Wut. Sie können sich in der Unfähigkeit zeigen, anderen Menschen zu vertrauen oder Beziehungen einzugehen. Wenn betroffene Personen keine Erklärung für entsprechende Gefühle in ihrem gegenwärtigen Leben finden, aber auch keine konkreten Erinnerungen mehr an früher haben, kann das sehr belastend sein. Unabhängig davon, ob die diagnostischen Kriterien für eine psychische Erkrankung erfüllt sind, können solche Erfahrungen also massives seelisches Leid nach sich ziehen. Und natürlich können sich in der Folge auch verschiedenste psychische Erkrankungen im engeren Sinne manifestieren, etwa depressive Störungen, Angsterkrankungen oder auch Traumafolgestörungen.
Inwiefern spielt es Ihrer Meinung nach eine Rolle, ob die Kinder sich ihren Eltern oder anderen Vertrauenspersonen nach dem Kuraufenthalt anvertrauten und von ihren Erlebnissen berichteten und wie die Eltern im Anschluss mit diesen Informationen umgingen?
Mayer: Das spielt eine sehr große Rolle. Man darf aber eines nicht vergessen: Die Eltern der Verschickungskinder waren auch Kinder ihrer Zeit. Für nicht wenige war ein autoritärer Erziehungsstil selbstverständlich. Härte, Distanz, Prügel waren häufig auch das, was die Eltern selbst in ihrer Kindheit kennengelernt hatten. Es ist gut, dass wir die dunklen Seiten der Verschickung aufarbeiten, wir dürfen in unserer Vorstellung aber nicht den Fehler begehen, von durchweg behüteten, liebevollen Kindheiten auszugehen, auf welche nur die Verschickungen einen Schatten warfen. Damit will ich nicht relativieren, was Kindern in den Verschickungsheimen an Schrecklichem widerfahren ist, ich möchte nur daran erinnern, dass für viele Kinder damals auch zuhause ein rauer Wind wehte. Das kann es im Nachhinein im Einzelfall schwer machen, die Folgen der Verschickung unabhängig von den Beziehungserfahrungen innerhalb der Familie oder auch beispielsweise der Schule einzuschätzen. Viele Kinder trafen ja nicht nur im Verschickungsheim auf autoritäre Erwachsene. Manche kamen nach schlimmen Erfahrungen während der Verschickung nach Hause und stießen auf taube Ohren, auf emotionale Kälte und eine bereits bekannte autoritäre Erziehung. Hier ist davon auszugehen, dass das die Erfahrungen während der Verschickung noch schlimmer machte, da sie nicht mit einer einfühlsamen Person geteilt werden konnten. Wenn die Kinder aber das Glück hatten, zuhause emotional zugängliche Eltern mit offenem Ohr zu haben, dann konnte die Anerkennung des im Heim erfahrenen Leids durch die Eltern eine sehr wichtige Rolle bei der Verarbeitung der gemachten Erfahrungen spielen.
Natürlich ist es leichter, die Geschehnisse in der Rückschau mit dem heutigen Wissensstand zu beurteilen. Können Sie sagen, wie verbreitet die Erkenntnisse aus der Bindungstheorie in Deutschland in den 50er- und 60er-Jahren waren, einerseits in der Wissenschaft und andererseits in der Gesellschaft?
Mayer: Auf diese Frage muss ich etwas ausführlicher antworten. Zunächst zum eigentlichen Inhalt der Frage: Die Bindungstheorie war zu dieser Zeit noch nicht sehr bekannt, auch der Begründer dieser Theorie, John Bowlby, formulierte seine entscheidenden Schriften erst Ende der 50er- und dann weiter in den 60er-Jahren. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass sich schon vor der Bindungstheorie wichtige Vertreter und Vertreterinnen der Psychoanalyse mit den Folgen von Trennungen und der Bedeutung der Eltern, damals vor allem der Mutter, beschäftigt haben, man denke an Anna Freud, René Spitz oder Donald Winnicott. Bowlby und Winnicott hatten bereits 1939 in einem Brief an das British Medical Journal vor den Folgen langer Trennungen im Zuge von Evakuierungen gewarnt. Bowlby hatte die Bindungstheorie also nicht im luftleeren Raum entwickelt, er war ja selbst Analytiker.
In Deutschland wirkten die Vorstellungen von autoritärer Erziehung und Gefühlskontrolle leider noch sehr lange nach. Vermeintliche Ratgeber aus der Nazi-Zeit, allen voran das Buch „Die deutsche Mutter und ihr erstes Kind“ von Johanna Haarer, empfahlen Eltern Härte und Gefühlskälte gegenüber den Kindern. Es ging darum, die Kinder im Sinne der NS-Ideologie zu formen beziehungsweise zu verformen. Erschreckenderweise wurden Haarers Schriften noch Jahrzehnte nach dem Krieg aufgelegt und konnten so ihre Wirkung weiter entfalten. Entsprechend wirkten Erziehungsvorstellungen aus der NS-Zeit weiter und dazu gab es zunächst erst einmal wenig professionelles Gegengewicht: Mit der Machtübernahme der Nazis flohen viele jüdische Denker und Forscher, darunter zum Beispiel auch Sigmund und Anna Freud. So wurde in gewisser Weise auch jenes Wissen vertrieben, dass man hierzulande gut hätte gebrauchen können.
Ihre Frage nach der Verbreitung bindungstheoretischen Wissens kann aber auch leicht missverstanden werden, denn sie scheint nahezulegen, dass wir die Bindungstheorie und ihre Erkenntnisse brauchen, um mit Kindern angemessen umgehen und ihre Bedürfnisse achten zu können. Doch die Menschen wissen seit jeher um die Verletzlichkeit und Bedürfnisse von Kindern, diese Erkenntnisse fielen nicht mit der Bindungstheorie vom Himmel. Wichtiger erscheint mir daher die Frage, wie das intuitive Wissen von Eltern um die Bedürfnisse ihrer Kinder so systematisch verdrängt und korrumpiert werden konnte. Das Problem damals war nicht das Fehlen der Bindungstheorie, sondern die Außerkraftsetzung intuitiven elterlichen Wissens um das, was Kinder brauchen. Die Ursachen hierfür sind in der deutschen Geschichte zu suchen, in den Ursachen von Autoritarismus und schwarzer Pädagogik.
Gibt es darüber hinaus aus entwicklungspsychologischer Perspektive weitere Aspekte, die es bei diesem Thema zu berücksichtigen gilt?
Mayer: Wir haben uns in der Entwicklungspsychologie in den vergangenen Jahrzehnten auch mit der Frage beschäftigt, was Kinder gesund hält, also mit Schutzfaktoren. Es bleibt ja eine offene Frage, warum für manche Kinder die Verschickungen weniger schlimm waren, warum manche sie sogar in positiver Erinnerung haben. Als wichtigster Schutzfaktor stellte sich in Studien zum Thema Schutz- oder Resilienzfaktoren immer wieder das Vorhandensein einer vertrauensvollen Person, mit der das Kind in Beziehung treten konnte, heraus. Das ist insofern interessant, weil es erklären mag, warum manche Kinder die Verschickung vergleichsweise gut überstanden. Wenn es in den Heimen eine erwachsene Person gab, die Kindern nicht mit autoritärer Härte begegnete, sondern mit Nachsicht, mit echtem Interesse, dann können diese Personen den entscheidenden Unterschied gemacht haben. Ich möchte diesen Aspekt erwähnen, weil es innerhalb der Einrichtungen eben auch zugewandte Menschen gab, denen etwas an den Kindern und an ihrem Wohlbefinden lag.
Und ich möchte gerne noch einen Bogen in unsere Zeit spannen. Ich denke, dass wir auch heute noch unterschätzen, wie sensibel und verletzlich Kinder sind, wie sehr sie von ihren Bezugspersonen abhängig und auf diese angewiesen sind. Zwar reden wir heute offen über die Heime in der DDR und mittlerweile eben auch über die bundesweite Verschickungspraxis, doch scheint mir, dass wir häufig noch immer dazu tendieren, die Perspektive der Kinder zu vernachlässigen und damit einen vergleichbaren Fehler begehen. Man denke nur an die Einschränkungen für Kinder während der Corona-Pandemie. Ein weiteres aktuelles Beispiel wäre die Diskussion um die Ausweitung der Frühbetreuung. Es geht in der Debatte, so scheint mir, vor allem um Gleichberechtigung, um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, doch die Bedürfnisse und Empfindungen der Kinder sind wie sie sind, sie lassen sich nicht durch gewünschte oder politisch motivierte Veränderungsprozesse auf gesellschaftlicher Ebene verändern. Aus entwicklungspsychologischer Sicht ist etwa ein massiver Ausbau von U-3 Betreuungsplätzen nicht wünschenswert, wenn dort die von der Wissenschaft geforderten Qualitätsstandards nicht erfüllt werden können. Angebote, einjährige Kinder von 8 Uhr morgens bis 17 Uhr betreuen zu lassen bei schlechtem Betreuungsschlüssel und hoher Personalfluktuation – das bereitet mir Sorgen, wir tun den Kindern damit nichts Gutes. Wenn wir aus den damaligen Erfahrungen etwas lernen wollen, dann sollten wir die Einsichten in die Abhängigkeit und Verletzlichkeit von Kindern sowie in die Bedeutung zugewandter Bezugspersonen auch in aktuelle Diskussionen immer wieder einbringen.
Sehr geehrter Herr Mayer, vielen Dank für das Interview.
(Das Interview wurde schriftlich geführt)


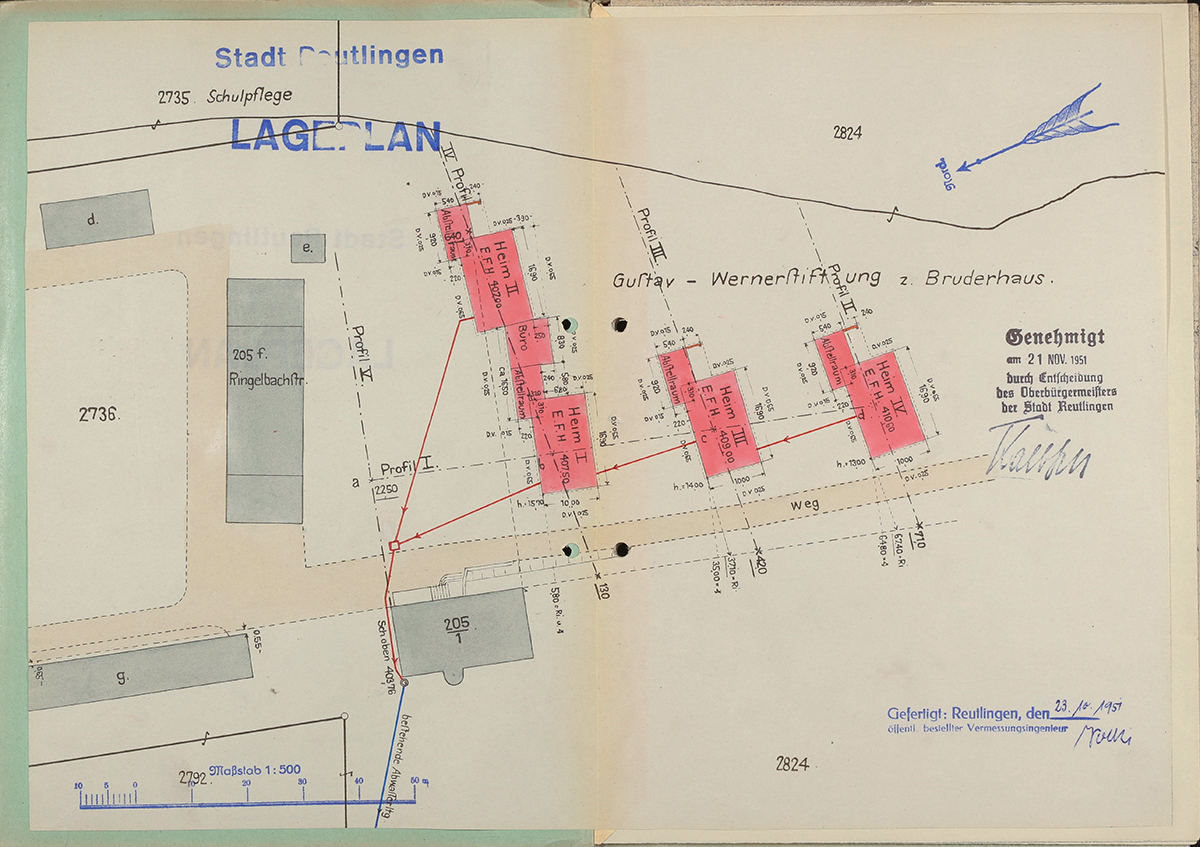



 leobw
leobw