Kiesinger, Kurt Georg
| Geburtsdatum/-ort: | 06.04.1904; Ebingen |
|---|---|
| Sterbedatum/-ort: | 09.04.1988; Tübingen |
| Beruf/Funktion: |
|
| Kurzbiografie: | 1910-1913 katholische Volksschule in Ebingen 1913-1919 Realschule in Ebingen 1919-1925 katholisches Lehrerseminar in Rottweil 1925-1926 Studium der Philosophie in Tübingen 1926-1931 Studium der Philosophie (Geschichte und Germanistik) und Rechtswissenschaft in Berlin 1931 Erste Juristische Staatsprüfung und Referendarzeit 1934 Zweite Juristische Staatsprüfung; Rechtsanwalt und privater Rechtslehrer in Berlin 1940-1945 Wissenschaftlicher Hilfsarbeiter im Auswärtigen Amt 1945-1948 1 1/2 Jahre Internierung in Ludwigsburg, danach Rückkehr in die Heimat, Rechtsanwalt in Tübingen 1948-1951 Landesgeschäftsführer der CDU Südwürttemberg-Hohenzollern 1949-1958 und 1969-1980 Mitglied des Bundestags 1954-1959 Vorsitzender des Bundestags-Ausschusses für Auswärtige Angelegenheiten, zeitweise Vorsitzender des Vermittlungsausschusses 1955-1959 Vizepräsident der Beratenden Versammlung des Europarats; Vorsitzender der Gesamtfraktion der Christlichen Demokraten 1958-1966 Ministerpräsident von Baden-Württemberg 1960-1966 Mitglied des Landtags 1963-1966 Bevollmächtigter der Bundesrepublik Deutschland für kulturelle Angelegenheiten im Rahmen des Deutsch-Französischen Elyseevertrags 1966-1969 Bundeskanzler 1967-1971 Bundesvorsitzender der CDU |
| Weitere Angaben zur Person: | Religion: rk. Auszeichnungen: Ehrendoktor der Universitäten Köln (1965), New Delhi (1967), University of Maryland, Coimbra (1968), Konstanz (1976) 1960 Großkreuz des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland; Bayerischer Verdienstorden; Großkreuz Orden Carlos III (Spanien); Großkreuz des Verdienstordens der Republik Italien; Großoffizierskreuz der Ehrenlegion (Frankreich); Großkreuz des Päpstlichen Piusordens; Kommandeur des Ordens Palmes Académiques (Frankreich); Großes Silbernes Ehrenzeichen am Bande der Republik Österreich 1964 Verfassungsmedaille Baden-Württemberg 1975 Verdienstmedaille des Landes Baden-Württemberg Ehrenbürger der Städte Ebingen (1969), Konstanz (1976), Tübingen (1979) Verheiratet: 1932 Marie-Luise, geb. Schneider (1908-1990) Eltern: Vater: Christian Kiesinger (1876-1969), Geschäftsführer und kaufmännischer Angestellter Mutter: Dominika, geb. Grimm (+ 1904 im Alter von 26 Jahren) Geschwister: 3 Halbschwestern, 3 Halbbrüder aus 2. Ehe des Vaters Kinder: Viola (* 1940) Peter (* 1942) |
| GND-ID: | GND/118562053 |
Biografie
| Biografie: | Paul Feuchte (Autor) Aus: Baden-Württembergische Biographien 1 (1994), 176-186 Wer in den 60er Jahren unseres Jahrhunderts, in der Ära des mächtigen Sowjetführers Leonid Breshnew, eine Lösung der deutschen Frage, die „Wiedervereinigung“ des deutschen Volkes, für möglich hielt, mochte als wirklichkeitsfern oder gar als Phantast gelten. Wer aber aussprach, daß sie möglich sei, wenn es gelänge, den Ost-Westgegensatz allmählich durch Verständigung und beiderseitigen guten Willen zu überwinden, und wer, wie Kiesinger, die Hoffnung hegte, daß eines Tages auch die Sowjetunion in einem einigen Europa ein wesentliches Element der Friedensordnung in der Welt erblicken werde, der hatte etwas von der Gabe des weit vorausdenkenden Staatsmannes, der nicht in aktuellen Sorgen und Gefahren befangen bleibt, sondern aus visionärer Eingebung ferne große Ziele markiert und ansteuert. Kiesinger trug sich in seiner Jugend mit dem Gedanken, Politiker und Dichter zu werden. Daß dies schwer vereinbar sei, erkannte er wohl, und der dichterische Elan, den er in gelegentlichen Versuchen entfaltete, bestimmte seinen Lebensgang nicht wesentlich. Aber die Wirkung des gesprochenen und geschriebenen Wortes war ihm in allem, was er tat, eine entscheidende Hilfe und eine nie vernachlässigte Sorge. Man mag ihn in die Reihe der seltenen Politiker stellen, die zugleich „hommes de lettres“ sind. So fehlte ihm die äußerste Robustheit, die den vom Ballast der hohen Bildung freieren Politiker leichter zum Erfolg führt. Aber es gelang ihm – unter Mühen –, die Verbindung von contemplatio und actio, von Betrachten, Wägen und Wagen. Im Widerstreit der Neigungen gab er der Politik auch gegenüber der eigenen vollen Zuwendung zu den Wissenschaften den Vorrang. Aber – darüber gibt es keinen Streit – er verstand das politische Geschehen als eine geistige Auseinandersetzung, politisches Handeln als „eine in der Geschichte gegebene geistige Gestaltungsaufgabe“ (Wilhelm Hahn), Macht und Geist nicht als Gegensatz. Er wußte, daß der Gebrauch der Macht die Wegweisung des Geistes braucht, und diese sucht er. Als Elite wünschte er sich Menschen, die, Leistung und Haltung vereinend, Einsicht in die Fakten unserer Welt haben und die darauf „den sittlichen Willen gründen, sich so zu verhalten, wie es der Gemeinschaft gegenüber notwendig ist“. Lange Zeit der Außenpolitik verschrieben, war er doch kein Spezialist, der andere Bereiche geringer eingeschätzt hätte. Aus der Politik ein Ganzes zu machen, erschien ihm wesentlich, und in der Bildungspolitik, die er mit gleichem Nachdruck betrieb, kam es ihm nicht nur auf Wissensvermittlung und Schärfung des Verstandes an, sondern auf die Ausbildung der geistigen und seelischen Kraft zum Widerstand „gegen die verkümmernden Tendenzen dieser Welt“. Schillers Warnung vor dem heraufziehenden Maschinen-Zeitalter, das die seelischen Kräfte verkümmern lasse, hatte sich ihm tief eingeprägt, und seine Sorge wandte sich besonders auch dem Arbeiter zu, den das in erster Linie traf. So wurde sein politisches Wirken in gleicher Weise bedeutsam für das für die Kulturpflege in erster Linie verantwortliche Land, das seine Heimat war, wie für die Bundesrepublik Deutschland. Von den kargen Höhen der Schwäbischen Alb, woher Kiesinger und seine Vorfahren stammen, auf den Stuhl des Regierungschefs der Bundesrepublik Deutschland ist ein weiter Weg. Seiner Heimat blieb Kiesinger zeitlebens treu, hier bezog er Kraft, Selbstvertrauen und Anregung, und sie kannte er in ihrer Vielgestalt von Natur, Geschichte, geistigen und sozialen Strömungen, Land und Leuten. Wann immer seine Bereitschaft zum Ausgleich, zum Kompromiß, zum Vermitteln gefordert war – sie gilt unbestritten als ein Wesenszug dieses Politikers –, kann man Ursprünge und Wurzeln ebenfalls hier finden. Das pietistische Milieu, in dem sein Vater sich geborgen fühlte, verband sich mit katholischer Tradition, welche die Familie der Mutter vermittelte. Die Heimat des väterlichen Geschlechts, Hossingen, gehörte dem reformierten Altwürttemberg zu, die der Mutter, Bubsheim, nur zwei Stunden Fußmarsch entfernt, lag auf vorderösterreichischem Gebiet. Kiesingers nachgelassenes Selbstportrait, das 1989 für die Jahre 1904 bis 1958 erschienen ist, verweilt in liebevoller Erinnerung bei den Erlebnissen der jungen, zum Teil harten Jahre. Er führt seinen Bericht fort in die Studienzeit in Rottweil, Tübingen und Berlin, wo der Absolvent des Rottweiler Lehrerseminars sich der Jurisprudenz zuwandte und die Jahre bis zum Ausbruch des Zweiten Weltkrieges als privater Rechtslehrer und Anwalt, den Krieg selbst im Dienst des Auswärtigen Amtes verbrachte. Über die Internierung durch die Besatzungsmacht und die Rückkehr in die Heimat hinaus lenkt er den Blick auf seine Mitwirkung am demokratischen Neubeginn und seine immer gewichtiger werdende Rolle in der Bundespolitik. Die Darstellung, stets bemüht, die erlebte Geschichte in den Gang des eigenen Lebens einzuschließen, endet mit dem Abschied von Bonn, für den er sich entschied, als im Dezember 1958 der Ruf an ihn erging, das Amt des Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg anzutreten. Für die spätere Zeit sind wir bei Selbstzeugnissen auf Reden, Interviews, Briefe und einzelne Dokumente – wie wir sie etwa bei Oberndörfer finden – angewiesen. Trotz reicher zeitgeschichtlicher Quellen wäre es doch von größtem Wert gewesen, den Eigenbericht Kiesingers mit der gleichen Anschaulichkeit und Eindringlichkeit der „Erinnerungen“, jedes Wort mit Bedacht gesetzt, auch für diese späteren Jahre fortgesetzt zu besitzen. Zeit und Kraft dazu fand Kiesinger nicht mehr. Gewiß war es ihm nicht minder wichtig, die der Forschung schwer zugänglichen Ursprünge offenzulegen, das Schicksal der Ahnen, ihre dörfliche Heimat, die Freuden und Ängste des Kindes, die Nöte und Sorgen des jungen Mannes, seine Hinneigung zu den Dichtern und seine wachsende Begierde, die geistige Welt in sich aufzunehmen. Ein persönliches Bekenntnis klingt auch in vielen seiner Reden und Ansprachen an, wofür die Beiträge in dem 1964 erschienenen Bändchen „Ideen vom Ganzen“ beispielhaft ausgewählt sind. Kiesinger nennt sie „Bruchstücke einer Konfession“. Das heikle Kapitel der Zugehörigkeit zur NSDAP, das sogar und gerade dem Kanzler noch zur Last wurde, nimmt, eingebettet in die politische Entwicklung der Weimarer Republik und der Anfangsjahre des Dritten Reiches, in den Erinnerungen gebührenden Raum ein. Wie viele war er, trotz innerer Vorbehalte gegen Hitler, seine Partei und ihr Erscheinungsbild, beeindruckt von dem verkündeten Ziel der Volksgemeinschaft und dem Versprechen, die wirtschaftliche Not zu beenden und Deutschland aus der Stellung eines Parias unter den europäischen Völkern zu befreien. In der Überzeugung, nicht als ohnmächtiger Zuschauer, sondern eher innerhalb der Partei Chancen zu finden, etwas an dem politischen Stil und den Zielen zu verändern, die er an den Nationalsozialisten „verabscheute“, trat er 1933 der Partei bei. Ähnliche Überlegungen bestimmten ihn, die 1940 gebotene Chance zu ergreifen, statt des Wehrdienstes eine Tätigkeit in der Rundfunkabteilung des Auswärtigen Amtes im Wege der Dienstverpflichtung zu übernehmen. Sein Einfluß ist schwer festzustellen. Als Leiter der Verbindungsstelle zum Propagandaministerium dürfte er ‚in multipler Koordinierungsfunktion‘ (Boelcke) bei den Rivalitäten zwischen diesem Ministerium und dem Auswärtigen Amt bereits seine Fähigkeiten zur Überbrückung schwieriger Situationen bewiesen haben. Daß Kiesinger bei alldem sich in Gewissenskonflikten befand, ist nicht zu bezweifeln. Der Wesensart des Individualisten entsprach die nationalsozialistische Weltanschauung nicht, noch weniger ihre furchtbaren Auswüchse. Konsequent versagte er sich den einem hochqualifizierten Juristen gegebenen Möglichkeiten, im Staatsdienst nach 1933 Karriere zu machen. Er wurde Rechtsanwalt in Berlin und gab Kurse für Jurastudenten, ein „Beruf, fern vom Staat“. Dem NS-Rechtswahrerbund trat er nicht bei, eine seltene Ausnahme. Die Spruchkammer stufte ihn später als „entlastet“ ein. Die neu entstehende Demokratie endlich gab Kiesinger die Möglichkeit zur Entfaltung seiner Gaben. Im heimatlichen Württemberg-Hohenzollern fand er zur CDU, für die er 1949 zum Bundestag kandidierte. Erste Erfolge brachte der Einsatz in der Südweststaatfrage. Mit wenigen Gleichgesinnten aus seinem Lande gehörte er zu der kleinen Schar von Politikern aus der CDU/CSU-Fraktion, die sich mit der Mehrheit im Parlament für den Zusammenschluß der drei südwestdeutschen Länder einsetzten. „Föderalismus – ja! Aber Föderalismus in einer Weise, die von der jungen und der künftigen Generation in Deutschland angenommen wird.“ In diesem Verständnis focht er auch später für den Bundesstaat, der – Montesquieu hatte das Stichwort gegeben – die Vorzüge des kleinen und des großen Staatswesens miteinander verbinde. Ein verläßlicher Anhänger Konrad Adenauers, zeigte er sich bei Bewahrung der eigenen Unabhängigkeit doch wenig gefügig, wenn eine Entscheidung seinen Vorstellungen nicht entsprach. Einen ersten harten Strauß focht der Nachwuchspolitiker mit dem Kanzler aus, als es um die Wahl des ersten Bundespräsidenten ging. Eine der SPD stärker entgegenkommende Lösung wäre Kiesinger willkommener gewesen als die von Adenauer befürwortete Wahl von Theodor Heuss. Hatte er hier keinen Erfolg, so doch in der wichtigen Frage der Wahl der Richter am Bundesverfassungsgericht, für die er des überparteilichen Ausgleichs wegen Zweidrittelmehrheiten im Bundestag und Bundesrat forderte. Sein entschiedener Einsatz für die vom Gesetzgeber beschlossene Lösung, die heute noch gilt, brachte ihm Anerkennung auch bei der Opposition. Allseitige Bewunderung aber erntete er für die brillanten Reden, mit denen er des Kanzlers Außenpolitik mitformte, erläuterte, begründete und ihr als „Degen“ des Kanzlers zum parlamentarischen Durchbruch verhalf. Kiesinger entwickelt sich rasch zu einem der ersten Sachkenner in der deutschen Außenpolitik. Er hat jene Verträge entscheidend mitgetragen, mit denen die Bundesrepublik in die Gemeinschaft der Völker der freien Welt eingetreten ist, überzeugt, daß sie sonst in den Sog der auch im Zeichen der „Koexistenz“ nur taktisch abgewandelten, nicht grundsätzlich geänderten bolschewistischen Machtpolitik geraten könnte. Der Kanzler und seine Partei würdigten es durch Übertragung des Vorsitzes im Bundestagsausschuß für Auswärtige Angelegenheiten (1954-1959) und durch Berufung in die Beratende Versammlung des Europa-Rates, deren Vizepräsident er wurde. Er gehörte auch dem Vermittlungsausschuß nach Artikel 77 Absatz 2 GG an, dessen Vorsitzender er turnusmäßig zeitweise war. Im September 1955 begleitete er zusammen mit anderen führenden Parlamentariern den Kanzler nach Moskau, wo es zu Absprachen über die Heimkehr der Kriegsgefangenen kam. Kiesinger gehörte zu den Befürwortern der heiß umstrittenen Entscheidung, diplomatische Beziehungen zur Sowjetunion aufzunehmen, die Voraussetzung für deren Heimkehr war. Ein Ministeramt hat der Kanzler ihm nicht übertragen. Als Kiesinger Ende 1958 als Ministerpräsident nach Baden-Württemberg ging, entstand in Bonn eine empfindliche Lücke. „Bonn ist ärmer geworden“, kabelte Herbert Wehner. Diese Entscheidung fiel Kiesinger nicht leicht, obwohl sie ihm die lange erstrebte finanzielle Absicherung brachte. Als entscheidendes Argument teilte er dem widerstrebenden Kanzler mit, „daß ich endlich auch einmal regieren möchte“. Daran ließ er in den kommenden Jahren keinen Mangel. Kiesinger brachte seine Hochschätzung der Bundesländer, nicht als bloße Verwaltungsprovinzen, sondern als einer wesentlichen Basis vor allem der kulturellen Entwicklung, voll zum Tragen. Aufbauend auf dem Fundament, das die nüchtern haushaltende Politik seines Vorgängers Gebhard Müller geschaffen hatte, räumte er neuen Zielen Priorität ein. Zur Reform des Bildungswesens verwandte seine Politik, die er ab 1960 in einer Koalition von CDU und FDP/DVP unter Ausschluß der SPD verwirklichte, größte Energien und Mittel nicht nur an den Ausbau der Schulen, Fachschulen und Fachhochschulen, sondern auch an die Hochschulen. Sie führte zur Neugründung von Universitäten in Konstanz und Ulm, zu einem großzügigen Ausbau der anderen Hochschulen und löste Reformen besonders im zweiten Abschnitt seiner Regierungstätigkeit aus. In großangelegten Ansprachen, denen er seinen persönlichen Stil aufprägte, entwickelte er eine Schau der landespolitischen Probleme, in der die Landschaften und ihre Geschichte, Rang und Würde der kleineren Städte, ihr Anspruch auf Urbanität und kulturelles Leben eine wichtige Rolle spielen. Einem zerstörerischen Eingriff in die Landschaft, wie dem seit langem geplanten Ausbau des Hochrheins als Schiffahrtsstraße bis zum Bodensee, gab er seine Zustimmung nicht. Die Universitätsgründungen, mit deren Gelingen oder Scheitern sein Ansehen sich mehr und mehr verknüpfte, hatten, neben den drängenden Problemen der Hochschulen, hier ihre Wurzeln. Die Regierungserklärung Kiesingers vom 25. Juni 1964 enthielt ein umfassendes innenpolitisches Konzept, für eine Landesplanung im weitesten Sinne, für die Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen und der Kulturlandschaft, für wirtschaftliche und finanzpolitische Fragen, besonders aber der Bildungspolitik. Deren Ziel war die Modernisierung des Bildungswesens, damit es den Anforderungen der demokratischen Gesellschaft eines großen Industrielandes entspreche. Die weit vorgreifenden Absichten fanden breite Zustimmung im Parlament. Ein Instrumentarium der Bildungsplanung wurde unter Beteiligung der Wissenschaft geschaffen. Der 1964 berufene Kultusminister Wilhelm Hahn, Professor der protestantischen Theologie, der schon im Bundestag und als Rektor der Universität Heidelberg hervorgetreten war, trug die ehrgeizigen Zielsetzungen voll mit. Die Regierung bekannte sich zur Reform des ländlichen Schulwesens mit dem Ziel einer in Jahrgangsklassen gegliederten Hauptschule. Dieses Ziel konnte im Landesteil Südwürttemberg-Hohenzollern nur um den Preis des konfessionellen Elternrechts und des Wegfalls der öffentlichen Konfessionsschule erreicht werden. In dem schweren Konflikt, in dem die CDU den in der Verfassung erkämpften Status quo der Volksschule in diesem Landesteil zur Disposition stellen mußte, enthielt Kiesinger, vor eine Gewissensentscheidung gestellt, sich noch des letzten Urteils. Die rechte Erziehung der Kinder in der Volksschule und im Gymnasium stand im Mittelpunkt seiner Sorgen, und er wußte, daß sie allein mit Rezepten für Schulformen und Lehrpläne nicht bewirkt werden konnte. Am Grundsatz des Elternrechts hielt er fest und verteidigte ihn unter Androhung des Rücktritts, aber er verschloß sich nicht absolut Auslegungen, die diesem Recht einen gewandelten Inhalt unterlegten. Sicher entsprach seiner Natur die ausgleichende Lösung der Verfassung besser als jede denkbare, zwangsläufig einseitige Neuerung. Einer endgültigen Entscheidung wurde er enthoben durch die Wahl zum Bundeskanzler. Der Nachfolger Hans Filbinger durchschlug in einer neuen Koalition von CDU und SPD den gordischen Knoten durch eine Verfassungsänderung, die in Südwürttemberg-Hohenzollern Bekenntnisschulen nur noch als staatlich geförderte private Volksschulen ermöglicht. In jenen Jahren hatte das Land Baden-Württemberg die Phase seiner umstrittenen Gründung hinter sich gelassen. Aber der Kampf um den Südweststaat war nicht vergessen, und nicht wenige Kräfte in Baden forderten noch immer die Loslösung dieses Landesteils. Ein vom Bundesverfassungsgericht 1956 zugelassenes erfolgreiches Volksbegehren lastete wie ein Faustpfand auf dem Land. Der zur Entscheidung berufene Bund versagte sich. Zu eng war jede Entscheidung verwoben mit den Existenzproblemen anderer Bundesländer. Auf der Basis des Grundgesetzes, das kein Selbstbestimmungsrecht regionaler Bevölkerungen kannte, sondern eine Gesamtkonzeption der Neugliederung für das ganze Bundesgebiet forderte, eine Neugliederung aus einem Guß, war der Wille der badischen Bevölkerung, sofern sie ein selbständiges Baden wollte, nicht durchzusetzen. Rasch faßte Kiesinger den Gedanken, das Problem aus seinem alten bundesstaatsrechtlichen Zusammenhang herauszulösen. Über eine faire und gerechte Abstimmung das Land zu befrieden, das war der Kern seines Vorschlags, das Grundgesetz zu ändern. Er machte ihn offiziell zum ersten Mal am 7. Juni 1960, also bald nach seinem Amtsantritt und verfocht ihn hartnäckig über alle Hürden hinweg. Erst zehn Jahre später, am 7. Juni 1970, wurde in Baden abgestimmt, auf einer vom Bundesgesetzgeber 1969 geschaffenen Basis, die diesem Vorschlag sehr nahe kam. Die Abstimmung besiegelte den Fortbestand des Landes. Der Gedanke der Grundgesetzänderung, anfangs kühn und wenig realistisch erscheinend, hatte sich schließlich durchgesetzt. Der Schritt allerdings, der 1960 eine großartige Geste der Versöhnung mit dem politischen Gegner gewesen war, gerichtet auf die Wiederherstellung verletzten Rechtsgefühls, konnte 1970 nicht mehr mit der gleichen Kraft wirken. Eine Fehlentscheidung, ein Unrecht von 1952 – wenn es denn eines war – konnte nicht durch eine Volksabstimmung 18 Jahre danach ungeschehen gemacht werden. Sie brachte dennoch einen befreienden Abschluß und machte deutlich, daß die junge Generation das Land angenommen hatte. Man darf das nicht zuletzt der weitschauenden, die Rolle aller Landesteile sorgsam respektierenden Politik dieses Ministerpräsidenten zuschreiben, wie dies Reinhold Maier in seinen Erinnerungen anerkennend tat. Während in Baden-Württemberg die Schulfrage noch der Lösung harrte, spitzte sich in Bonn die seit dem Ende der Ära Adenauer schwelende Krise zu, welche die Regierung Erhard, noch immer eine Koalition von CDU/CSU und FDP/DVP, nicht meistern konnte. Mit dem Eintritt der SPD in die Regierung hoffte man sie überwinden zu können. Die CDU/CSU entschied sich zwischen den Alternativen Schröder, Gerstenmaier und Kiesinger für diesen als ihren Kanzlerkandidaten. In einem Kabinett der rivalisierenden, aber auch gut kooperierenden Stars aus den drei großen Parteien versprachen seine Beweglichkeit und seine großen Fähigkeiten zum Ausgleich – Strauß spricht von seiner unermüdlichen Geduld und schier unbegrenzten Fähigkeit, Verhandlungen mit größtem Gleichmut zu führen – am ehesten Erfolg. In der Tat gelang es ihm, diese Koalition zustande zu bringen, und er konnte sie bis zum Ende der Legislaturperiode im Oktober 1969 halten. Die Kompetenz, die Richtlinien der Politik zu bestimmen, konnte in diesem Kabinett nicht das gebräuchliche Instrument zur Konfliktbewältigung sein, sie kam allenfalls, mit dem Risiko des Scheiterns, als ultima ratio in Betracht. Kiesinger ließ es darauf nicht ankommen. Im Parlament korrelierte mit der Regierungsarbeit ein gutes Arbeitsverhältnis zwischen den Fraktionsvorsitzenden Rainer Barzel und Helmut Schmidt. Zu den Leistungen dieser Regierung, in der von der CDU/CSU besonders Lücke, Katzer, Schröder, Strauß, Höcherl und Stoltenberg, von der SPD Brandt, Heinemann, Schiller, Leber, Wischnewski, Eppler, Wehner und Carlo Schmid wichtige Positionen einnahmen, gehört die wirksame Bekämpfung der Wirtschafts- und Haushaltskrise, verbunden mit der Schaffung eines Instrumentariums für die Stabilität und die Anpassung der Haushaltspolitik an die wirtschaftspolitischen Bedürfnisse. Schon 1967 konnte, im Gegensatz zu den Vorjahren, ein ausgeglichener Haushalt vorgelegt werden. Die Finanzreform, beschlossen im April/Mai 1969, schuf die Voraussetzungen für eine den Bedürfnissen angepaßte Aufgabenverteilung zwischen Bund und Ländern und stellte mit den „Gemeinschaftsaufgaben“ neue Formen der Zusammenarbeit zur Verfügung. Sie änderte das System der Steuerverteilung zugunsten der steuerschwachen Länder und Gemeinden und verbesserte die Finanzausstattung der Gemeinden. Der Gedanke des kooperativen Föderalismus wurde verfassungskräftig ausgestaltet. Die im Juni 1968 verabschiedeten Notstandsgesetze beendigten einen Streit, der bis zuletzt den inneren Frieden bedroht hatte. Die in der Koalition vereinbarte Grundgesetzänderung hat 28 Verfassungsartikel eingefügt, geändert oder gestrichen. Der Regierungsentwurf, der auf Beratungsergebnissen des 4. Bundestages fußte, wurde allerdings in wichtigen Punkten geändert, namentlich durch Einführung eines Widerstandsrechts. Auf dieser Grundlage ergingen weitere Notstandsgesetze. Der großen Koalition gelang die Behebung der im Gefüge der parlamentarischen Demokratie aufgebrochenen Krise. Das Fehlen einer starken Opposition wird freilich auch als Negativposten gewertet angesichts der in jenen Jahren – zum Teil in Gewaltakten – sich entladenden gesellschaftspolitischen Krise, die vor allem die junge Generation erfaßte. Die kritische Jugend hatte „keine kraftvolle parlamentarische Vertretung mehr“ (Klaus Mehnert), sie war auf dem Weg, zu einer außerparlamentarischen Opposition zu werden. Der Pariser Mai 1968, der weit über Deutschland hinaus ein Alarmzeichen war, liegt genau in der Mitte von Kiesingers Regierungszeit. Von nachhaltiger innenpolitischer Wirkung war der Verzicht auf eine Änderung des Wahlrechts, welche die CDU/CSU schon bei der Regierungsbildung in Verfolg früherer Bemühungen anstrebte und die auch in der SPD Befürworter fand (Wehner). In den Koalitionsvertrag ging die Absicht, die Mehrheitswahl einzuführen, nicht ein; es blieb bei einem „Gentleman’s Agreement“ (Strauß), dessen Verwirklichung an der SPD scheiterte. Der Rücktritt von Innenminister Paul Lücke, des stärksten Anhängers des Mehrheitswahlrechts, an dessen Stelle am 2. April 1968 Ernst Benda trat, markiert das Ende dieser Bestrebungen. Außenpolitisch wurde mit der Notstandsverfassung durch Wegfall von Vorbehaltsrechten die Souveränität der Bundesrepublik im Verhältnis zu den westlichen Alliierten gestärkt. Darüber hinaus wurde eine Entwicklung eingeleitet, die von Seiten der SPD als „Öffnung gegenüber unseren östlichen Nachbarstaaten“ charakterisiert wird. Die Regierungserklärung versprach eine Normalisierung der Beziehungen zu Osteuropa. Die Koalition bereitete den weitergehenden Schritten der nachfolgenden Regierung Brandt/Scheel den Weg, wie überhaupt die Regierung Kiesingers zwar nicht eine „Übergangsregierung“ war, aber im Verständnis der Sozialdemokraten doch eine Basis für die nachfolgende Übernahme noch größerer Verantwortung durch diese. Eine abrupte Änderung der Außenpolitik trat nicht ein, aber doch eine allmähliche Anpassung an die internationale Entwicklung mit den Ansätzen einer neuen elastischen Ostpolitik, die der Außenminister Brandt nun vorbereiten konnte, um sie später als Kanzler mit den Verträgen von Warschau und Moskau und mit dem Grundlagenvertrag mit der DDR durchzusetzen. Kiesinger war überzeugt, daß die Einheit Deutschlands nicht erreicht werden konnte durch Zwietracht der ehemaligen Siegermächte, im Konflikt mit der Sowjetunion. Er erwartete sie von einer zunehmenden Übereinstimmung der Mächte und einem „vernünftigen“ deutsch-sowjetischen Verhältnis. Die Wiedervereinigung Deutschlands bedeutet ihm nichts anderes als den großen Friedensschluß in Europa. Die spätere Entwicklung hat das voll bestätigt. In seine Regierungszeit fällt der Einmarsch der Sowjetunion und anderer Ostblockstaaten in die Tschechoslowakei im August 1968. Es überraschte ihn nicht, daß die Sowjets massiv eingriffen, als die Reformer in Prag die Grenze zwischen Demokratie und Kommunismus überschritten. Das entsprach vielmehr seiner Überzeugung, daß es einen freiheitlichen Kommunismus nicht gibt. Das Verhältnis zu den USA war durch das Zusammenwirken der beiden Supermächte in den Vorverhandlungen über einen Atomwaffensperrvertrag gleich zu Beginn der Regierungszeit Kiesinger/Brandt stark belastet. Man befürchtete eine Verfestigung des globalen und des europäischen Status quo einschließlich der überlegenen Waffen beider Supermächte. Das mit den Verbündeten zunächst nicht abgestimmte Vorgehen der USA brachte Gefahren für die Nato und für die europäische Einigung, auch die Gefahr wirtschaftlicher und industrieller Nachteile für die Bundesrepublik in der friedlichen Nutzung der Kernenergie. Kiesinger drängte auf gründliche Konsultierung und Rücksichtnahme auf die Interessen der Bündnispartner. Er befürwortete als Maxime durchaus eine Politik der Entspannung, aber ohne Vernachlässigung der Aufgaben der Nato. Die USA, Großbritannien und die Sowjetunion schlossen den Vertrag ohne Beteiligung der Atommächte Frankreich und China am 1. Juli 1969. Erst Kiesingers Nachfolger Brandt, wie auch zahlreiche andere Staaten, vollzog am 28. November 1969 den Beitritt der Bundesrepublik. Ebenso wie im Verhältnis zu den USA gelang Kiesinger die Überbrückung kritischer Phasen auch gegenüber Frankreich, wo die eigenständige Politik de Gaulles Gefahren für die europäische Gemeinschaft brachte. Der General zeigte Interesse an einer „ohne zu großen Ehrgeiz in Grenz- und Rüstungsfragen“ erfolgenden deutschen Wiedervereinigung bei Verzicht Deutschlands auf atomare Bewaffnung. Kiesinger hielt die Zeit nicht für gekommen, diesen Gedanken aufzugreifen. Schritte zum Kontakt mit den Machthabern im „anderen Teil Deutschlands“ und zu innerdeutschen Regelungen waren äußerst behutsam. Eine Initiative des Vorsitzenden des Ministerrats der DDR, Willi Stoph, wurde – in Abstimmung mit dem Koalitionspartner – reserviert in der Form, die jeden Anschein einer Anerkennung der DDR als souveränen Staates mied, aber nicht ohne sachliche konstruktive Ansätze am 13. Juni 1967 beantwortet. Gespräche über praktische Fragen des Zusammenlebens der Deutschen sollten ohne politische Vorbedingungen durch Beauftragte aufgenommen werden. „Die Realität, die Sie und ich anerkennen müssen, ist der Wille der Deutschen, ein Volk zu sein.“ Das war seine Antwort auf die Aufforderung Stophs, von den „Realitäten“ auszugehen. Das Ende der Kanzlerschaft Kiesingers war zugleich, bis 1982, das Ende einer CDU/CSU geführten Bundesregierung. Die CDU erreichte bei der Wahl am 28. September 1969 die von Kiesinger angestrebte absolute Mehrheit nicht. Die Sozialdemokraten, im stetigen Aufstieg seit 1953 und in der erstmals übernommenen Regierungsverantwortung gestärkt, gewannen 22 Mandate hinzu, blieben aber noch immer 3,4 Prozentpunkte hinter der Union zurück (42,7:46,1). Die rechtsradikale Nationaldemokratische Partei (NPD), die bereits in einige Landesparlamente eingezogen war, konnte mit 4,3 % der Stimmen den Sprung in den Bundestag nicht schaffen; sie schmälerte aber die Wahlchancen der CDU/CSU. Die Koalition mit der SPD fortzusetzen, war das Anliegen nicht nur von Kiesinger und Strauß, es fand auch Unterstützung bei Herbert Wehner. Aber Brandt und Scheel entschieden sich noch in der Wahlnacht für das Wagnis eines neuen Bündnisses. Dieses hatte sich freilich seit längerem vorbereitet und als eine Möglichkeit präsentiert in der Wahl von Gustav Heinemann zum Bundespräsidenten, die am 5. März 1969 mit den Stimmen von SPD und FDP erfolgt war. Die Gefahr, die der FDP von der in der Union seit langem erwogenen Einführung des Mehrheitswahlrechts drohte, mag dafür mitbestimmend gewesen sein. Ob Kiesinger durch großzügige Angebote das neue Bündnis hätte abwenden können, ist umstritten. Strauß: „Wir standen vor der Tatsache eines längst beschlossenen Bündnisses“. Vielleicht hat Kiesinger die Gefahr dieser Weichenstellung, für die eine Neuorientierung der FDP gerade in der Außenpolitik und der Wechsel ihrer Führung von Mende zu Scheel eine wichtige Grundlage war, nicht rechtzeitig voll eingeschätzt. Henry Kissinger, außenpolitischer Berater des amerikanischen Präsidenten, der die Regierungsfähigkeit der Sozialdemokraten als großen Gewinn für die Demokratie in Deutschland wertete, sah Kiesinger während der Koalition bereits in der Falle, weil der Gegenspieler, Vizekanzler und Außenminister, von Tag zu Tag mächtiger wurde. Er sieht Kiesingers politisches Schicksal wie einen Zufall, bedingt durch einen Kniff, eine Spitzfindigkeit (a quirk) des Wahlgesetzes. (The White House Years, p. 99). Das war es freilich nicht. Es ging schlicht um das Problem der Mehrheit und der Mehrheitsbildung. Kiesinger blieb der CDU, deren Vorsitz er bis 1971 behielt und deren Ehrenvorsitzender er danach war, als eine ihrer markantesten Stützen im Bundestag treu. Zu den Grundsatzerklärungen, die er für die Union in jener Zeit abgab, gehört sein Plädoyer für das Mißtrauen gegenüber Kanzler Brandt und für die Übernahme der Kanzlerschaft durch Rainer Barzel, seinen Nachfolger im Parteivorsitz, am 27. April 1972. Das Scheitern dieser Initiative verwies, ebenso wie die nachfolgenden Wahlen, die Union für weitere 10 Jahre auf die Bänke der Opposition. Man kann Wilhelm Hahn uneingeschränkt zustimmen, wenn er sagt, Kiesinger falle aus dem Rahmen der Personen heraus, die das politische Geschäft betreiben, und wenn er ihn eine künstlerische Persönlichkeit, einen philosophischen Kopf nennt. In der Tat ließ Kiesinger sich immer wieder gefangennehmen von der Suche nach einem übergeordneten Standort. Dies ließ ihn auch fragen nach der Stellung des Menschen im modernen Kulturprozeß, und ob dieser Prozeß sich überhaupt noch steuern lasse. Der Wissenschaft und ihren Dienern fühlte er sich zu Dank verpflichtet. Aber ihre wohltätige Macht blendete ihn nicht. Erschreckt von ihren ungeheuren Möglichkeiten sah er, nicht nur für die Atomtechnik, daß die Wissenschaft die Politik vor Entscheidungen stellen werde, deren Schwere, Ernst und Konsequenz alles übertreffen werden, was in der Gesellschaft jemals zu entscheiden war. Das sagte er 1964 für die damals sich ankündigende Gentechnologie, die „biologische Ingenieurkunst“, wie er es nannte. Mehr als den Rat und die Hilfe der Wissenschaft und das Wissen von der schöpferischen und zerstörenden Macht der Wissenschaft dürfe der Politiker von dieser nicht erwarten. (Politik und Geist, in: Ideen vom Ganzen). Solche Sätze enthalten etwas Prophetisches. Sie mögen auch Sendungsbewußtsein anzeigen. Aber er wies utopische Beglückung von sich, und, wieder und wieder an die Geschichte knüpfend, erinnerte er daran, diese Versuchung habe Schlimmeres angerichtet als bloße Machtgier. Was er für sein eigenes Wirken suchte, war ein gelassenes Verhältnis zur Macht und zu den eigenen Möglichkeiten. Wer dieses hätte, Demut und Humor in einem, illusionslose Liebe zum Nächsten und den Willen und die Kraft zum strengen, entsagungsvollen Dienst am Ganzen, so schrieb er, „den dürften wir für berufen halten“. Dieses Bekenntnis bewahrte ihn gewiß nicht vor Anfechtungen des Glanzes und der Macht. Freude am wirkungsvollen Auftritt und am Umgang mit – nicht notwendig gleichgesinnten, aber – ebenbürtigen Geistern ebenso wie mit den Großen der Welt verbarg er nicht. Kein Verächter des Zeremoniells, genoß er die dem Chef einer Regierung zukommende Last und Lust zu repräsentieren, verstanden nicht als Entfaltung von Pomp und Prunk, wohl aber als willkommener Anlaß, Rang und Gewicht des Staates und der eigenen Politik in nobler, mitunter festlicher Eleganz darzubieten. Dem sicheren öffentlichen Auftreten, mit Charme und scheinbar ohne Mühe bewältigt, ging nicht selten harte Vorarbeit voraus. Hohe Konzentration und Disziplin waren dazu nötig. Regieren und Repräsentieren gingen in eins, dieses Form, jenes Inhalt. Daß er als Vertreter eines Souveräns erschien, des Volkes, das jetzt die Stelle der Fürsten einnahm, verstand er bewußt zu machen. Das wiedererbaute Neue Schloß zu Stuttgart nahm der Ministerpräsident gerne als geeigneten, aber auch unentbehrlichen Rahmen der Repräsentation. Hier empfing er, neben vielen Abgesandten anderer Länder, 1965 Königin Elisabeth II. von England, deren herrscherliche Würde ihn beeindruckt hat und von der er zu lernen bereit war. Den privaten Hausstand in eine Amtswohnung des Ministerpräsidenten, die zu vertraulichen Gesprächen zur Verfügung stünde, auszuweiten, vermied er. Kritik, die persönlicher Aufwand auslösen konnte, wollte er in keinem Falle provozieren. In der Lebensführung blieb er auch im Wohlstand genügsam und suchte so oft wie möglich das Gespräch mit den Bürgern. Die Beliebtheit, die er bei ihnen bemerkte, erfreute ihn, und auf das kritische Wort eines einfachen Mannes gab er trotz mancher Zufälligkeit, in der es gesprochen war, mehr als auf abgewogene Berichte aus den Amtsstuben, wenn sie seiner praktischen Erfahrung widersprachen. Freundliches Entgegenkommen, das er in solchen Begegnungen bezeigte, übertrug er nicht in den Amtsbetrieb, wo es nicht leicht fiel, seinen anspruchsvollen, stets davoneilenden Vorstellungen nachzukommen. Mitarbeitern, auf deren Verständnis er rechnen durfte, zeigte er sich als ein geduldiger, aber immer nach Verfeinerung, manchmal auch als ein nach Perfektion strebender Gesprächspartner, gelegentlich auch als ungehalten aufbrausender, herrischer Lehrmeister. In geselliger Runde ein humorvoller, gewinnender Gesprächspartner, wußte er aus einem reichen Schatz des Wissens und des Erlebten Liebenswertes, Anekdotisches und Wundersames aus der weiten Welt und aus der Heimat vergnüglich zu erzählen. Die Palette der Gemütsstimmungen, die er nicht verbarg, war so vielseitig und unbegrenzt wie der Reichtum seines Wissens und seiner Gedanken. Die Kanzlerschaft soll er getragen haben „wie einen Hermelin“. Ein solches Wort, einmal gut erfunden, macht schnell die Runde, ungeachtet seines nur beschränkten oder fallbezogenen Wahrheitsgehaltes, und es gibt zeitgenössische Schilderungen, die sich genüßlich in Konkretisierungen solcher Einfälle ergehen. In seinen aufs gründlichste vorbereiteten Reden war der Gang der Gedanken wohl abgestuft; auf einen den Zuhörer sorgsam führenden Aufbau verwandte er ebenso kritische, zähe Arbeit wie auf die Wahl der Formulierung, die präzis und häufig in gehobener Sprache gehalten war. Pathos klang stärker an, als Jüngeren, die nicht in gleicher Weise den Klassikern verbunden, vertraut und willkommen sein mag. So hart er in der improvisierten Debatte, bis zur Polemik, zupacken konnte, den Gegner nicht schonend, so sehr war er bemüht, in den programmatischen Erklärungen Schärfe zu vermeiden und ihnen eine über den Tag hinausreichende Bedeutung zu verleihen. Stil und Form waren ihm untrügliche Anzeichen und Bestandteil sachlicher Aussage. Das Verständnis des Auditoriums überforderte er, so differenzierte Möglichkeiten des Ausdrucks ihm zu Gebote standen, nie. Henry Kissinger, nicht eben wohlwollend, meint, selbst das Banale habe Kiesinger mit dem Ausdruck von Bedeutung zu sagen gewußt (with an air of great profundity). Dieser wählte aber den jeweils angemessenen Ausdruck und vermied jede Umständlichkeit und Feierlichkeit, wo sie nicht angezeigt war, ließ den Ausdruck auch nicht in eine Schablone zwingen. Urheber solcher Formulierungen bedachte er mit Groll, Spott oder Mitleid. Nicht von ungefähr gehört Kiesinger zu den Politikern, deren Sprache man sorgsam darauf abklopft, was sie wohl über den Urheber verrate, und kritische Analysen bemühen sich um die Deutung von Charakter und Naturell. Die Leistung Kiesingers als Staatsmann wird die Geschichtsschreibung wohl zuerst an seiner Kanzlerschaft messen. Obwohl von relativ kurzer Dauer, brachte diese der Bundesrepublik doch die dringend notwendige innere Festigung und eine Stärkung der außenpolitischen Positionen. Gewichtige Stimmen erkennen dies an. Im Urteil des späteren Kanzlers Helmut Schmidt hat in der Person Kiesingers die politische Situation der zweiten Hälfte der sechziger Jahre ihren angemessenen Ausdruck gefunden. Das mag für die innenpolitischen Probleme ebenso gelten wie für die Außenpolitik. Kiesinger verstand sich nicht als Repräsentant einer „Kanzlerdemokratie“, sondern – zwangsläufig – eher einer Parteiendemokratie, wenn es ihm auch nicht lag, um die Gunst der Parteien zu buhlen und Grundsätzliches dafür aufzugeben. „Enfin un homme d’état allemand, avec lequel on peut parler comme avec Adenauer.“ Das äußerte Charles de Gaulle beim Amtsantritt Kiesingers gegenüber dem deutschen Botschafter. Hoch zu veranschlagen ist aber auch das, was Kiesinger für Baden-Württemberg, für seine Landschaften, für die Integration seiner Teile, für Kultur und Bildung und für seine Wirtschaft und Landwirtschaft geleistet hat. Lange, bevor Umwelt und Umweltschutz gängige Vokabeln wurden, besann er sich auf die Grenzen des Wachstums. Mit großen Anstrengungen für die Reinhaltung der Gewässer, für den Schutz der Naturlandschaft und der Kulturlandschaft kündigte sich während seiner Regierung, weit über das Land hinaus wirksam, ein Wandel des Denkens an, weg von einem aus der Not der Nachkriegszeit verständlichen Vorrang der ökonomischen Zwänge hin zu einer umfassenderen Schau. Kiesinger war einer der ersten, die diesen Weg wiesen. Im Verzicht auf die Schiffbarmachung des Hochrheins bis Konstanz, für den sein Name steht, in diesem bewußten und politisch schwierigen Verzicht auf die Verwirklichung eines lange gehegten Traumes, offenbart sich dieser Wandel. |
|---|---|
| Werke: | Jugend 1926, Aufsatz in: Berliner Zeitung „Germania“ vom 28.12.1928, abgedruckt in: Oberndörfer, Begegnungen (siehe Literatur) S. 79-81; Die Prognosen des Grafen Alexis de Tocqueville am Beginn des industriellen Zeitalters. Vortrag gehalten bei der Jahresfeier am 3.12.1960 (Karlsruher Akademische Reden NF Nr. 19) Karlsruhe 1961 = (ohne Anmerkungen) SV-Schriftenreihe zur Förderung der Wissenschaft 1961/V. Zwei Prognosen, S. 5-17, Hg. Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft; Staatsbürgerliche Erziehung und internationale Verständigung, 1. Aufl. Konstanz 1963 (Schriftenreihe des Internationalen Instituts Schloß Mainau Band 6 (deutsch und englisch) Überarbeitete Fassung in: Wilhelm Hahn/Kurt Georg Kiesinger, Bewältigte Vergangenheit und Zukunft, 1. Aufl. 1966, Konstanz 1966; Ideen von Ganzem. Reden und Betrachtungen, Tübingen 1964; Entspannung in Deutschland, Friede in Europa, Reden und Interviews 1967, hg. vom Presse- und Informationsamt der Bundesregierung, o. J.; Politik der Verantwortung, Sonderdruck aus dem Bulletin des Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung Nummer 129/1967 (Rede am 4. November in Pirmasens); Aufgaben der Politik im modernen Verhältnis von Staat und Wirtschaft, in: Spannungsfeld Staat und Wirtschaft, Hg.: Deutscher Industrie- und Handelstag, Bonn 1968, 15-32; Verantwortung für die Zukunft der deutschen Nation. Bericht der Bundesregierung über die Lage der Nation im geteilten Deutschland, Sonderdruck aus dem Bulletin des Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung Nummer 33/1968 (158. Sitzung des Deutschen Bundestages am 11.3.1968); Die große Koalition 1966-1969. Reden und Erklärungen des Bundeskanzlers, Stuttgart 1979 (hg. von Dieter Oberndörfer); Die Stellung des Parlamentariers in unserer Zeit. Festvortrag aus Anlaß der Konstituierenden Sitzung der Vereinigung ehemaliger Mitglieder des Landtags von Baden-Württemberg am 24.3.1981 in Stuttgart, Neues Schloß; Privater Rechtslehrer 1933-1945 in Berlin, in: Die Freiheit des anderen. Festschrift für Martin Hirsch, hg. von Hans-Jochen Vogel, Helmut Simon, Adalbert Podlech, Baden-Baden 1981; Anthropologische Voraussetzungen der Politik, in: Hans Filbinger, Ein Mann in unserer Zeit, Dießen 1983, 29-33; Auswahl-Bibliographie bei Oberndörfer (siehe Literatur); Führung und Verantwortung, Festgabe des Landtags von Baden-Württemberg für Bundeskanzler a. D. und Ministerpräsident a. D. Dr. Dr. h. c. Kurt Georg Kiesinger, Stuttgart 1984 (Interview mit dem Intendanten des Süddeutschen Rundfunks, Professor Dr. Dr. h. c. Hans Bausch). |
| Nachweis: | Bildnachweise: Fotos in zahlreichen Quellen, bes. den FS und Interview Süddeutscher Rundfunk (siehe Werke und Literatur); Gemälde v. Ruth Heppel im Staatsministerium Stuttgart (Villa Reitzenstein). |
Literatur + Links
| Literatur: | Der Kampf um den Südweststaat. Verhandlungen und Beschlüsse der gesetzgebenden Körperschaften des Bundes und des Bundesverfassungsgerichts, München 1952 (Veröffentlichungen des Instituts für Staatslehre und Politik e. V. in Mainz), bes. 228-230, 422-426; Führung und Bildung in der heutigen Welt. Festschrift für Ministerpräsident Kurt Georg Kiesinger, hg. zu seinem 60. Geburtstag am 6.4.1964, Stuttgart 1964; Helmut Reuther, Kurt Georg Kiesinger. Lebensbild eines Politikers 1967; Heli Ihlefeld, Kiesinger-Anekdoten, 1967; Alfred Grosser, Die Bundesrepublik Deutschland, Bilanz einer Entwicklung, Tübingen 1967; W. F. Hanrieder, West German policy, 1949-1967, Stanford (Cal.) 1967; Eberhard Konstanzer, Die Entstehung des Landes Baden-Württemberg, Stuttgart 1969, bes. 216-230; Klaus Hoff, Kurt Georg Kiesinger. Die Geschichte eines Lebens, 1969; Paul Schallück, Die Sprache Kurt Georg Kiesingers, in: Schriftsteller testen Politikertexte, hg. von Hans Dieter Baroth, 1967, S. 131-145; Karl Kaiser, German foreign policy in transition. Bonn between East and West, London 1968; Waldemar Besson, Die Außenpolitik der Bundesrepublik, München 1970; ders., Erlebte Zeitgeschichte, Konstanz 1970; Karl Theodor Freiherr zu Guttenberg, Fußnoten, Stuttgart 1971, 124-164; Carl Carstens, Politische Führung, Stuttgart 1971; Ralf Dahrendorf, Zur Entstehungsgeschichte des Hochschulgesamtplans für Baden-Württemberg 1966/67. Auch ein Beitrag zum Thema des Verhältnisses von Wissenschaft und Politik in Deutschland, in: Bildungspolitik mit Ziel und Maß. Wilhelm Hahn zu seinem zehnjährigen Wirken gewidmet. Beiträge von Hans Filbinger u. a., 1. Aufl. Stuttgart 1974, S. 138-163; Richard Löwenthal, Vom kalten Krieg zur Ostpolitik, in: Die zweite Republik. 25 Jahre Bundesrepublik Deutschland – eine Bilanz, hg. von Richard Löwenthal und Hans-Peter Schwarz, Stuttgart 1974, 604-699. Daselbst, S. 179-202 (197-199): Karl Dietrich Bracher, Die Kanzlerdemokratie; Gerhard Storz, Zwischen Amt und Neigung, Stuttgart 1976, 166-245, bes. 185 f.; Klaus Mehnert, Jugend im Zeitbruch, Stuttgart 1976, 124; Willi A. Boelcke, Die Macht des Radios, Weltpolitik und Auslandsrundfunk 1924-1976, Berlin 1977, 89-107, 306 f.; Paul-Ludwig Weinacht (Hg.), Die CDU in Baden-Württemberg und ihre Geschichte, SpL BW 2, 1978, hier bes.: Uwe Dietrich Adam, 257-292; Alex Möller, Genosse Generaldirektor, München/Zürich 1978, 300-419; Carlo Schmid, Erinnerungen, Bern/München/Wien, 1979, 549, 572 f., 625, 791, 793, 822 f.; Auf den Weg gebracht. Idee und Wirklichkeit der Gründung der Universität Konstanz. Hg. von Horst Sund und Manfred Timmermann, Konstanz 1979; Henry (A.) Kissinger, The White House Years, Clapham/London 1979, 99, 100; Terence Prittie, Kanzler in Deutschland (The Velvet Chancellors. A History of Post-War-Germany), Stuttgart 1981, 149-170 („Die große Koalition: großartig oder nur groß?“); Arnulf Baring, Machtwechsel. Die Ära Brandt/Scheel, 1982; Friedrich Treffz-Eichhöfer, Graswurzeldemokratie, Stuttgart und Zürich 1982, 199-232; Bruno Kaiser, Kurt Georg Kiesinger, in: Walter L. Bernecker/Volker Dotterweich (Hg.), Persönlichkeit und Politik in der Bundesrepublik Deutschland, Bd. 2, 1982, 14-25; Paul Feuchte, Verfassungsgeschichte von Baden-Württemberg, Stuttgart 1983; Andreas Hillgruber, Deutsche Geschichte 1945-1982, 5. Aufl. Stuttgart u. a. 1983, 87-104 („Jahre des Übergangs: 1965-1969“); Dieter Oberndörfer (Hg.), Begegnungen mit Kurt Georg Kiesinger, Stuttgart 1984; Horst Ferdinand (Hg.), Reden, die die Republik bewegten, Freiburg 1988, 135-164; Ein bedeutender Baumeister des Landes und der Republik, in: Staatsanzeiger für Baden-Württemberg Nr. 20 vom 12.03.1988; Christian Hacke, Weltmacht wider Willen, Stuttgart 198, 133-158 („Die Außenpolitik der großen Koalition Kiesinger/Brandt“); Willy Brandt, Erinnerungen, Frankfurt a. M. 1989, 168 f. und öfter bis 328; Michael Kraft, Kurt Georg Kiesinger. „Der ‚vergessene‘ Kanzler“, in: Die politische Meinung 35. Jg. (1990) Nr. 248, 83-87; Paul Feuchte, Politische Einheit als Ziel der Staatsgründung und Auftrag der Verfassung, in: Verwaltungsblätter für Baden-Württemberg 1992, 81, 125, 287, 413, 456; ders., Parlament und Regierung, in: 40 Jahre Baden-Württemberg, hg. von Meinrad Schaab, Stuttgart 1992, 43-71. |
|---|







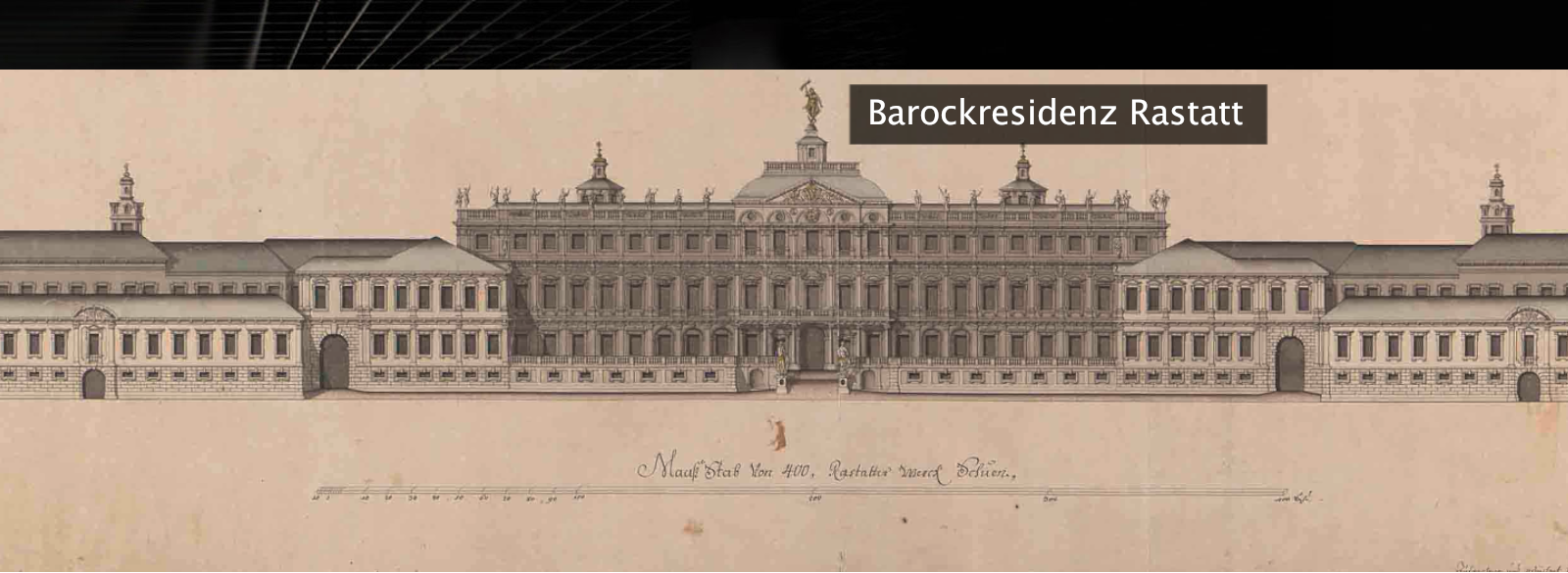



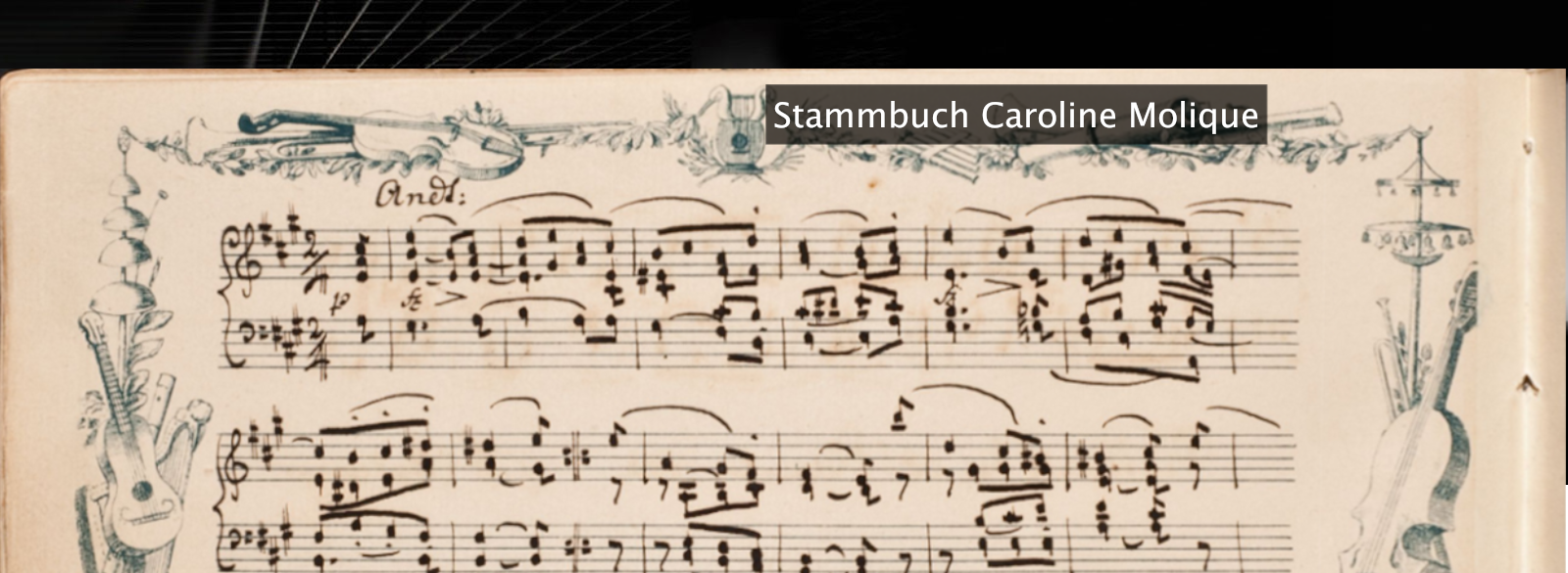





















































 leobw
leobw