Leibholz, Hermann Gerhard
| Geburtsdatum/-ort: | 15.11.1901; Berlin |
|---|---|
| Sterbedatum/-ort: | 19.02.1982; Göttingen |
| Beruf/Funktion: |
|
| Kurzbiografie: | 1919 Abitur in Berlin, anschl. Studium der Philosophie, Rechtswissenschaften und Ökonomie in Heidelberg und Berlin 1921 Promotion bei Richard Thoma in Heidelberg zum Dr. phil.: „Fichte und der demokratische Gedanke“ 1922 I. jur. Staatsexamen 1925 Promotion bei Heinrich Triepel in Berlin zum Dr. iur.: „Die Gleichheit vor dem Gesetz“ 1926 II. jur. Staatsexamen, anschließend Referent am Kaiser-Wilhelm-Institut für Ausländisches Öffentliches Recht und Völkerrecht 1929 ordentlicher Professor in Greifswald 1931 ordentlicher Professor in Göttingen 1935 Beurlaubung von der Professur und Versetzung in die Universitätsbibliothek, Emeritierung 1938 Emigration nach England, Lehrauftrag in Oxford 1947 Lehrauftrag in Göttingen 1951–1971 Richter des Bundesverfassungsgerichts 1958 Erneut ordentlicher Professor in Göttingen |
| Weitere Angaben zur Person: | Religion: evangelisch Auszeichnungen: Ehrungen: Großes Bundesverdienstkreuz mit Stern und Schulterband (1968), Dr. h. c. der Universität Hannover (1981) Verheiratet: 1926 Sabine, geb. Bonhoeffer (1906–1999) Eltern: Vater: William (1868–1933), Generaldirektor der Sommerfelder und Fürstenwalder Tuchfabriken Mutter Regina Nanette, geb. Netter (1874–1922) Geschwister: 2; Hans (1899–1940) und Peter (1903–1971) Kinder: 2; Marianne Regina Nanette Paula Ursula (1927–2017) und Christiane Renate Elisabeth (1930–2008) |
| GND-ID: | GND/118571206 |
Biografie
| Biografie: | Marc Arnold (Autor) Aus: Baden-Württembergische Biographien 7 (2019), 336-341 Nach dem Abitur in Berlin führte Leibholz’ Studium der Philosophie, des Rechts und der politischen Ökonomie ihn nach Heidelberg, wo er bereits im Alter von 19 Jahren bei Richard Thoma, einem der führenden demokratischen Staatsrechtslehrer der Weimarer Republik, zum Dr. phil. promoviert wurde. In Berlin schloss er seine Studien ab und promovierte 1924 über den Gleichheitssatz der Weimarer Verfassung zum Dr. iur. Leibholz leitete darin aus dem Gleichheitssatz des Art. 109 Abs. 1 der Weimarer Verfassung, der an der Spitze des Grundrechtskataloges stand, ab, dass der Gesetzgeber an dieses Gebot im Sinne eines eng auszulegenden Willkürverbotes gebunden sei. Das war aus damaliger Sicht ein Affront gegenüber dem demokratischen Gesetzgeber, bedenkt man, dass in der Weimarer Staatsrechtslehre umstritten war, ob die Grundrechte den Gesetzgeber binden. Unumstritten war lediglich die Gleichheit in der Anwendung der Gesetze. Die Kritik an diesem Werk Leibholz’, das nicht weniger als eine erst aus gegenwärtiger Sicht selbstverständliche Einschränkung des Parlamentssupremats und Unterwerfung unter die Verfassung und die Rechtsprechung bedeutet, findet ihren Ursprung nicht zwangsläufig in einem antidemokratisch- antirepublikanisch geprägten politischen System, sondern vor allem in den Vorbehalten der Demokraten gegenüber vordemokratischen Juristen in der Gerichtsbarkeit. Gleichwohl wurde Leibholz’ Ansatz bereits 1932 zur herrschenden Lehre in den Rechtswissenschaften erhoben, setzte sich in der Rechtsprechung und damit in der tatsächlichen Rechtsanwendung jedoch nur in Ansätzen durch. Hierin zeigt sich der naturrechtliche Einfluss in Leibholz’ Werk. Der Methoden- und Richtungsstreit in den 1920er Jahren war ein Streit der Positivisten und der Naturrechtler, ein Streit über die Frage, ob der Rechtsanwender schematisch an den Gesetzestext gebunden sei oder ob es daneben außer- und übergesetzliche Faktoren gäbe, die das Ergebnis der Gesetzesauslegung beeinflussen, und ob es darüber hinaus übergesetzliche Bindungen des Gesetzgebers gäbe. Hinter dem Gesetzespositivismus, der These, dass allein gesetztes Recht Maßstab des Handelns sei, sollten sich nach 1945 ganze Heerscharen von Juristen verstecken, die im Nationalsozialismus Schuld auf sich geladen hatten. 1926 legte Leibholz die Große juristische Staatsprüfung mit dem Prädikat „gut“ ab. Noch im selben Jahr heiratete er die Zwillingsschwester des Pastors und im April 1945 im Konzentrationslager Flossenbürg ermordeten Widerstandskämpfers Dietrich Bonhoeffer. Von 1926 bis 1929 war Leibholz von seinem Amt als Amts- bzw. Landrichter für eine wissenschaftliche Referententätigkeit am Berliner Kaiser-Wilhelm-Institut für Ausländisches Öffentliches Recht und Völkerrecht beurlaubt, wo er über das faschistische Verfassungsrecht Italiens forschte. Nach seiner Habilitation 1928 bei Heinrich Triepel über „Das Wesen der Repräsentation“ wurde er 1929 an die Universität Greifswald berufen. Seine Antrittsvorlesung über das faschistische Verfassungsrecht Italiens ging zwar mit der allgemeinen zeitgenössischen Lehre, wirkt angesichts der fortschrittlichen Lehre Leibholz’ überraschend unkritisch und fand sich sogar auf einer NS-Liste empfehlenswerter Literatur wieder. Bereits 1931 wurde Leibholz an die Universität Göttingen berufen. Allerdings zeigten sich im Berufungsverfahren schon antisemitische Vorbehalte gegen Leibholz: Die Berufung erfolgte erst nach einer Intervention durch drei Professoren beim Wissenschaftsminister. Zu diesem Zeitpunkt will Leibholz bereits zu seiner Frau gesagt haben: „Es lohnt sich nicht mehr, nach Göttingen zu gehen. Die Dinge gehen hier einen anderen Weg – sie gehen zu Ende.“ (FAZ vom 22.10.1984, S. 11). Einen Appell in diesem Sinne richtete er an sein Publikum bei der Staatsrechtslehrertagung im Jahre 1931: „Aber der wirkliche Kampf ist […] der Kampf zwischen den […] massendemokratischen, den Eigenwert der Persönlichkeit bejahenden Kräfte mit den mythisch fundierten, die Freiheit des Individuums in einem mehr oder weniger radikalen Kollektivismus aufhebenden Bewegungen.“ (Aussprache, 1932, S. 204). Mit dem aufstrebenden Nationalsozialismus und zunehmendem Antisemitismus war auch Leibholz im Göttinger Alltag Anfeindungen ausgesetzt. Zwar war er evangelisch, doch in der NS-Rassenlehre wurde er aufgrund seiner jüdischen Eltern als Jude angesehen, obgleich sie diese Religion nicht praktizierten und ihre Kinder christlich hatten taufen lassen. Als wohlhabende Industriellenfamilie verkörperten sie nicht zuletzt den Idealtyp des NS-Feindbilds. Leibholz fiel jedoch nicht bereits wie viele andere im Jahr 1933 dem Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums zum Opfer. Die darin enthaltene „Frontkämpferklausel“ schützte ihn davor, aus dem öffentlichen Dienst entfernt zu werden: 1919, nach dem Abitur, hatte er sich zu einem dreimonatigen Dienst gegen kommunistische Kräfte in einem Freikorps gemeldet. Wie weit dieser Einsatz Leibholz’ tatsächlich führte, ist indes unklar. In den Folgejahren verhielt er sich nach außen angepasst, leistete den Eid auf den Führer und Reichskanzler, unterzeichnete seine Schreiben an die Universitätsverwaltung „mit deutschem Gruß“, hielt Vorlesungen zu NS-Themen, wie im SS 1933 zu „Staatsidee, Idee und Führertum“ oder „Der Faschismus“, war in seiner Publikationstätigkeit zurückhaltend. Diese Anpassung vermochte jedoch nicht zu verhindern, dass seine Kollegen ihn zusehends mieden, die SA seine Vorlesungstätigkeit verhindern wollte und Studenten ihn boykottierten. Nachdem der NS-Studentenbund 1935 in der Göttinger Lokalzeitung öffentlich zum Boykott von Leibholz’ Vorlesungen über die „Politische Ideengeschichte der Neuzeit“ und das „Staatsbild des 20. Jahrhunderts“ aufgerufen hatte, weil er Jude sei, sprach das Wissenschaftsministerium ein Vorlesungsverbot gegen Leibholz aus. Kurz darauf wurde er von seiner Professur beurlaubt und an die Universitätsbibliothek versetzt, wo er „mit dem Publikum […] nicht in Berührung“ (PA Leibholz Bd. 1, Bl. 52) kommen sollte. Er forschte erneut zum ausländischen faschistischen Staatsrecht, bis er zum Jahresende auf eigenen Antrag hin emeritiert wurde, vermutlich um seiner Zwangsemeritierung zuvorzukommen. Den Forschungsauftrag behielt er formaliter bis 1938, war aber inzwischen auch in der Universitätsbibliothek unerwünscht, so dass er sich zurückzog. Aufgrund der Frontkämpferklausel waren seine Bezüge zunächst noch gesichert. Die Lage für Juden verschlechterte sich indes weiter. Im öffentlichen Leben waren Leibholz und seine Familie inzwischen ausgegrenzt. Er hielt aber engen Kontakt zu seinem Schwager Bonhoeffer, mit dem er sich zwar regelmäßig beriet, sonst aber zurückhielt. Die Flucht hatte Leibholz bereits früh vorbereitet, er verhielt sich jedoch wie viele andere zunächst abwartend. 1938 berichtete sein Schwager Hans von Dohnanyi, der als Beamter im Reichsjustizministerium arbeitete, Leibholz von geheimen Plänen, das Passgesetz zu ändern, wodurch eine Ausreise für Juden unmöglich geworden wäre. Kurz vor der Reichspogromnacht am 9. November 1938 floh die Familie Leibholz, eine Urlaubsreise vortäuschend, über die Schweiz nach England, wo er nach Kriegsausbruch kurzzeitig als feindlicher Ausländer interniert war. Seine wissenschaftliche Wirkung in England war zunächst begrenzt, was nicht nur auf sprachliche Barrieren oder Vorbehalten der Briten gegenüber geflüchteten Deutschen, sondern besonders auf die Exilsituation zurückzuführen ist. Leibholz wurde 1939 Gastdozent am Magdalen College der University of Oxford, nachdem Versuche gescheitert waren, sich seinen Aufenthalt in England als Forschungsreise durch die Universität Göttingen finanzieren zu lassen. „Forschungen eines Volljuden“ standen schließlich „nicht im Interesse der Fakultät und Universität“ (PA Leibholz, Bd. 1, Bl. 86). Während der Zeit im Exil pflegte Leibholz, anfänglich noch vermittelt durch Bonhoeffer, einen engen Kontakt zum englischen Bischoff und Oberhausmitglied George Bell. Bell setzte sich im politischen Diskurs gegenüber der Regierung in Westminster für ein anderes Deutschlandbild ein und holte hierzu regelmäßig Leibholz’ Rat ein, den er in seinen Parlamentsreden einarbeitete. 1942 wurde Leibholz wie alle Juden gemäß der NS-Rassenlehre staatenlos; später erhielt er die britische Staatsbürgerschaft. Erst mit dem Inkrafttreten des Bonner Grundgesetzes 1949 wurde die Ausbürgerung rückgängig gemacht, wobei nicht klar ist, ob Leibholz fortan eine doppelte Staatsangehörigkeit hatte. Nach der bedingungslosen Kapitulation Deutschlands 1945 setzte die britische Regierung Leibholz als Dozent über den demokratischen Rechtsstaat ein, um deutsche Generäle in Kriegsgefangenenlagern im demokratischen Sinne umzuerziehen. Nur ein Jahr nach Kriegsende bemühte sich die Göttinger Universität, Leibholz auf seinen alten Lehrstuhl zurück zu holen – wohl auch, um politische Verwicklungen zu vermeiden. Die Universitätsleitung wollte öffentlich keine Zweifel an ihren Absichten einer politischen wie akademischen Wiedergutmachung aufkommen lassen. Sollten diese Bemühungen scheitern, sollten daher unbedingt persönliche Gründe Leibholz’ für die Ablehnung des Rufs sichtbar werden. So war es tatsächlich: Persönliche Kränkungen, die emigrationsbedingte Depression seiner Frau, auch Zweifel an der politischen Stabilität Nachkriegsdeutschlands ließen Leibholz zögern. Rufe nach Berlin, Köln und New York lehnte er allerdings ebenso ab. 1947 nahm er schließlich zunächst einen Lehrauftrag an der Universität Göttingen an. Erst 1958, nach langen Verhandlungen, wurde er wieder auf eine ordentliche Professur berufen, wobei der Lehrstuhl für Allgemeine Staatslehre und Politische Wissenschaften eigens für ihn eingerichtet wurde. 1951 wurde Leibholz einer der ersten Richter des neu errichteten Bundesverfassungsgerichts in Karlsruhe. Er gehörte dem II. Senat an, der die Funktion eines Staatsgerichtshofs für die Entscheidung über Streitigkeiten unter Verfassungsorganen einnehmen sollte. Damals hatte das Bundesverfassungsgericht allerdings noch nicht seine heutige Stellung als Verfassungsorgan inne, auch wenn Bundeskanzler Adenauer bereits ein Jahr nach dessen Errichtung äußerte „Dat ham wa uns so nich vorjestellt“ (Wesel, 1996, S. 17) und 1953 nachlegte „Das Bundesverfassungsgericht ist […] tatsächlich der Diktator Deutschlands. Das Bundesverfassungsgericht entscheidet nach seinem Gutdünken“ (ders., 2004, S. 77). Der Streit entzündete sich an der Frage, welche Stellung das Bundesverfassungsgericht eigentlich im Verfassungsgefüge der noch jungen Bundesrepublik einnehmen sollte. Denn der Parlamentarische Rat hatte diese potentiell wichtige Frage, die essentiell werden sollte für die Autorität der Karlsruher Entscheidungen, wohl übersehen und schlicht nicht beraten. Leibholz bemühte sich demzufolge schon früh um eine herausgehobene Stellung des Bundesverfassungsgerichts: In seinem sog. Status-Bericht an das Plenum aller damals 24 Bundesverfassungsrichter legte er dar, dass das Gericht aufgrund der Fülle der durch das Grundgesetz zugewiesenen Kompetenzen und Funktionen selbst als Verfassungsorgan anzusehen sei. Er stellte das Gericht damit in eine Reihe mit dem Bundespräsidenten, dem Bundestag, dem Bundesrat und der Bundesregierung. Dieser Vorgang justizieller Emanzipation wurde zunächst kritisch gesehen. Justizminister Thomas Dehler (1897–1967) etwa meinte, das Bundesverfassungsgericht sei „von dem Wege des Rechts abgewichen“ (Wesel, 1996, S. 19) und hielt es für seine Aufgabe, die Karlsruher Rechtsprechung zu überwachen. Was damals noch ungeheuerlich war, ist heute selbstverständlich: Bei Staatsereignissen steht der Präsident des Bundesverfassungsgerichts neben dem Bundespräsidenten, Bundestagspräsidenten, Bundesratspräsidenten und Bundeskanzler. Diese durch Leibholz angeschobene Emanzipation hatte zur Folge, dass das Bundesverfassungsgericht aus dem Geschäftsbereich des Bundesjustizministeriums herausgelöst wurde, seinen eigenen Haushalt und seine eigene Personalhoheit erhielt, wodurch eine materielle Unabhängigkeit gegenüber der Bundesregierung sichergestellt wurde. Dieser Vorgang war schon nach dem frühen wissenschaftlichen Werk Leibholz’ zwingend: In seiner Arbeit über die „Gleichheit vor dem Gesetz“ wies er bereits auf die verfassungs- bzw. grundrechtliche Bindung des Gesetzgebers im demokratischen Verfassungsstaat hin. Eine solche Bindung liefe ohne jede verbindliche Kontrollinstanz ins Leere: „In einer freiheitlichen Demokratie müssen hiernach die Bindungen, die diese Demokratie erst möglich machen, respektiert werden.“ (1969, S. 3). In der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts setzte sich die Bindung an den Gleichheitssatz im Sinne der Lehre Leibholz’ aus dessen juristischer Doktorarbeit durch und führte zu der Formel, dass vom Gesetzgeber aufgrund des Art. 3 Abs. 1 Grundgesetz wesentlich Gleiches gleich und wesentlich Ungleiches ungleich zu behandeln sei. Zudem grenzte sich das Bundesverfassungsgericht – wenngleich zunächst der I. Senat – vom Gesetzespositivismus ganz im Sinne des naturrechtlichen Ansatzes Leibholz’ bereits 1953 unzweifelhaft ab: „Die Vorstellung, dass ein Verfassungsgeber alles nach seinem Willen ordnen kann, würde einen Rückfall in die Geisteshaltung eines wertungsfreien Gesetzespositivismus bedeuten.“ (BVerfGE 3, 225 <232>). Das NS-Regime habe „gelehrt, dass auch der Gesetzgeber Unrecht setzen kann“ (BVerfGE, ebd.). Leibholz trat auch international dafür ein, der jungen Bundesrepublik aufgrund der Kontrolle durch das Bundesverfassungsgericht Vertrauen entgegenzubringen, das Garant für die Stabilität der Demokratie werden sollte. Bei der Staatsrechtslehrertagung im Jahre 1965 warnte Leibholz vor NS-Gedankengut und sprach sich für eine staatliche Parteienfinanzierung aus. Für diese Meinungsäußerung wurde er prompt in einem Verfahren über die staatliche Parteienfinanzierung, das u. a. die NPD betraf, vor dem Bundesverfassungsgericht für befangen erklärt. Es war das erste Mal in der Geschichte des noch jungen Bundesverfassungsgerichts, dass ein Richter wegen Befangenheit ausgeschlossen wurde. Erst nach einer Gesetzesänderung führen wissenschaftliche Äußerungen der zu großen Teilen professoral besetzten Senate des Bundesverfassungsgerichts gemäß § 18 Abs. 3 Nr. 2 BVerfGG nicht mehr dazu, dass sie wegen Voreingenommenheit ausgeschlossen werden können. Auch die Repräsentationslehre Leibholz’ aus dessen Habilitationsschrift fand Eingang in die verfassungsgerichtliche Rechtsprechung. Nach Leibholz ist Repräsentation durch Volksvertreter Bedingung eines Willensbildungsprozesses in einer Massendemokratie. Parteien machten das Volk handlungsfähig, seien Mediatisierungsinstanz für den Volkswillen, der in politische Entscheidungen münden solle. Darum sei eine aktive Mitwirkung der Bürger in Parteien erforderlich (Leibholz, Wahlrechtsreform, 1932, S. 188). In der Lehre Leibholz’ legitimiere demokratische Repräsentation staatliches Handeln. Folglich müsse ihre innere Organisation demokratisch sein, was auch der Bonner Verfassungsgeber in Art. 21 Abs. 1 S. 3 GG anerkannte. Die Parteienstaatslehre Leibholz’ ging so weit, dass letztlich ein imperatives Mandat erforderlich sei. So weit führte der Einfluss der Lehre Leibholz’ allerdings nicht: Art. 38 Abs. 1 GG konstituiert ein freies Mandat der Abgeordneten. Sie sind ausschließlich ihrem Gewissen unterworfen. Leibholz gab gemeinsam mit Kollegen Rechtsprechungskommentare zum Grundgesetz sowie zum Bundesverfassungsgerichtsgesetz heraus, die als Standardwerke gelten. Er war Herausgeber des Jahrbuchs des öffentlichen Rechts der Gegenwart, der Politischen Vierteljahresschrift sowie des Deutschen Verwaltungsblatts. Leibholz galt als liberal und der Sozialdemokratie nahe stehend, ohne jedoch einer politischen Partei anzugehören. Es war der Schutz vor Willkür, der Leibholz nicht nur in seinem wissenschaftlichen Werk, sondern gewiss bedingt durch die Exilerfahrung auch in seiner verfassungsrichterlichen Tätigkeit antrieb. Zu seiner persönlichen Exilerfahrung schwieg er sich dagegen als einer der Rückkehrer, die es insgesamt nur in überschaubarer Zahl gab, zeitlebens weitgehend aus. Dafür überwand er „Vergangenes um der Zukunft willen“ (Klein, 1987, S. 546) und leistete im Karlsruher Bundesverfassungsgericht seinen Beitrag zum Aufbau des bundesrepublikanischen demokratischen Rechtsstaats. Seine in der Weimarer Republik noch hoch umstrittenen Thesen wurden in der frühen Bundesrepublik zur herrschenden Meinung in der Rechtswissenschaft. Im Jahr 1970 wurde Leibholz emeritiert. 1971, nach zweimaliger Wiederwahl und insgesamt 20-jähriger Amtszeit, schied Leibholz aus dem II. Senat des Bundesverfassungsgerichts aus. |
|---|---|
| Quellen: | BA N 1334, Nachlass Gerhard Leibholz; UA Göttingen, Abtlg. E, Nr. L 3, PA Leibholz, Bd. 1 (ab 1929); UA Greifswald, Az. 386, Jurist. Fakultät, Öfftl.-rechtliche Professur I; UA Göttingen, Az. XVI. II. A. a. 25, PA L, Bde. 1–4 nebst Beiakten, PA Leibholz, Bd. 1 (1931–1961), BA R 87/9211, Reichskommissar für die Behandlung feindlichen Vermögens; Nds. SUB Göttingen, Cod. Ms. R. Smend A 502, A 503, C 48, E 6, F 3, L 2, Nachlass Rudolf Smend; Gespräch mit Tochter Marianne Leibholz am 18.6.2013. |
| Werke: | (Auswahl) Franz Schneider, Bibliographie Gerhard Leibholz, 2. Aufl. 1981; Fichte und der demokratische Gedanke, Diss. phil. Heidelberg 1921; Die Gleichheit vor dem Gesetz, Diss. iur. Berlin 1925, 2. Aufl. 1959; Das Wesen der Repräsentation unter besonderer Berücksichtigung des Repräsentativsystems, 1929; Die Wahlrechtsreform und ihre Grundlagen, in: Veröffentlichungen Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer (=VVDStRL) 7, 1932, 159–190; Aussprache am 29.10.1931, ebd., 204; Die Auflösung der liberalen Demokratie in Deutschland und das autoritäre Staatsbild, 1933; Der Status des Bundesverfassungsgerichts, in: Jahrbuch des öffentlichen Rechts (=JöR) NF 6, 1957, 110–119; Bericht des Berichterstatters an das Plenum des Bundesverfassungsgerichts zur „Status“-Frage, ebd. 120–137; Strukturprobleme der modernen Demokratie, 1958; Das Wesen der Repräsentation und der Gestaltwandel der Demokratie, 2. Aufl. 1960, 3. Aufl. 1966; Rechtsgewalt und Staatsgewalt in der Bundesrepublik Deutschland, in: Journal der internat. Juristen-Kommission 4, 1963, 252–260; Politics and Law, 1965; (mit Hans-Justus Rinck), Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, Kommentar an Hand der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, 1966, derz. in der 76. Aktualisierung; (mit Reinhard Rupprecht), Bundesverfassungsgerichtsgesetz, Rechtsprechungskommentar, 1968; Verfassungsstaat – Verfassungsrecht, 1973; Das Bundesverfassungsgericht im Schnittpunkt von Politik und Recht, Deutsches Verwaltungsblatt 1974, 396–399. |
| Nachweis: | Bildnachweise: Foto (1976) S. 332, StadtA Göttingen. |
Literatur + Links
| Literatur: | (Auswahl) Gerhard Anschütz, Aussprache, in: VVDStRL 3, 1927, 47; Rudolf Smend, Zwanzig Richter hüten das Grundgesetz, in: FAZ vom 14.2.1967, 11; Eberhard Bethge/Ronald C. D. Jasper, An der Schwelle zum gespaltenen Europa, Der Briefwechsel zwischen George Bell und Gerhard Leibholz 1939–1951; 1974; Rudolf Smend, Festvortrag zur Feier des 10jährigen Bestehens des Bundesverfassungsgerichts am 26.1.1962, in: Das Bundesverfassungsgericht 1951–1971, 21971, 15–29; ders., Gerhard Leibholz zum 70. Geburtstag, Archiv des öffentlichen Rechts (AöR) 96, 1971, 568–575; An den Grenzen des Rechts, Maßt sich Karlsruhe politische Entscheidungsgewalt an?, in: Die Zeit vom 14.2.1975, 9; Erich Küchenhoff, Nachruf auf Gerhard Leibholz, PVS 23, 1982, 362–364; Gestorben: Gerhard Leibholz, in: Der Spiegel vom 1.3.1982, 236; Sabine Leibholz-Bonhoeffer, Vergangen – erlebt – überwunden, Schicksale der Familie Bonhoeffer, 41983; Christoph Link, Zum Tode von Gerhard Leibholz, AöR 108, 1983, 153–160; Hans-Justus Rinck, In memoriam Gerhard Leibholz, JöR NF 35, 1986, 133–142; Hans H. Klein, Gerhard Leibholz (1901 –1982), Theoretiker der Parteiendemokratie und politischer Denker, in: Fritz Loos (Hg.), Rechtswissenschaft in Göttingen, Göttinger Juristen aus 250 Jahren, 1987, 528–547; Horst Göppinger, Juristen jüdischer Abstammung im „Dritten Reich“, 2. Aufl. 1990; Manfred H. Wiegandt, Norm und Wirklichkeit: Gerhard Leibholz (1901–1982), 1995; ders., Der Weg Gerhard Leibholz’ in die Emigration, in: Kritische Justiz 1995, 478–492; Uwe Wesel, Die Hüter der Verfassung, Das Bundesverfassungsgericht, seine Leistungen und seine Krisen, 1996; Susanne Benöhr, Das faschistische Verfassungsrecht Italiens aus der Sicht von Gerhard Leibholz, Zu den Ursprüngen der Parteienstaatslehre, 1999; Peter Unruh, Erinnerung an Gerhard Leibholz (1901 –1982), Staatsrechtler zwischen den Zeiten, in: AöR 126, 2001, 60–92; Hans H. Klein, Persönliche Erinnerungen an Gerhard Leibholz, in: Europäische Grundrechte-Zeitschrift 2002, 306–307; Shigetoshi Takeuchi, Gerhard Leibholz 1901 –1982, Sein Leben – sein Werk – seine Zeit, 2004; Uwe Wesel, Der Gang nach Karlsruhe, Das Bundesverfassungsgericht in der Geschichte der Bundesrepublik, 2004; Werner Heun, Leben und Werk verfolgter Juristen, Gerhard Leibholz (1901 –1982), in: Eva Schumann (Hg.), Kontinuitäten und Zäsuren, Rechtswissenschaft und Justiz im „Dritten Reich“ und in der Nachkriegszeit, 2008, 301–326; Christian Nettersheim, Die Parteienstaatslehre von Gerhard Leibholz, Diss. iur. Bonn 2008; Leonie Breunung/Manfred Walther, Die Emigration deutschsprachiger Rechtswissenschaftler ab 1933, Ein biografisch-bibliografisches Handbuch, Bd. 1, 2012; Christian Starck, Gerhard Leibholz (1901 –1982), in: Peter Häberle/Michael Kilian/Heinrich Amadeus Wolff (Hg.), Staatsrechtler des 20. Jahrhunderts, , 2015, 581, 591; Marc Schieren, Gerhard Leibholz – Demokratischer Staatsrechtslehrer, verfolgter Emigrant und erster Verfassungsrichter in einem wechselhaften Jahrhundert, in: Jahrbuch der Hambach-Gesellschaft 23, 2016, 127–162. |
|---|







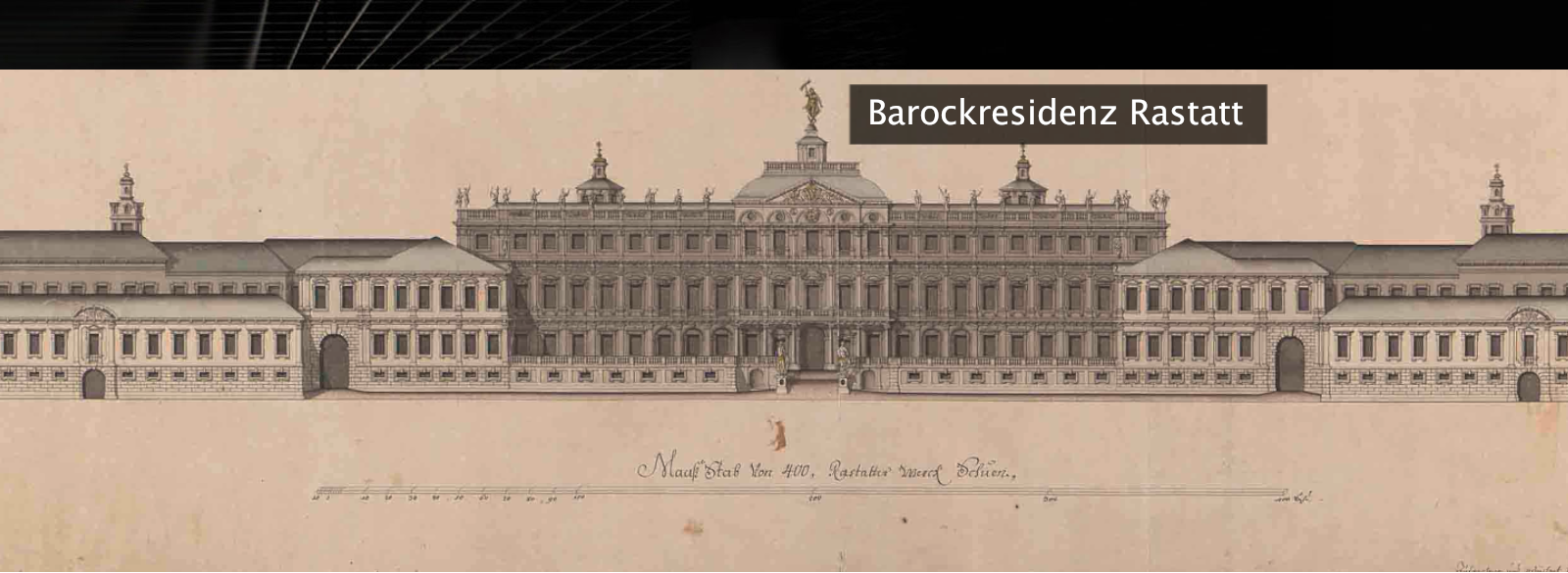



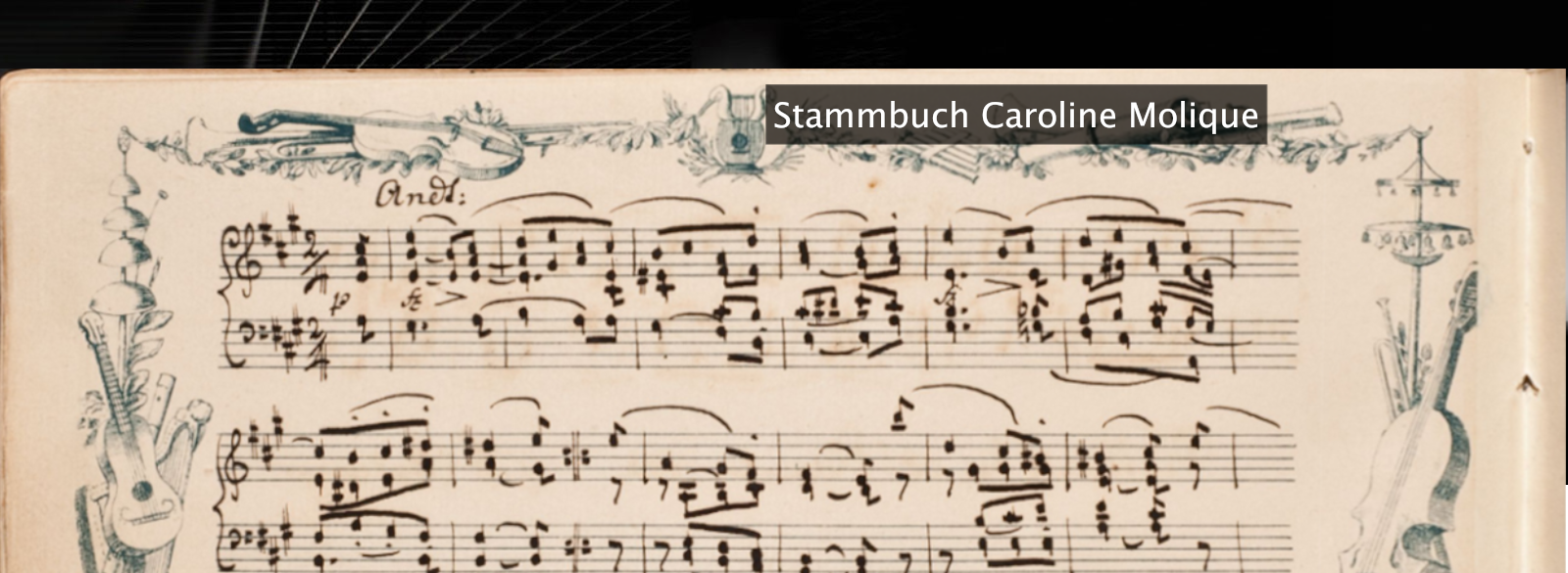





 leobw
leobw