Hengerer, Karl Christian
| Geburtsdatum/-ort: | 04.04.1863; Hessigheim bei Besigheim |
|---|---|
| Sterbedatum/-ort: | 25.06.1943; Stuttgart |
| Beruf/Funktion: |
|
| Kurzbiografie: | 1882–1885 Studium der Architektur an der TH Stuttgart 1888 Bauleitung am Neubau des Marienhospitals Stuttgart unter Robert von Reinhardt 1890–1893 Architektengemeinschaft Karl Heim&Karl Hengerer, Stuttgart 1891 Auftrag zum Bau der Siedlung „Ostheim“ in Stuttgart 1892 Wahl Hengerers in den Stuttgarter Bürgerausschuss 1895 Neubau des Hauses der Schützengilde in Stuttgart-Heslach 1901–1903 Bau der Arbeitersiedlung „Südheim“ in Stuttgart 1902–1906 Architekturbüro Karl Hengerer&Richard Katz, Stuttgart 1903/04 Bau der Villa Hauff in Stuttgart 1904 Verleihung des Titels „Baurat“ durch König Wilhelm II. für Verdienste um die bauliche Entwicklung von Stuttgart 1906–1909 „Altstadt-Sanierung“ Stuttgart 1907–1911 Siedlung „Birkendörfle“ in Stuttgart 1910/11 Bau von Ledigenheim und Säuglingsheilanstalt in Stuttgart 1911 Neubauten für die Württ. Vereinsbank in Ulm, Heidenheim und Ravensburg 1911–1913 Bau der Siedlung „Ostenau“ in Stuttgart 1914–1916 Neubau für die Württ. Bankanstalt in Stuttgart |
| Weitere Angaben zur Person: | Religion: ev. Verheiratet: 25.8.1888 (Stuttgart) Eugenie Eberhardine Pauline Marie, geb. Klett (* 27.8.1868 Stuttgart, † 25.2.1949 Esslingen a. Neckar) Eltern: Vater: Johann Christian Hengerer (* 20.7.1837 Hessigheim, † 31.12.1907 Stuttgart), Steinhauer, Bauunternehmer Mutter: Christiane Louise, geb. Grimm (* 7.11.1835 Winzerhausen, heute zu Großbottwar, † 27.1.1920 Stuttgart) Kinder: 6: Erich Karl (* 10.4.1889 Stuttgart, † 22.1.1951 Stuttgart-Bad Cannstatt), Dr. Ing., Architekt; Hedwig Emilie (* 15.1.1891 Stuttgart); Elisabeth Frida (* 2.3.1892 Stuttgart); Helene Gertrud (* 20.6.1894 Stuttgart); Karl Otto (* 1.11.1898 Stuttgart); Kurt Eugen (* 9.3.1903 Stuttgart) |
| GND-ID: | GND/119209179 |
Biografie
| Biografie: | Alfred Lutz (Autor) Aus: Württembergische Biographien 2 (2011), 117-121 Hengerer wurde als einziges Kind eines Steinhauers geboren, dessen Vorfahren bis zum Ende des Dreißigjährigen Krieges vor allem als Bauern und Weingärtner in Hessigheim nachweisbar sind. Noch im Geburtsjahr Hengerers erfolgte 1863 der Umzug nach Stuttgart. Dort leitete der Vater 1864 bis 1866 den Bau des Diakonissenkrankenhauses und machte sich danach als Bauunternehmer und Steinhauermeister selbstständig. Infolge des Wiener Bankenkrachs 1873 verlor er einen Großteil seines Kapitals und hielt sich in der Folgezeit mit dem Betrieb eines Steinbruchs finanziell über Wasser. Dennoch konnte Karl Hengerer nach dem Friedrich-Eugens-Realgymnasium und der Einjährigenzeit die TH in Stuttgart besuchen, wo er von 1882 bis 1885 – durch ein Stipendium gefördert – bei Christian Friedrich Leins Architektur studierte; weitere bedeutende Lehrer Hengerers an der TH waren Robert von Reinhardt (Baugeschichte) und Conrad Dollinger (Baukonstruktionslehre). 1886 schloss Hengerer das Studium mit der I. Staatsprüfung im Hochbau ab. Ausgestattet mit einem Empfehlungsschreiben seines Lehrers Leins fand er bei dem bekannten Architekten Emil Schreiterer in Köln eine erste Anstellung und arbeitete an einigen Neubauten des dortigen Ringstraßensystems mit. 1888 kehrte Hengerer nach Stuttgart zurück und legte die Zweite Staatsprüfung zum Regierungsbaumeister ab. Robert von Reinhardt stellte ihn als bauleitenden Architekten am Neubau des Marienhospitals ein und besorgte ihm danach auch noch ein Reisestipendium der TH, das Hengerer ab November 1888 eine halbjährige Studienreise durch Italien ermöglichte. Nach seiner Rückkehr übernahm Hengerer für kurze Zeit die Leitung des elterlichen Baugeschäfts. Bereits zwei Jahre später verkaufte er den Betrieb, um sich ganz der Architektur widmen zu können. Hengerer schloss sich 1890 mit dem Stuttgarter Architekten und Freund Karl Heim zum gemeinschaftlichen Büro Heim&Hengerer zusammen. Bereits kurze Zeit später konnten sie einen großen Erfolg verbuchen. 1891 beteiligten sich Heim&Hengerer am Wettbewerb für die Siedlung „Kolonie Ostheim“ in Stuttgart. Bauherr dieser größten Arbeitersiedlung im deutschen Südwesten vor dem Ersten Weltkrieg war der 1866 von dem jüdischen Bankier, Landtagsabgeordneten und Sozialreformer Eduard Pfeiffer (1835–1921) gegründete „Verein für das Wohl der arbeitenden Klassen“, der die „Förderung der Interessen und Hebung der sittlichen und wirtschaftlichen Zustände der arbeitenden Klassen“ zum Ziel hatte. Mit dem zweiten Preis der Jury ausgezeichnet, konnten Heim&Hengerer gut zwei Drittel der geplanten Häuser – auf der Grundlage eines Bebauungsplans des Wettbewerbssiegers Fritz Gebhardt – realisieren und damit das Erscheinungsbild Ostheims prägen. In überwiegend zwei- bis dreigeschossigen Einzel- und Doppelhäusern mit standardisierten Grund- und Aufrissen, aber mit individuell gestalteten Fassaden (unterschiedliche Dach- und Giebelformen, Erker, Balkone sowie Fensteranordnungen, farbige Verblendsteine, abwechslungsreicher Dekor) entstanden insgesamt 1267 Wohnungen. Die eher bürgerlich wirkenden Gebäude der malerisch gestalteten Siedlung zeigten Anleihen bei verschiedenen historistischen Baustilen, verfügten über kleine Vorgärten und besaßen in der Regel nur eine Wohnung pro Etage. „Auf diese Weise sicherte man den Familien ein möglichst hohes Maß an Privatheit und vermittelte ihnen das Gefühl, ein eigenes Haus zu bewohnen. Entstanden sind überwiegend Drei-Zimmer-Wohnungen mit Küche, Klosett sowie Kellerraum und Bodenkammer“ (Thomas Hafner, Die andere Seite, 241). Ostheim war „eine der ersten, wenn nicht die erste Siedlung in Deutschland, in der das Cottage-System mit Ein- und Zweifamilienhäusern in offener Bebauung in großem Umfang realisiert wurde“ (Bernd Langner, 79). In „Ostheim“, das zum Vorbild weiterer derartiger Siedlungen werden sollte und seinen baulichen Charakter bis heute erfreulich gut hat bewahren können, lebten am Anfang überwiegend Handwerker und Angestellte mit niedrigem Einkommen, eher selten auch Arbeiterfamilien. „Weil es Initiatoren und Architekten gelungen war, architektonische Vielfalt mit niedrigen Mieten, sozialer Stabilität, Hygiene und guter Wohnqualität zu kombinieren, wurde Ostheim zu einem der frühesten Beispiele für mustergültigen Siedlungsbau im ausgehenden 19. Jahrhundert, das damals wie heute weitreichende Beachtung fand und findet“ (Bernd Langner, 87). 1902 bis 1904 errichtete Hengerer in Stuttgart wiederum im Auftrag des „Vereins für das Wohl der arbeitenden Klassen“ die „Kolonie Südheim“ am Südwestrand Heslachs. 22 Gebäude umfassten hier insgesamt 136 recht großzügig dimensionierte Zwei- bzw. Dreizimmer-Wohnungen. Aus Rentabilitätsgründen (starker Anstieg der Grundpreise in Großstädten wie Stuttgart) wurde die in Ostheim realisierte Cottage-Bauweise jedoch aufgegeben; die dreigeschossigen Häuser wurden hier in aufgelockerter Blockbebauung um lichte Höfe gruppiert. Die Gebäude zeigen im Wechsel sichtbar belassene Backstein- und Putzflächen. Nicht zuletzt durch verhältnismäßig sparsam eingesetzte Elemente wie rustizierte Erdgeschosse, Fachwerk, Erker, Turm- und Giebelaufbauten sowie plastischen Schmuck – teils in historisierenden Stilformen, teils bereits unter Jugendstileinfluss – vermochte Hengerer der weitgehend erhalten gebliebenen „Kolonie Südheim“ ein markantes eigenständiges Gepräge zu geben. In die Planung von „Südheim“ flossen auch Motive des benachbarten Hauses der Schützengilde ein, das Hengerer 1895 errichtet hatte. Zwei mit Fachwerkobergeschossen und Krüppelwalmdächern versehene Flügel wurden hier durch einen langgestreckten Bauköper (Gaststätte mit Festsaal) verbunden. Zu diesem Komplex gehört noch ein Turm mit Fachwerkobergeschoss und Zeltdach. Nach ersten Sanierungsarbeiten in der Weber-, Leonhard- und Bachstraße veranlassten die problematischen baulichen und hygienischen Zustände im Stuttgarter Altstadtareal zwischen Eberhard-, Nadler- und Steinstraße den „Verein für das Wohl der arbeitenden Klassen“ mit Zustimmung der Stadt zum „Ankauf, Abriss und Neuaufbau eines ganzen Viertels“ (Langner, 164). Die Oberleitung dieses Großprojektes wurde Hengerer übertragen. 86 Häuser wurden abgebrochen und an deren Stelle zwischen 1906 und 1909 33 Neubauten in geschlossener Bauweise – zumeist vierstöckig mit ausgebautem Dachgeschoss und straßenseitigem Giebel – errichtet; allein 26 Gebäude wurden von Hengerer entworfen, die restlichen nach Plänen anderer bekannter Architekten wie Bihl&Woltz, Eisenlohr&Weigle, Paul Bonatz und Richard Dollinger. Soweit möglich folgte Hengerer den alten Gassen- und Platzverläufen, er verbreiterte bzw. begradigte sie jedoch, um eine verbesserte Licht- und Luftzufuhr sowie Verkehrsanbindung für die Geschäfte, Gaststätten und Handwerksbetriebe zu erreichen. Hengerer legte im Sanierungsgebiet – mit dem anheimelnd gestalteten Geißplatz samt Hans-im-Glück-Brunnen als Mittelpunkt – Wert auf die Erhaltung des Altstadtcharakters, er ermöglichte reizvolle Durchblicke und realisierte malerische, individuell gestaltete und künstlerisch ausgeschmückte Fassaden, die vielfach mit Arkaden, Erkern und Malereien versehen waren. Für das Bestreben, örtliche Bautraditionen aufzunehmen, die Gassen- und Platzräume künstlerisch zu gestalten, gleichzeitig jedoch den schematischen Historismus des 19. Jahrhunderts zu überwinden, war der Einfluss Camillo Sittes und Theodor Fischers, letzterer 1901 bis 1908 Professor an der TH Stuttgart, von einiger Bedeutung. Die Wohnungen in den Obergeschossen (über den Läden und Gaststätten) waren in Bezug auf Aufteilung und Ausstattung auf dem neuesten Stand. Ein „Wahrzeichen des neu entstandenen Viertels“ (Wörner/Lupfer, 41) wurde der fünfgeschossige „Eberhardsbau“ mit seinem markanten, fast 50 Meter hohen Turm; der ausgedehnte Gebäudekomplex vereinigte zahlreiche Einzelgeschäfte, Gaststätten und Büros unter einem Dach. In der Fachpresse wurde das Ergebnis der Stuttgarter „Altstadt-Sanierung“ einhellig gelobt. Als letztes Bauvorhaben des „Vereins für das Wohl der arbeitenden Klassen“ entstand 1911 bis 1913 die zwischen Gaisburg und Ostheim gelegene „Kolonie Ostenau“, die in erster Linie auf Wohnungssuchende des Mittelstandes zielte. Auf der Grundlage eines Bebauungsplanes von Paul Bonatz errichtete der bewährte Hengerer 50 Häuser (mit insges. 261 Wohneinheiten) auf einem dreieckigen Grundstück. Aus Kostengründen wurde die Siedlung in dreiteiliger, geschlossener Blockrandbebauung mit großen und begrünten Innenhöfen errichtet. Zentrum und Bindeglied der Wohnblöcke ist der Luisenplatz. Die weitgehend einheitlich gestalteten Häuser mit großen Mansarddächern, durchlaufenden Gesimsen, Erkern, Dachaufbauten und ruhigen, verputzten Fassaden verleihen „Ostenau“ einen vornehmeren Charakter als etwa der Siedlung „Ostheim“. Dass auf historistischen Dekor weitgehend verzichtet wurde, ist typisch für die Architektur um 1910 und verdeutlicht die „Hinwendung zu sachlichen, klareren Formen“ (Wörner/Lupfer, Nr. 141). In ähnlichen, zurückhaltend neubarocken Formen hatte Hengerer bereits 1910/11 im Auftrag des Vereins im Stuttgarter Vorort Berg ein Ledigenheim mit 108 hellen Zimmern und Gemeinschaftseinrichtungen wie Lese- und Unterhaltungszimmer errichtet. Das 1921 an die Stadt Stuttgart verkaufte und zum Hotel umgebaute Gebäude ist nach der Zerstörung im Zweiten Weltkrieg nur stark vereinfacht wiederaufgebaut worden. In nächster Nachbarschaft entstand ebenfalls 1910/11 – von Pfeiffer initiiert und nach Plänen Hengerers – eine Säuglingsheilanstalt. Wiederum bestimmen versachlicht neubarocke Formen, Putzfassaden und ein großes Mansarddach, in diesem Fall jedoch auch zwei risalitartig flankierende und durch einen Arkadenvorbau verbundene Erker das äußere Bild. Auch hier erfolgten aufgrund Kriegsbeschädigung Veränderungen vor allem im Dachbereich. Hengerer war ein enorm produktiver Architekt – mehr als 400 Gebäude konnten ihm bislang zugeschrieben werden. Neben den hier ausführlicher erwähnten Siedlungsbauten errichtete Hengerer, wiederum vor allem in Stuttgart, zahlreiche Geschäfts- und Wohnhäuser bzw. Villen. Das 1902 errichtete, im Zweiten Weltkrieg zerstörte Geschäftshaus Tritschler, Marx&Nachmann am Marktplatz, das erhaltene Geschäftshaus Calwer Straße 62/64 (1904) oder auch die repräsentative, an eine trutzige mittelalterliche Burg erinnernde Villa Hauff (1903/04) auf der Gänsheide (Gerokstraße 7) zeigen den in diesen Jahren „typischen Hengerer-Stil: eine freie Verwendung gotischer Motive und wuchtige Formen in romanischer und frühgotischer Auffassung, teilweise untereinander vermischt und kaum noch als Dekor in historischen Originalformen, sondern als jugendstilartige Verfremdung vorgestellt“ (Langner, 221); vor allem in der Gestaltung der Fassaden zeigte sich das „enorm plastische Verständnis“ Hengerers (ebda.). 1910 bis 1912 errichtete Hengerer für die Württembergische Vereinsbank – Vorsitzender des Aufsichtsrats war Eduard Pfeiffer – Neubauten in Ulm, Heidenheim und Ravensburg, alle in den von Hengerer zu jener Zeit nun bevorzugten vornehmen neubarocken Formen gehalten. Hengerer trat auch als Bauunternehmer in Erscheinung; so erstellte er 1897 bis 1906 achtzehn Mietwohnhäuser und Villen an der Stuttgarter Stitzenburg- und Danneckerstraße, um sie rasch gewinnbringend wieder zu verkaufen. Wiederum auf eigene Rechnung errichtete Hengerer auf einem von Eduard Pfeiffer günstig erworbenen Gelände zwischen Oberer Birkenwald- und Mönchhaldenstraße 1907 bis 1911 das „Birkendörfle“, eine 27 freistehende Zwei- und Dreifamilienhäuser zählende reizvolle Siedlung; eines dieser Häuser bezog Hengerer mit Familie und Baubüro selbst. Der repräsentative neubarocke bzw. neuklassizistische Bau für die Württembergische Bankgesellschaft in der Stuttgarter Gymnasiumstraße war Hengerers letztes großes Bauobjekt. Um 1914 hatte es Hengerer, nach rund 25jähriger Tätigkeit als Architekt, zum Millionär gebracht. 1908 hatte er den von ihm entwickelten, nicht entflammbaren und besonders tragfähigen Baustoff „Tekton“ präsentiert, im selben Jahr gründete er die „Württembergischen Tektonwerke“ in Cannstatt. Im Ersten Weltkrieg trat Hengerer als Freiwilliger 1915, bereits 51 Jahre alt, in die 7. württembergische Landwehrdivision ein und wurde als Bau-Offizier im Elsass, in Frankreich und Russland eingesetzt. Nach der deutschen Niederlage und dem Ende des Kaiserreichs 1918 trat Hengerer als Architekt kaum noch in Erscheinung, er tat sich – konservativ gesinnt – mit den neuen politischen und wirtschaftlichen Verhältnissen schwer, Streit mit seinem Sohn und anderen Familienmitgliedern kam hinzu. 1920 verließ Hengerer Stuttgart und löste sein Baubüro auf; auf einem erworbenen Landgut in Siglingen/Jagst (dort waren bereits 1913 die „Württembergischen Tektonwerke“ angesiedelt worden) lebte er einige Jahre mit seiner Frau als Privatier. 1926 zog Hengerer wieder nach Stuttgart und errichtete sein letztes Wohnhaus (Gustav-Siegle-Str. 36), in das er selbst einzog. Nicht zuletzt die wirtschaftlichen Schwierigkeiten seiner Tektonfabrik führten jedoch zum raschen Verfall seines Vermögens. An Zerebralsklerose leidend, zog Hengerer 1940 in das von ihm selbst errichtete Gründerzeithaus Hölderlinstraße 40, wo er bis zu seinem Tod drei Jahre später zur Miete wohnte. Er wurde auf dem Pragfriedhof beigesetzt. Hengerers Architektur blieb während seiner langen Schaffenszeit „traditionsbewusst und konservativ. Neue Strömungen wurden zwar stets aufgenommen, Material, Stil, Gestaltung und Dekor suggerierten jedoch immer Bodenständigkeit“ (Langner, 222). |
|---|---|
| Werke: | Betrachtungen über amerikanische Bauten, in: Württ. Bauztg. 2 (1905), 41 f. |
| Nachweis: | Bildnachweise: Foto in: Bernd Langner, Gemeinnütziger Wohnungsbau um 1900, 214. |
Literatur + Links
| Literatur: | Blätter für Architektur und Kunsthandwerk 8 (1895), Nr. 6, 31, Tafeln 41 f.; Deutsche Konkurrenzen 5 (1895), Heft 1/2, 44 f.; Blätter für Architektur und Kunsthandwerk 14 (1901), Tafeln 29–31, 41 f.; Der Baumeister 4 (1906), 28 f., 31, 34, 36; Deutsche Bauztg. 63 (1909), 459 f.; Architektonische Rundschau 1909, Heft 11, 85–92, Tafeln 89–92; Blätter für Architektur und Kunsthandwerk 4 (1914), 15 f., ebda. 27. Jg., Tafeln 34–37; Stuttgarter Neues Tagblatt Nr. 137 v. 3.4.1923; Inventur. Stuttgarter Wohnbauten 1865–1915, hg. vom Württ. Kunstverein Stuttgart in Zusammenarbeit mit dem Landesdenkmalamt Baden-Württemberg (Zentralstelle Stuttgart), 1975, 78–81; Gabriele Kreuzberger, Fabrikbauten in Stuttgart, 1993, 167–171; Georg Dehio, Handbuch der Deutschen Kunstdenkmäler: Baden-Württemberg I, 1993, 767 f.; Bernd Langner, Gemeinnütziger Wohnungsbau um 1900. Karl Hengerers Bauten für den Stuttgarter Verein für das Wohl der arbeitenden Klassen, 1994; Andreas Brunold/Bernhard Sterra (Hg.), Stuttgart – Von der Residenz zur modernen Großstadt, 1994, 26, 29, 102; Martin Wörner/Gilbert Lupfer, Stuttgart. Ein Architekturführer, 2. Aufl. 1997, Nr. 67, 114, 115, 138, 141, 147; Christine Breig, Der Villen- und Landhausbau in Stuttgart 1830–1930, 2000, 169–171; 243 f., 323 f., 483 f., 527; Thomas Hafner, Die andere Seite. Kleinhaus, Werksiedlung und Genossenschaft, in: Gert Kähler (Hg.), Villen und Landhäuser des Kaiserreichs in Baden und Württemberg, 2005, 237–261, hier 237–242. |
|---|







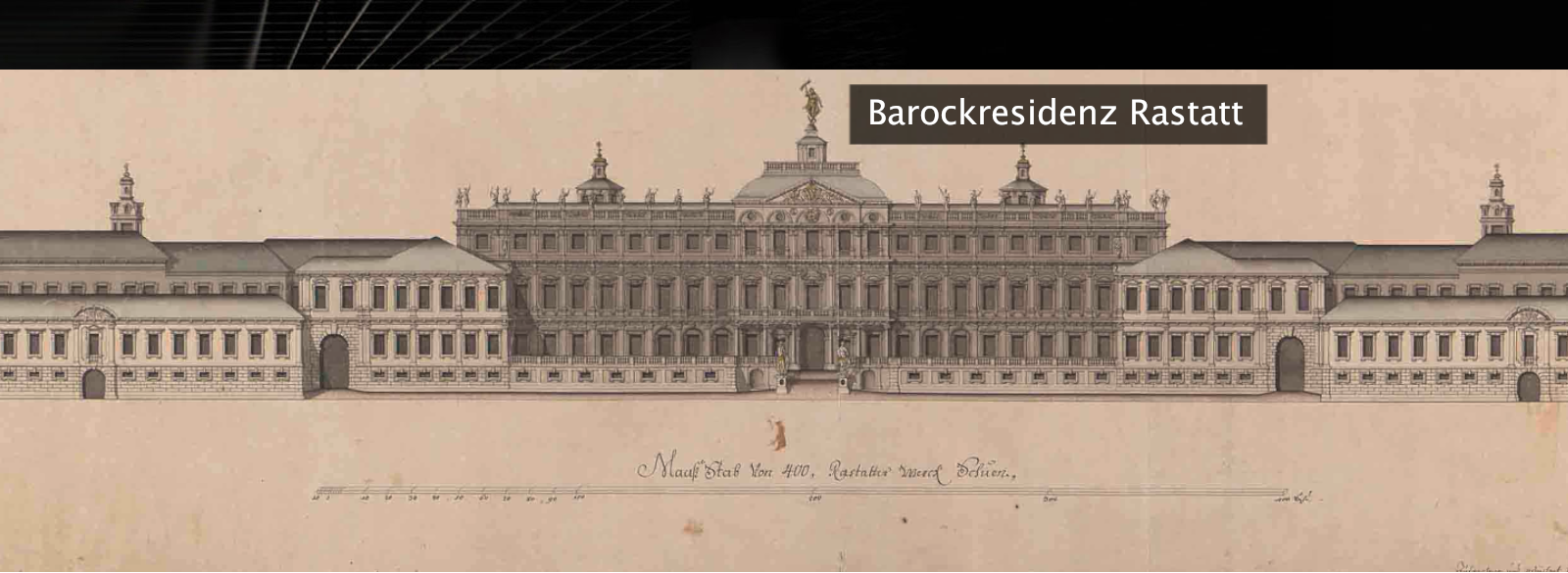



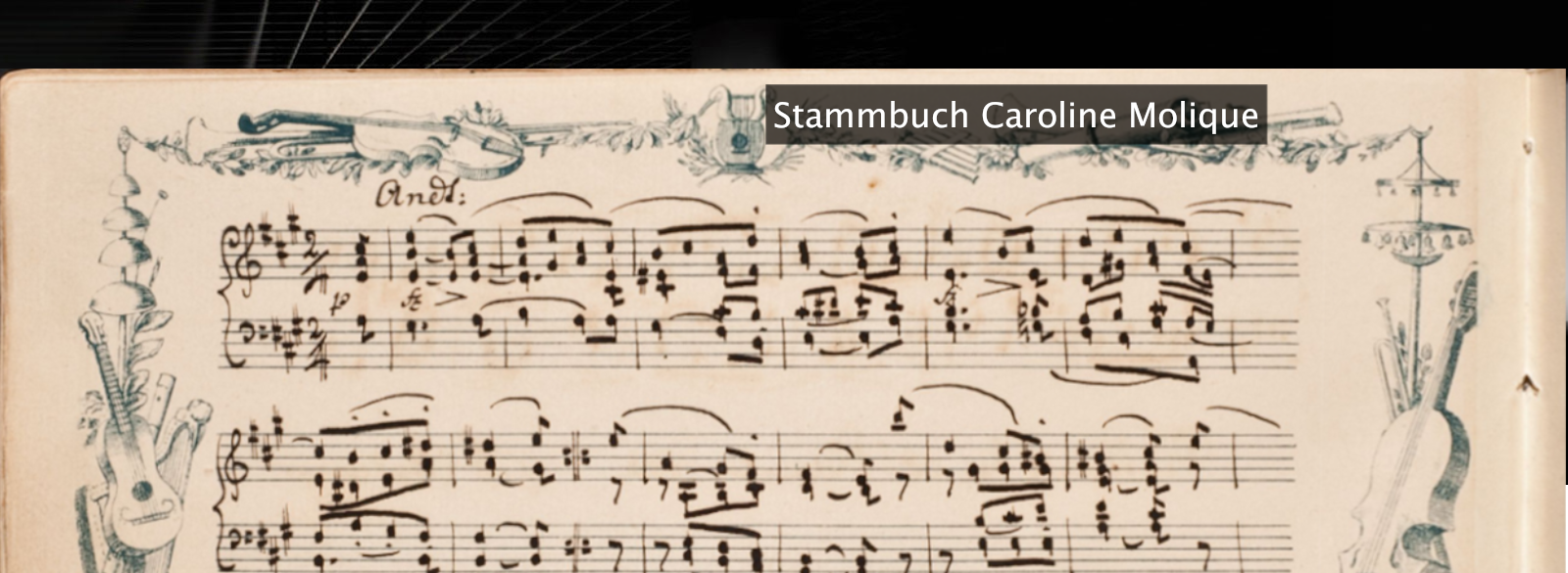









 leobw
leobw