Bilfinger, Carl
| Geburtsdatum/-ort: | 21.11.1879; Ulm |
|---|---|
| Sterbedatum/-ort: | 02.12.1958; Heidelberg |
| Beruf/Funktion: |
|
| Kurzbiografie: | 1905 Studium der Rechtswissenschaft in Tübingen, Straßburg, Berlin und Vorbereitungsdienst 1911 Amtsrichter, ab 1913 im Staatsministerium und ab 1915 im Justizministerium Stuttgart 1918 Wirklicher Legationsrat; Promotion Dr. jur. in Tübingen 1922 Habilitation (Privatdozent) in Tübingen 1924 Ordinarius für Staats-, Verwaltungs- und Völkerrecht in Halle 1934 Zugleich Studienleitung der Verwaltungsakademie der Provinz Sachsen, Zweiganstalt Magdeburg 1935 Ordinarius in Heidelberg 1944 Ordinarius in Berlin und Leitung des dortigen Kaiser-Wilhelm-Instituts für Ausländisches Öffentlichkeitsrecht und Völkerrecht 1949-1954 Neuaufbau und Leitung des Max-Planck-Instituts für Ausländisches Öffentliches Recht und Völkerrecht in Heidelberg 1950 Senator der Max-Planck-Gesellschaft 1951 Vorsitzender der geisteswissenschaftlichen Sektion der Max-Planck-Gesellschaft; korrespondierendes Mitglied des Institut Hellénique de Droit International et Étranger Athen 1952 Honorarprof. in Heidelberg 1953 Großes Verdienstkreuz des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland |
| Weitere Angaben zur Person: | Religion: ev. Verheiratet: um 1908 Margarethe, geb. Schuler (1887-1951) Eltern: Vater: Adolf Bilfinger (1846-1902), Prälat am Ulmer Münster, Hofprediger in Stuttgart Mutter: Sophie, geb. von Weizsäcker (1850-1931) Geschwister: 2 Brüder 1 Schwester |
| GND-ID: | GND/118663194 |
Biografie
| Biografie: | Paul Feuchte (Autor) Aus: Baden-Württembergische Biographien 1 (1994), 25-28 Leben und Werk von Bilfinger umspannen einen Zeitraum von 80 Jahren, in dem vier grundverschiedene politische und rechtliche Ordnungen das staatliche Geschehen in Deutschland bestimmten. In allen Epochen nahm er, bis ins hohe Alter wirkend, daran tätigen Anteil, in seinen Anschauungen beeinflußt, geleitet und geprägt von den sich ständig wandelnden Problemen der nationalen und internationalen Politik und Rechtsentwicklung. Bilfinger war Sproß einer bedeutenden württembergischen Familie. Georg Bernhard Bilfinger (1693-1750), im 18. Jahrhundert einflußreicher Philosoph und Staatsmann am Hofe, war unter seinen Vorfahren, der evangelische Theologe Karl Heinrich von Weizsäcker (1822-1899) war sein Großvater mütterlicherseits. Bilfinger erhielt in der Jugend und frühen Laufbahn reiche Anregung und Förderung, nicht zuletzt von Seiten seines Oheims, des württembergischen Ministerpräsidenten (1906-1918) Karl von Weizsäcker, Großvater des Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker. Promotion und Habilitation des 43jährigen liegen spät, aber die Anschauung der tatsächlichen Verhältnisse, die er zuvor im württembergischen Staatsdienst gewann, bildete eine wesentliche Grundlage und regte ihn zur Erforschung der Probleme der bundesstaatlichen Wirklichkeit an. Eingang in den damals noch kleinen Kreis der Staatsrechtslehrer fand er mit seiner Schrift über den Einfluß der Einzelstaaten auf die Bildung des Reichswillens, die – wie schon der Untertitel „Eine staatsrechtliche und politische Studie“ bestätigt – nicht nur staatsrechtlich argumentiert, sondern auch die tatsächliche politische Gestaltung, ihr Ziel und ihren Erfolg untrennbar damit verbindet (1923). Die Sicht des Historikers verbindet sich darin mit der des Juristen. Zur bundesstaatlichen Struktur folgte rasch der auf der Tagung der Staatsrechtslehrer zu Jena 1924 vorgetragene Mitbericht über den deutschen Föderalismus, den er neben Gerhard Anschütz erstattete. In diesem Bereich wird seine wichtigste Leistung für die Staatsrechtswissenschaft erblickt. Den Schwerpunkt des föderalistischen Gedankens fand er nicht in einem Gegensatz zum sogenannten Unitarismus, sondern darin, daß wirksame Mittel zur praktischen Durchsetzung einer starken Reichsgewalt gegenüber partikularistischen Strömungen angestrebt werden. Das Rezept war eine rechtliche Stärkung der Einzelstaaten und ihres Einflusses im Reich und eine Stärkung Preußens, beides konkretisiert in differenzierten Thesen de lege ferenda; so etwa forderte er: Einräumung eines dem Rechte des Reichstags gleichwertigen Mitbeschließungsrechtes des Reichsrates bei der Gesetzgebung des Reiches, eine verfassungsrechtlich statuierte Verantwortlichkeit des Reichskanzlers und der Reichsminister auch gegenüber dem Reichsrat, stärkere Schonung der eigenen Zuständigkeit der Einzelstaaten, Sicherung einheitlicher Abgabe der preußischen Stimmen im Reichsrat, regelmäßige Verbindung des Reichskanzleramtes und des preußischen Ministerpräsidiums in einer Person. Den Neugliederungsartikel 18 der Weimarer Verfassung, der die Einheit des preußischen Staates gefährde und partikularistische Bestrebungen begünstige, wollte er gestrichen wissen. Mit einer kleinen Minderheit von Staatsrechtslehrern, darunter auch Carl Schmitt, lehnte er eine Auslegung der Verfassung ab, die den jeweiligen Fraktionsmehrheiten oder Koalitionen rechtlich gestattete, mit Hilfe der Zweidrittelmajoritäten des Reichstags die Grundlagen der Weimarer Verfassung in Frage zu stellen. Der herrschenden Lehre, die verfassungsändernde Gewalt sei gegenständlich unbeschränkt, man könne also mit den qualifizierten Mehrheiten jede Änderung der Verfassung bis hin zu Staatsform, Gesellschaftsordnung und Grundrechtsverbürgung beschließen, setzte er den Gedanken des Staatsrechts als politischen Rechts, das nicht nur formal verstanden werden kann, entgegen. Die Form des Verfahrens könne nicht Beschlüsse jeden beliebigen Inhalts decken. Den Maßstab für die Grenzen könne man nur finden in den Grundprinzipien des gegebenen Verfassungssystems. (Nationale Demokratie als Grundlage der Weimarer Verfassung, 1929.) Ebenso entschieden wandte er sich gegen eine „Verfassungsumgehung“, die Häufung von Durchbrechungen ohne Änderungen der Verfassungsurkunde, die den Glauben an ihre Unverbrüchlichkeit erschüttere. Diesen Grundgedanken haben erst die Länderverfassungen nach 1945 und das Grundgesetz 1949 zum Durchbruch verholfen. Das Problem der gegenseitigen Durchdringung von Recht und Politik, das darin eingeschlossen ist, hat Bilfinger zeitlebens nicht losgelassen, weder im nationalen noch im internationalen Recht. Schwer zu vereinbaren mit dieser die Reichsgewalt zwar stärkenden, die Individualität der Einzelstaaten aber schonenden und sichernden Tendenz seines bundesstaatlichen Denkens ist die Haltung, die Bilfinger alsbald nach der nationalsozialistischen Machtergreifung gegenüber dem Prozeß der „Gleichschaltung“ einnahm. Diese Umwälzung stellte freilich die Wissenschaft des Staatsrechts vor schwierige Aufgaben, wollte sie sich nicht damit begnügen, den neuen Rechtsstoff zu ordnen und zu werten. Das Reichsstatthaltergesetz vom 7. April 1933, das er in einer 1934 erschienenen Abhandlung eingehend würdigte, hatte die politische „Staaten“-Geltung der deutschen Länder innerhalb des Reiches, also die Kernsubstanz des bisherigen spezifisch deutschen Bundesstaatstypus mit einem Schlag beseitigt. Bilfinger sah in diesem Gesetz „in genialem Wurf und in denkbar schlichter Fassung“ die Aufgabe der rechtlichen Sicherung des Übergangs in die Epoche des dritten Reiches gelöst. Indem es dem Reichskanzler die Verfügung über die Leitung Preußens vorbehielt, habe es überdies die Lösung der preußisch-deutschen Frage praktisch organisiert. Gewiß ist verständlich, daß nach den Erfahrungen der Weimarer Republik Partikularismus und Parlamentarismus als Gegensätze, Hindernisse zur deutschen Einheit empfunden und abgelehnt wurden. Vor die Aufgabe gestellt, den deutschen Staat fest zu begründen und wieder zu einer äußerlich und innerlich freien Gestaltung der deutschen Verfassung zu kommen, entschieden sich auch in der Staatsrechtslehre nicht wenige, sich loszusagen von den westlichen Ideen politischer Formung. Aber das Bekenntnis Bilfingers zu diesem, auf dem Ermächtigungsgesetz vom 24. März 1933 beruhenden Gesetz der Reichsregierung läßt in seinem Überschwang jede Distanz vermissen. Das Gesetz, das eine säkulare Epoche deutscher Verfassungsgeschichte abschließe, war ihm „nach der Kundgebung des Führers vom 1. September 1933 die erste Antwort der deutschen Nation an die Querulanten gegen die Einheit und Größe der Nation“. Verlassen ist hier auch der zuvor gepflegte Vorbehalt gegenüber Verfassungsumgehung und -durchbrechung. An die Staatspraxis der nationalen Revolution, die sich autoritativ für diejenige Auslegung entschieden habe, die im konkreten Fall vom nationalen Standpunkt aus vorzuziehen war, habe sich die positive Staatsrechtslehre zu halten. Überzeugender freilich als auf diese an Artikel 76 der Weimarer Verfassung anknüpfende Begründung stützte er sich dann unmittelbar auf die nationale Revolution selbst als die Grundlage, auf der sich der Bau des neuen Reiches erhebe. Der Aufsatz über das Reichsstatthaltergesetz war Bilfingers letzter Beitrag zu Fragen des innerstaatlichen Rechts. Er wandte sich von nun an – die Grenze kann etwa auf das Datum der Röhm-Affäre Mitte 1934 angesetzt werden – ausschließlich völkerrechtlichen Themen zu. Vielleicht fiel es ihm hier leichter, die eigenen Überzeugungen im Einklang mit der Politik der neuen Machthaber zu halten. Bilfinger hatte längst zuvor das Diktat von Versailles, das untragbare Lasten begründete und eine deutsche Alleinschuld am Kriege festzulegen suchte, mit starker innerer Bewegung als Verletzung von Freiheit und Gerechtigkeit gegeißelt (Nationale Demokratie, 1929). In diesem Urteil waren nicht nur fanatische Nationalisten, sondern weiteste Kreise auch der freiheitlich-demokratischen Kräfte sich einig. So konnte der „Führer“, der dieses Diktat in kühnen Streichen zerriß, darin auf weite Zustimmung rechnen. Auch der Völkerbund, dessen Satzung Bestandteil des Versailler Vertragswerks geworden war, begegnete großer Skepsis. Die Vereinigten Staaten, deren Präsident an seiner Wiege stand, sind ihm nie beigetreten, auch die anderen Großmächte waren nie gleichzeitig seine Mitglieder. Hitler kündigte die deutsche Mitgliedschaft am 14. Oktober 1933 auf. Bilfinger deutete den Völkerbund, der also keine universelle Staatengemeinschaft war, als einen durch alle Mittel politischer Macht unterstützten Versuch, zur Sicherung der Diktate von 1919 das Völkerrecht aus den Angeln zu heben, als einen Angriff gegen die Struktur des Völkerrechts als der Rechtsgemeinschaft unabhängiger gleichberechtigter Staaten. Bilfinger stand auch damit nicht allein. Er nannte den Bund gar ein System der Gewalt im Gewande des Rechts (1940). In der Völkerrechtswissenschaft wird der Völkerbund noch heute unter den Instrumenten „der angelsächsischen Doppelhegemonie“ genannt (Grewe, 1984). Bilfinger griff solche Themen des Völkerrechts in einer Reihe von Beiträgen auf, die nach Ausbruch des Zweiten Weltkriegs verstärkt polemischen Charakter annahmen. Zu berechtigter Empörung fehlte es an Anlässen nicht, so etwa die britische Bombardierung des finnischen Überseehafens Petsamo ohne Kriegserklärung an das kleine Finnland, das kein anderes Ziel hatte, als das ihm soeben geraubte Karelien zurückzugewinnen (Die Stimson-Doktrin, 1943). Daß solche Schriften in Kriegszeiten das nationale Interesse hervorkehren, ist legitim. Nicht zu verkennen ist auch, daß die Lage der „Habenichtse“ – Deutschland, Italien, Japan –, die etwas zu gewinnen und zu erobern suchten, eine andere war als die Lage derer, die früher gewonnenen Besitz zu halten suchten, daß demnach auch die Wissenschaft vom Völkerrecht von verschiedenen Sichtweisen ausging, je nach dem politischen Standort. Das Völkerrecht, aus politischen Situationen und Fragestellungen entwickelt, ist gewiß kein vollkommenes, allein der Gerechtigkeit dienendes Recht. Aber der Boden wissenschaftlicher Diskussion ist streckenweise verlassen, wenn Bilfinger für den Zweiten Weltkrieg sagt, dieser Krieg, den England gegen Deutschland veranstaltet habe, zeige die charakteristischen technischen Merkmale eines Kreuzzuges des Völkerbundes zur Sicherung und Expansion der Vormacht Englands, wobei der am 25. August 1939 begründete Beistandspakt Großbritanniens mit Polen und der deutsche Angriff auf dieses Land kaum erwähnt wird (Der Völkerbund als Instrument britischer Machtpolitik, 1940, S. 17, 39). Mit der Übernahme der Professur in Berlin übernahm Bilfinger 1944 zugleich die Leitung des Kaiser-Wilhelm-Instituts für Ausländisches Öffentliches Recht und Völkerrecht, die bisher sein Vetter Viktor Bruns innehatte. Das Institut mit seiner Bibliothek ging im Bombenkrieg unter. Nach Heidelberg zurückgekehrt, richtete Bilfinger es 1949 bis 1954 als Max-Planck-Institut wieder auf und brachte es zu neuer Blüte. Spätere Veröffentlichungen befassen sich mit der Friedensordnung und der Lage der Völkerrechtswissenschaft unter den veränderten weltpolitischen Voraussetzungen. Bis zum letzten Tage war er mit einem seit langem erwogenen Problem befaßt: Der Spannung zwischen dem politischen Gestaltungswillen und seinen normativen Schranken bei Bismarck. Ein Urteil aus heutiger Sicht läuft Gefahr, die inzwischen grundlegend veränderten Verhältnisse außer Acht zu lassen, die den Lebensweg, die Anschauungen und auch die Irrtümer dieser Persönlichkeit bedingt haben und in gewissem Sinne auch verständlich machen. Ungeachtet der Irrtümer, die er mit vielen Zeitgenossen teilt und die ihn als Kind seiner Zeit erweisen, genießt Bilfinger über den Tod hinaus hohes Ansehen. Mit dem Max-Planck-Institut ist sein Name für viele Jahre des Aufbaus untrennbar verbunden. Die ihm nahestanden, rühmen ihn als edlen Menschen, ausgestattet mit Weisheit, Charme und Humor. Daß er nicht nur ein bedeutender Gelehrter war, sondern auch in seiner beruflichen Arbeit ein weiser und vornehmer Mann, gütig und von höchstem persönlichen Reiz, dafür steht mit seinem Nachruf der große Rudolf Smend ein. |
|---|---|
| Werke: | Der Einfluß der Einzelstaaten auf die Bildung des Reichswillens. Eine staatsrechtliche und politische Studie, Tübingen 1923. Teilabdruck zuvor als Tübinger Dissertation, 1922; Der deutsche Föderalismus in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, Mitbericht, in: Veröffentlichungen der Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer, Heft 1, 1924; Verfassungsumgehung, Betrachtung zur Auslegung der Weimarer Verfassung, in: Archiv des öffentlichen Rechts, N. F. 11. Der ganzen Folge 50. Band (1926), 163-191; Verfassungsrecht als politisches Recht, in: Zeitschrift für Politik, Jg. 1928, 281-298; Der Reichssparkommissar, Berlin 1928; Der Reichsrat. Bedeutung und Zusammenfassung. Zuständigkeit und Verfahren, in: Handbuch des deutschen Staatsrechts I, 545-567; Nationale Demokratie als Grundlage der Weimarer Verfassung, Halle (Saale) 1929 (Hallesche Universitätsreden 43); Exekution, Diktatur und Föderalismus, in: Deutsche Juristen-Zeitung 1932, Sp. 1017-1021; Das Reichsstatthaltergesetz, in: Archiv des öffentlichen Rechts, N. F. 24. Band (1934), 131-165; Der Streit um die deutsch-österreichische Zollunion, in: Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht 3 (1933) Teil I, 163 ff.; Völkerbundsrecht gegen Völkerrecht, München 1938 (Vortrag am 29. Oktober 1937). Schriften der Akademie für Deutsches Recht Gruppe Völkerrecht, Nr. 6; Der Völkerbund als Instrument britischer Machtpolitik, Berlin 1940 (Schriften des Deutschen Instituts für außenpolitische Forschung und des Hamburger Instituts für auswärtige Politik Heft 9); Völkerrecht und Staatsrecht in der Deutschen Verfassungsgeschichte, Hamburg 1941; Das wahre Gesicht des Kellogpakts, Berlin 1942; Die Stimsondoktrin, Essen 1943; Friede durch Gleichgewicht der Macht?, in: Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht Band XIII (1950/51), 27-56; Vom politischen und nicht-politischen Recht in organisatorischen Kollektivverträgen. Schuman-Plan und Organisation der Welt, in: ebd. 615-659; Zur Lage der völkerrechtlichen Forschung, in: Jahrbuch 51 der Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, 1951; Vollendete Tatsache und Völkerrecht. Eine Studie, in: Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht Band 15 (1953/54), 453-481; Über die Änderung territorialer Grenzen als Kriegsfolge, in: Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht Band 16 (1955/56), 207-226; Gedanken zur Lage des Völkerrechts, in: Gedächtnisschrift für Walter Jellinek 12. Juli 1885-9. Juni 1955, hg. von Otto Bachof u. a., München 1955, 67-76. |
| Nachweis: | Bildnachweise: in: G. Schreiber, H. Mosler, C. Bilfinger zum 75. Geburtstag (vgl. Literatur). |
Literatur + Links
| Literatur: | Georg Schreiber, Hermann Mosler, Zum Geleit, in: C. Bilfinger zum 75. Geburtstag ..., gewidmet von Mitgliedern und Freunden des Instituts, Berlin, Köln 1954 (Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, Heft 29, Völkerrechtliche und staatsrechtliche Abhandlungen); Wilhelm Hahn/Rolf Serick, Nachruf vom 18. Dezember 1958 (Rektor der Universität und Dekan der Juristischen Fakultät); Hermann Mosler, C. Bilfinger, in: Mitteilungen aus der Max-Planck-Gesellschaft, Jg. 1959, 174-179; Rudolf Smend, C. Bilfinger +, in: Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht Band 20 (1959/60), 1-4; Weizsäcker, in: Meyers großes Personenlexikon, 1968, 1390; Professor C. Bilfinger. Vom Legationsrat zum Max-Planck-Chef, in: Mannheimer Morgen und Heidelberger Tageblatt vom 20.1.1979; Hermann Mosler, C. Bilfinger. Zur 100. Wiederkehr seines Geburtstages, in: Rhein-Neckarzeitung vom 19.1.1979; Wilhelm Grewe, Epochen der Völkerrechtsgeschichte, 1. Aufl. 1984. |
|---|







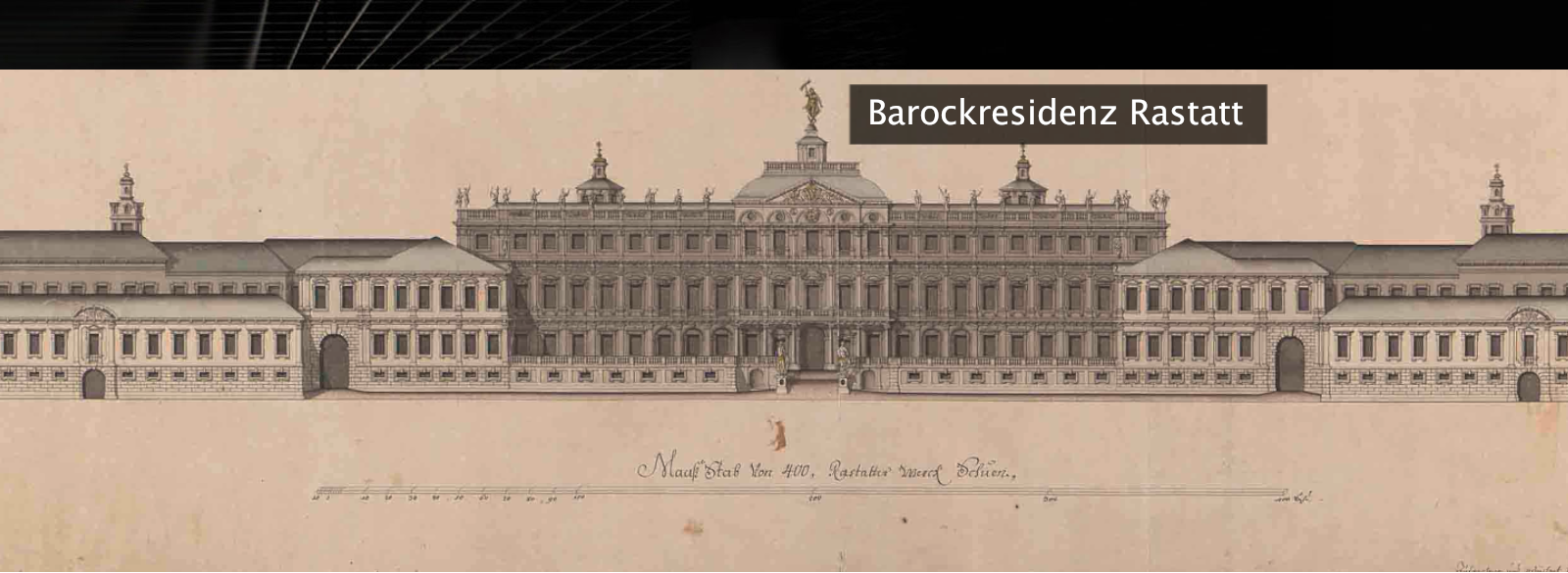



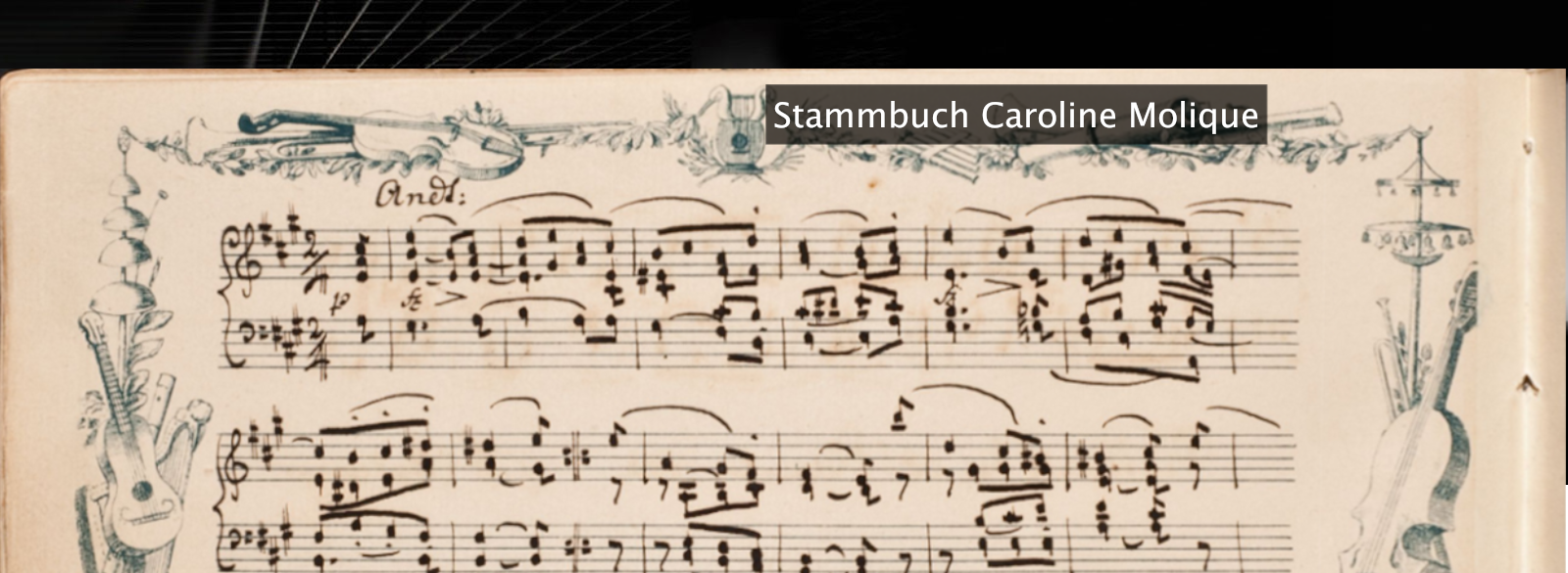





















































 leobw
leobw