Aach
![Bild von Aach]()
Park an der Aachquelle, Aach [Quelle: Aach]
![Bild von Aach]()
Ortsmitte, Aach [Quelle: Aach]
![Bild von Aach]()
Quellbecken der Aachquelle, Aach [Quelle: Aach]
![Bild von Aach]()
Aach [Quelle: Aach]
![Bild von Aach]()
Unteres Tor, Aach [Quelle: Aach]
![Luftbild: Film 66 Bildnr. 104, Bild 1]()
Luftbild: Film 66 Bildnr. 104, Bild 1 [Quelle: Landesarchiv BW] /
Zur Detailseite ![Luftbild: Film 64 Bildnr. 429, Bild 1]()
Luftbild: Film 64 Bildnr. 429, Bild 1 [Quelle: Landesarchiv BW] /
Zur Detailseite ![Aach: Aachtopf, 1990]()
Aach: Aachtopf, 1990 [Copyright: Landesmedienzentrum Baden-Württemberg; 01.06.1990] /
Zur Detailseite ![Luftbild: Film 64 Bildnr. 382, Bild 1]()
Luftbild: Film 64 Bildnr. 382, Bild 1 [Quelle: Landesarchiv BW] /
Zur Detailseite ![Aach: Aachtopf, 1990]()
Aach: Aachtopf, 1990 [Copyright: Landesmedienzentrum Baden-Württemberg; 01.06.1990] /
Zur Detailseite ![Luftbild: Film 64 Bildnr. 431, Bild 1]()
Luftbild: Film 64 Bildnr. 431, Bild 1 [Quelle: Landesarchiv BW] /
Zur Detailseite ![Aach: Detail eines alten Schlitten]()
Aach: Detail eines alten Schlitten [Copyright: Landesmedienzentrum Baden-Württemberg] /
Zur Detailseite ![Luftbild: Film 64 Bildnr. 428, Bild 1]()
Luftbild: Film 64 Bildnr. 428, Bild 1 [Quelle: Landesarchiv BW] /
Zur Detailseite ![Luftbild: Film 64 Bildnr. 426, Bild 1]()
Luftbild: Film 64 Bildnr. 426, Bild 1 [Quelle: Landesarchiv BW] /
Zur Detailseite ![Luftbild: Film 66 Bildnr. 103, Bild 1]()
Luftbild: Film 66 Bildnr. 103, Bild 1 [Quelle: Landesarchiv BW] /
Zur Detailseite ![Luftbild: Film 66 Bildnr. 102, Bild 1]()
Luftbild: Film 66 Bildnr. 102, Bild 1 [Quelle: Landesarchiv BW] /
Zur Detailseite ![Aach: Aachtopf, 1990]()
Aach: Aachtopf, 1990 [Copyright: Landesmedienzentrum Baden-Württemberg; 01.06.1990] /
Zur Detailseite ![Luftbild: Film 66 Bildnr. 106, Bild 1]()
Luftbild: Film 66 Bildnr. 106, Bild 1 [Quelle: Landesarchiv BW] /
Zur Detailseite ![Luftbild: Film 64 Bildnr. 430, Bild 1]()
Luftbild: Film 64 Bildnr. 430, Bild 1 [Quelle: Landesarchiv BW] /
Zur Detailseite ![Luftbild: Film 66 Bildnr. 105, Bild 1]()
Luftbild: Film 66 Bildnr. 105, Bild 1 [Quelle: Landesarchiv BW] /
Zur Detailseite ![Luftbild: Film 64 Bildnr. 386, Bild 1]()
Luftbild: Film 64 Bildnr. 386, Bild 1 [Quelle: Landesarchiv BW] /
Zur Detailseite ![Wappen von Aach]()
In Rot ein goldener (gelber) Löwe mit drei zwischen den Pranken verteilten silbernen (weißen) Sternen. /
Zur Detailseite ![Luftbild: Film 64 Bildnr. 427, Bild 1]()
Luftbild: Film 64 Bildnr. 427, Bild 1 [Quelle: Landesarchiv BW] /
Zur Detailseite ![Luftbild: Film 66 Bildnr. 101, Bild 1]()
Luftbild: Film 66 Bildnr. 101, Bild 1 [Quelle: Landesarchiv BW] /
Zur Detailseite Previous Next Die Stadt Aach liegt im nordöstlichen Teil des Landkreises Konstanz. Ihr Territorium erstreckt sich zwischen der Hegau-Alb im Norden und der Singener Niederung im Süden. Die Landschaft ist durch die Gletschervorstöße der Eiszeiten geformt. Naturräumlich gehört das Stadtgebiet zur übergeordneten Einheit des Hegau. Der Quelltopf der Aach ist die größte Karstquelle Deutschlands. Er weist ebenso wie zwei durch Höhleneinsturz entstandene Dolinen dieser Quelle auf die starke Verkarstung der Landschaft hin. Der höchste Punkt liegt am Dornsberg im Norden auf 649,81 m, der tiefste Punkt auf 445,19 m an der Aach. Die Stadt Aach kam 1806 zunächst an Württemberg, gelangte aber 1810 an Baden. Im gleichen Jahr wurde hier ein Unteramt errichtet, die Stadt aber 1811 dann dem Amt Stockach zugewiesen. Bis 1883 gehörte Aach zum Bezirksamt Stockach, kam dann bis 1936 zum Bezirksamt Engen und gehörte seit 1939 wieder zum Bezirksamt und späteren Landkreis Stockach. Mit dessen Auflösung 1973 gelangte die Stadt zum Landkreis Konstanz. Seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges hat sich die Stadt dynamisch entwickelt. Bis zur Mitte der 1960er Jahre wurden großflächige Siedlungsgebiete am Südwestrand erschlossen. In den 1970er und den 1980er Jahren konzentrierte sich die Bebauung dann auf ausgedehnte Flächen am südöstlichen und östlichen Ortsrand. In Fortsetzung dieser Bebauung nach Süden entstanden ab den 80ern dann entlang der L189 große Gewerbeflächen im Hirtenstall und am Weitenriedweg, die Ende der 1990er Jahre nochmals erweitert wurden und nunmehr den baulichen Anschluss zur Nachbargemeinde Volkertshausen herstellen. Am Ettenberg wurden zudem große Sportanlagen errichtet. Der Anschluss an den ÖPNV erfolgt durch den Verkehrsverbund Hegau-Bodensee. Bahnanschluss besteht nur in Mühlhausen-Ehingen (5 km) und in Singen (12 km). An das Fernstraßennetz ist die Stadt über die B31, B33 sowie die A81 und A98 am Autobahnkreuz Hegau angeschlossen.
Teilort
Wohnplatz
Wüstung
Die Stadtgemarkung im Nordosten des Landkreises liegt im Jungmoränengebiet des nördlichen Bodensee- und Hegaubeckens und erstreckt sich größtenteils in den Engen-Langensteiner Randhöhen zwischen der Hegau-Alb im Norden und der Singener Niederung im Süden. Sie bestehen aus Massen- und Trümmerkalken des Weißjuras Zeta 1-3, auf denen weitgehend Grund-, Endmoränen und Schmelzwasserrinnen das eiszeitlich bedingte Oberflächenrelief gestalten. Der Aachtopf, die größte Karstquelle Deutschlands, und zwei durch Höhleneinsturz bedingte Dolinen nördlich dieser Quelle weisen auf die starke Verkarstung und Zerklüftung der Weiß juraschichten hin. Der im Tal der Aach gelegene Ortsteil Dorf Aach ist eine langgestreckte Siedlung mit häufendorfartigen Kernen im Westen und Nordosten. Die eigentliche Stadt Aach mit einem etwa unregelmäßig rechteckigen Mauerbering, auf dem die äußeren Häuser der Stadtanlage sitzen, nimmt eine Berglage auf einem südlicher Ausläufer der Weißjura-Hochfläche ein und hat einen unregelmäßigen, der Bergtopographie angepaßten Grundriß mit der Kirche im Südosten und dem Marktplatz am Nordostrand sowie Toren im Süden und Norden. Neubaubereiche im Südosten und Südwesten des Stadtbergs.
![]()
Wanderungsbewegung Aach
![]()
Natürliche Bevölkerungsbewegung Aach
![]()
Bevölkerungsdichte Aach
![]()
Altersstruktur Aach
![]()
Bundestagswahlen (ab 1972) Aach
![]()
Europawahlen Aach
![]()
Landtagswahlen (ab 1972) Aach
![]()
Schüler nach Schularten Aach
![]()
Übergänge an weiterführende Schulen Aach
![]()
Beschäftigte nach Wirtschaftsbereichen (aktuell) Aach
![]()
Aus- und Einpendler Aach
![]()
Bestand an Kfz Aach
Previous Next 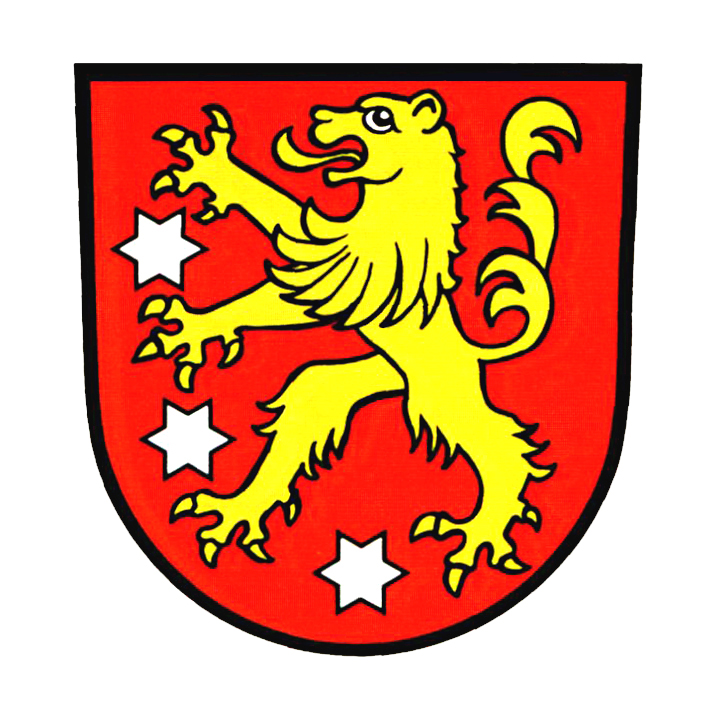
In Rot ein goldener (gelber) Löwe mit drei zwischen den Pranken verteilten silbernen (weißen) Sternen.
Beschreibung Wappen
Die Gemeinde besteht aus dem im Tal gelegenen Dorf Aach und der Stadt gleichen Namens auf dem Berg. Die Stadtrechte erwarb Aach um 1300, also in der Zeit, als es an Habsburg kam. Nach verschiedentlichen Verpfändungen wurde die Stadt 1543 der vorderösterreichischen Landgrafschaft Nellenburg eingegliedert, ging 1806 an Württemberg und 1810 an Baden über. Der Wappenschild erscheint in dieser Form bereits seit 1306 in Siegelabdrücken. Der Löwe kann als Hinweis auf die Zugehörigkeit zu Habsburg gelten. Die Sterne dienten zur Unterscheidung vom Wappen der Herrschaft. Die Farben wurden im Jahre 1902 festgelegt. Am 25. September 1961 erhielt Aach durch das Innenministerium das Recht zur Führung einer Flagge verliehen.
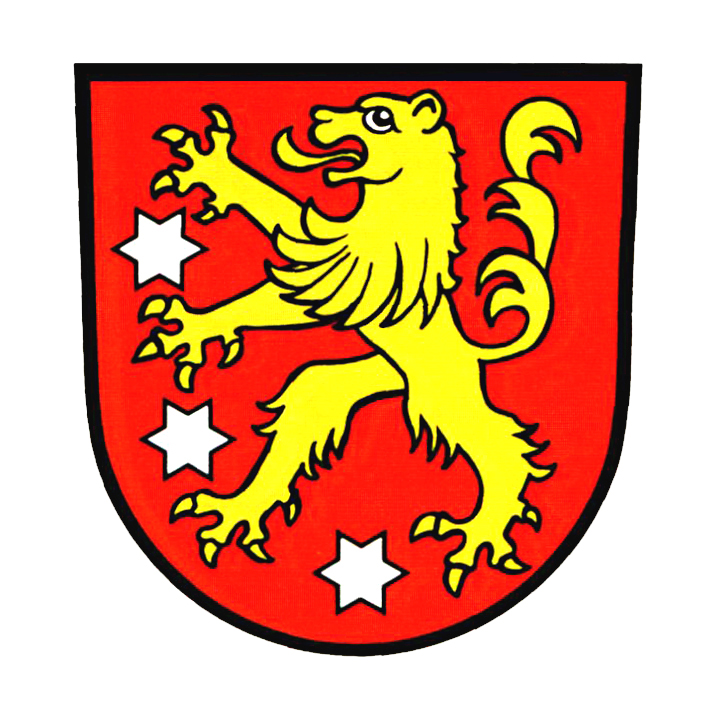























































































 leobw
leobw