Steinhausen an der Rottum
| Regionalauswahl: | |
|---|---|
| Typauswahl: | Gemeinde |
| Status: | Gemeinde |
| Homepage: | http://www.steinhausen-rottum.de |
| service-bw: | Informationen zu wichtigen Adressen, Nummern und Öffnungszeiten in Steinhausen an der Rottum |
| Einwohner: | 2009 |
| Bevölkerungsdichte (EW/km²): | 67.0 |
| Max. Höhe ü. NN (m): | 703.48 |
| Min. Höhe ü. NN (m): | 602.98 |
| PLZ: | 88416 |
Visitenkarte
Die Gemeinde Steinhausen an der Rottum liegt im Süden des Landkreises Biberach an der Grenze zum benachbarten Landkreis Ravensburg. Im Norden grenzt das Gemeindegebiet an das Stadtgebiet Ochsenhausen; im Süden reicht es bis über das Tal des Ölbachs hinaus. Die bei Ochsenhausen zusammenlaufenden beiden Rottumtäler zerschneiden die Hochfläche, die überwiegend dem flachwelligen Altmoränenland zuzuordnen ist. Das ausgeglichene Relief wird durch mehrere von Nordwest nach Südost verlaufende Höhenrücken und Kuppenreihen gegliedert. Der höchste Punkt liegt mit 703 m im (Wald-)Distrikt Weiche, der tiefste Punkt mit 602 m NN im Rottumtal. Steinhausen geht wohl auf eine ältere Siedlung Oberstetten zurück und erhielt seine Benennung erst im Spätmittelalter. Der vorher zum Kloster Ochsenhausen gehörende Ort gelangte 1806 an Württemberg. Mit der Aufhebung der Patrimonialämter 1809 kam Steinhausen mit Ochsenhausen an das Oberamt Ochsenhausen und von diesem 1810 zum Oberamt Biberach, das 1938 im gleichnamigen Landkreis aufging. Der nicht am Lauf der Rottum, sondern auf der Hochflächer über dem Talgrund liegende Hauptort hat seit 1945 nur wenig Erweiterungen erfahren. Ende der 1960er Jahre wurde eingrößeres Neubaugebiet am nördlichen Ortsrand zwischen Oberstetter Straße und dem Talhang erschlossen. Auf der entgegengesetzten Seite des Dorfes wurden Kindergarten, Bankfiliale sowie Turn- und Festhalle als moderne Erweiterung neu errichtet. Ein kleines Gewerbegebiet wurde am Ortsausgang in Richtung Ochsenhausen eingerichtet.
Ortsteile
Teilort
Wohnplatz
- Ehrensberg - Wohnplatz
- Emishalden - Wohnplatz
- Englisweiler - Wohnplatz
- Eyrishof - Wohnplatz
- Felsenbauerhof - Wohnplatz
- Fink - Wohnplatz
- Floris - Wohnplatz
- Franzenweber - Wohnplatz
- Geberstein - Wohnplatz
- Griesers - Wohnplatz
- Herrmann - Wohnplatz
- Hiller - Wohnplatz
- Hirschbronn - Wohnplatz
- Hofmeisters - Wohnplatz
- Josestefeshof - Wohnplatz
- Kammerlander - Wohnplatz
- Kappelershof - Wohnplatz
- Kemnat - Wohnplatz
- Königs - Wohnplatz
- Kräutle - Wohnplatz
- Küchele - Wohnplatz
- Küfers - Wohnplatz
- Küfer - Wohnplatz
- Landtaler - Wohnplatz
- Lippes - Wohnplatz
- Löhlis - Wohnplatz
- Martens - Wohnplatz
- Matlacher Hof - Wohnplatz
- Micheles - Wohnplatz
- Morizenhof - Wohnplatz
- Nasemichel - Wohnplatz
- Neubauer - Wohnplatz
- Niklas - Wohnplatz
- Petershof - Wohnplatz
- Pfeffershof - Wohnplatz
- Prinzebene - Wohnplatz
- Riedwanger - Wohnplatz
- Salenhäusle - Wohnplatz
- Salenhof - Wohnplatz
- Sattlershof - Wohnplatz
- Schäfer - Wohnplatz
- Schiele - Wohnplatz
- Schlossberg - Wohnplatz
- Schlossers - Wohnplatz
- Schultheiß - Wohnplatz
- Schwaldes - Wohnplatz
- Schweglers - Wohnplatz
- Semeshäusle - Wohnplatz
- Semeshof - Wohnplatz
- Soldatenhäusle - Wohnplatz
- Soldatenhof - Wohnplatz
- Speineßenhof - Wohnplatz
- Stadelhaus - Wohnplatz
- St. Anna-Kapelle - Wohnplatz
- Stauber - Wohnplatz
- Strickershof - Wohnplatz
- Stricker - Wohnplatz
- Taubenhaus - Wohnplatz
- Thomas - Wohnplatz
- Wangershof - Wohnplatz
- Wäsele - Wohnplatz
- Weber - Wohnplatz
- Weiß - Wohnplatz
- Wirtles - Wohnplatz
- Wirtschaft - Wohnplatz
- Zellshof - Wohnplatz
- Ziegelhütte - Wohnplatz
- Ziegler - Wohnplatz
- Ziegleshof - Wohnplatz
aufgegangener Ort
Topographie
Gemeindegebiet im Altmoränenland. In die flachwellige Hochfläche der Grundmoräne mit tiefgründigen Geschiebelehmböden sind die Täler der beiden Quellbäche der Rottum streckenweise steilrandig bis in ältere eiszeitliche Ablagerungen und in die Obere Süßwassermolasse eingeschnitten. Der Nordostzipfel des Gebiets liegt bereits außerhalb der rißeiszeitlichen Endmoräne im tertiären Hügelland.
Wappen
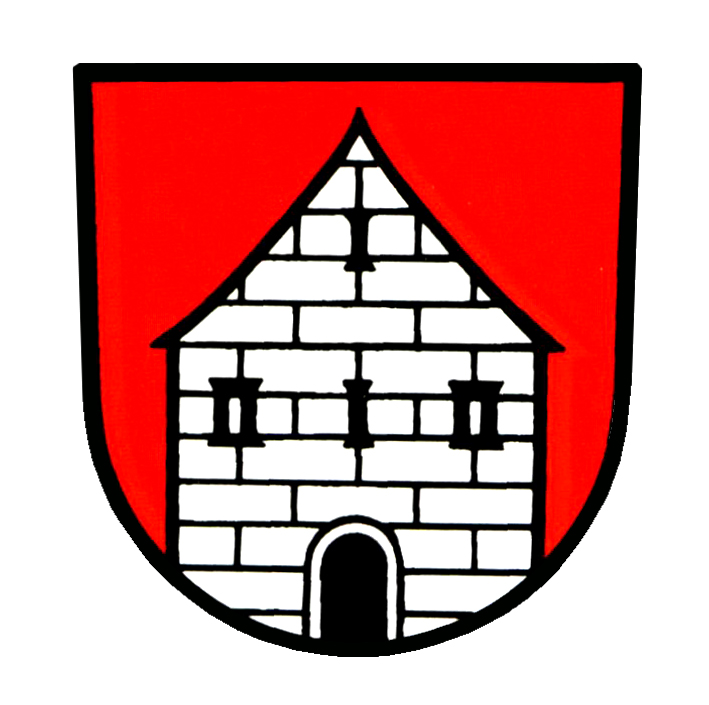
In Rot ein aus dem Unterrand emporkommendes, gemauertes silbernes (weißes) Steinhaus (Giebelseite) mit rundbogigem schwarzem Tor und sechs schartenartigen Fenstern.
Beschreibung Wappen
In den Jahren zwischen 1930 und 1939 hat die Gemeinde die naturalistische Abbildung einer Feldkapelle als Siegelbild in ihre Dienstsiegel aufgenommen. Nach der Überlieferung wurde eine frühere Pfarrkirche 1392 abgebrochen und an der Stelle der offenen Feldkapelle „zum Steinhaus" neu gebaut. An diese Bezeichnung und damit an den Gemeindenamen erinnert das Bild des am 4. Februar 1969 vom Innenministerium zusammen mit der Flagge verliehenen Wappens.























































































 leobw
leobw