Bad Herrenalb
![Bild von Bad Herrenalb]()
Kurhaus und Kurpark, Bad Herrenalb [Quelle: Bad Herrenalb]
![Bild von Bad Herrenalb]()
Ehemaliges Kloster, Bad Herrenalb [Quelle: Bad Herrenalb]
![Bild von Bad Herrenalb]()
Falkensteinfelsen, Bad Herrenalb [Quelle: Bad Herrenalb]
![Bild von Bad Herrenalb]()
Siebentäler-Therme, Bad Herrenalb [Quelle: Bad Herrenalb]
![Bild von Bad Herrenalb]()
Trinkhalle im Kurhaus, Bad Herrenalb [Quelle: Bad Herrenalb]
![Luftbild: Film 9 Bildnr. 27, Bild 1]()
Luftbild: Film 9 Bildnr. 27, Bild 1 [Quelle: Landesarchiv BW] /
Zur Detailseite ![Bad Herrenalb: Das Paradies 1925]()
Bad Herrenalb: Das Paradies 1925 [Copyright: Landesmedienzentrum Baden-Württemberg; 11.07.1925] /
Zur Detailseite ![Luftbild: Film 11 Bildnr. 100, Bild 1]()
Luftbild: Film 11 Bildnr. 100, Bild 1 [Quelle: Landesarchiv BW] /
Zur Detailseite ![Herrenalb]()
Herrenalb [Copyright: Württembergische Landesbibliothek Stuttgart] /
Zur Detailseite ![Luftbild: Film 4 Bildnr. 199, Bild 1]()
Luftbild: Film 4 Bildnr. 199, Bild 1 [Quelle: Landesarchiv BW] /
Zur Detailseite ![Luftbild: Film 11 Bildnr. 95, Bild 1]()
Luftbild: Film 11 Bildnr. 95, Bild 1 [Quelle: Landesarchiv BW] /
Zur Detailseite ![Luftbild: Film 4 Bildnr. 167, Bild 1]()
Luftbild: Film 4 Bildnr. 167, Bild 1 [Quelle: Landesarchiv BW] /
Zur Detailseite ![Luftbild: Film 4 Bildnr. 237, Bild 1]()
Luftbild: Film 4 Bildnr. 237, Bild 1 [Quelle: Landesarchiv BW] /
Zur Detailseite ![Herrenalb]()
Herrenalb [Copyright: Württembergische Landesbibliothek Stuttgart] /
Zur Detailseite ![Luftbild: Film 4 Bildnr. 189, Bild 1]()
Luftbild: Film 4 Bildnr. 189, Bild 1 [Quelle: Landesarchiv BW] /
Zur Detailseite ![Luftbild: Film 4 Bildnr. 193, Bild 1]()
Luftbild: Film 4 Bildnr. 193, Bild 1 [Quelle: Landesarchiv BW] /
Zur Detailseite ![Luftbild: Film 4 Bildnr. 195, Bild 1]()
Luftbild: Film 4 Bildnr. 195, Bild 1 [Quelle: Landesarchiv BW] /
Zur Detailseite ![Luftbild: Film 9 Bildnr. 102, Bild 1]()
Luftbild: Film 9 Bildnr. 102, Bild 1 [Quelle: Landesarchiv BW] /
Zur Detailseite ![Schreiben von Emilie Göler an die Großherzogin Luise; Gedanken zum Beginn des neuen Schuljahres; Aufenthalt in Bad Herrenalb, Bild 1]()
Schreiben von Emilie Göler an die Großherzogin Luise; Gedanken zum Beginn des neuen Schuljahres; Aufenthalt in Bad Herrenalb, Bild 1 [Quelle: Generallandesarchiv Karlsruhe] /
Zur Detailseite ![Luftbild: Film 9 Bildnr. 29, Bild 1]()
Luftbild: Film 9 Bildnr. 29, Bild 1 [Quelle: Landesarchiv BW] /
Zur Detailseite ![Luftbild: Film 9 Bildnr. 104, Bild 1]()
Luftbild: Film 9 Bildnr. 104, Bild 1 [Quelle: Landesarchiv BW] /
Zur Detailseite ![[Herrenalb]]()
[Herrenalb] [Copyright: Württembergische Landesbibliothek Stuttgart] /
Zur Detailseite ![Museum Bad Herrenalb - Feierabendziegel Sammlung Bernt]()
Museum Bad Herrenalb - Feierabendziegel Sammlung Bernt [Copyright: Popp] /
Zur Detailseite Previous Next BBad Herrenalb befindet sich im äußersten Nordwesten des Landkreises Calw. Auf dem 33,03 qkm großen Stadtgebiet stößt die zu den Randplatten des Nordschwarzwalds zählende Albtalplatte, die sich aus den Schichten des Oberen Buntsandstein zusammensetzt, auf den waldreichen und dünnbesiedelten Grindenschwarzwald von Süden, der ebenso von der mächtigen Stufe des Hauptbuntsandsteins geformt ist wie der Nördliche Talschwarzwald, der im äußersten Nordwesten bei Bernbach in das Areal hineinragt. Die Alb, die sich tief in das Relief eingetalt hat, markiert im Norden an der Grenze zu Marxzell auf rd. 320 m NN den tiefsten Punkt des Geländes, das im Süden auf dem Lerchenstein etwa 947 m NN ansteigt. Der Landesentwicklungsplan weist die Stadt der Randzone um den Verdichtungsraum Karlsruhe/Pforzheim zu. Herrenalb entstand als Siedlung um das um 1150 von Graf Berhold III. von Eberstein gegründete Zisterzienserkloster Alba. Dieses büßte 1497 seine Reichsunmittelbarkeit gegen die württembergische Oberhoheit ein, der auch Bernbach, Neusatz und Rotensol unterstanden. 1535 hob Württemberg die Abtei mit der Einführung der Reformation auf. Bis 1808 Klosteramt, kamen Herrenalb und die drei Dörfer zum Oberamt Neuenbürg. Als dieses 1938 aufgelöst wurde, gelangten die vier Gemeinden 1973 zum Landkreis Calw. 1791 zur bürgerlichen Gemeinde und 1897 zur Stadt erhoben, führt Herrenalb, das 1840/41 mit einer Kaltwasserheilanstalt den Badebetrieb begann, seit 26. Juli 1971 den Titel „Bad“. 1972 wurden Rotensol und Neusatz, 1975 Bernbach eingemeindet.
Teilort
Wohnplatz
mehr
aufgegangener Ort
Das Stadtgebiet, das weitgehend den Einzugsbereich des oberen Albtals umfaßt, liegt am Nordwest-Rand der stark zerkuppten Enzhöhen. Südlich von Bad Herrenalb ist der obere Gaisbach mit seinen Quellbächen in den granitischen Grundgebirgssockel des Nordschwarzwaldes eingeschnitten, die Hänge sind mit Steinhalden und Blockstreu übersät. Die Schichten des Rotliegenden gestalten vor allem unmittelbar unterhalb der Stadt an den Felsen des Falkensteins, an den steilen Talflanken der Alb und in dem von einer nordwestwärts streichenden Verwerfung durchzogenen Bernbachtal im Norden des Stadtgebiets das Oberflächenbild. Über dem kristallinen Sockel erheben sich die stark bewaldeten Bergrücken und Kuppen des Buntsandsteins, dessen gesamtes Schichtenpaket bis zum Oberen Konglomerat auf den Höhen aufgeschlossen ist. Am Wurstberg unmittelbar südlich der Stadt erreichen diese fast 700 m, am Lerchenstein und Langmartskopf an der Südgrenze des Stadtgebietes knapp 950 m NN. Das nordöstlich Stadtgebiet um Rotensol und Neusatz, das bereits zu den nach Norden abfallenden Randplatten des Nordschwarzwaldes zählt, hat Hochflächencharakter mit an der Oberfläche anstehenden Gesteinen des Oberen Buntsandsteins. Das Tal der Alb ist besonders unterhalb der Stadt als breites Sohlental ausgebildet, auf dessen Talboden die Seitenbäche Schwemmfächer aufgeschoben haben. Bis auf die Täler von Alb und Gaisbach, die noch in den Granit reichen, sind die übrigen als Kerbtäler in den Mittleren und Unteren Buntsandstein eingesägt.
![]()
Wanderungsbewegung Bad Herrenalb
![]()
Natürliche Bevölkerungsbewegung Bad Herrenalb
![]()
Bevölkerungsdichte Bad Herrenalb
![]()
Altersstruktur Bad Herrenalb
![]()
Bundestagswahlen (ab 1972) Bad Herrenalb
![]()
Europawahlen Bad Herrenalb
![]()
Landtagswahlen (ab 1972) Bad Herrenalb
![]()
Schüler nach Schularten Bad Herrenalb
![]()
Übergänge an weiterführende Schulen Bad Herrenalb
![]()
Beschäftigte nach Wirtschaftsbereichen (aktuell) Bad Herrenalb
![]()
Aus- und Einpendler Bad Herrenalb
![]()
Bestand an Kfz Bad Herrenalb
Previous Next 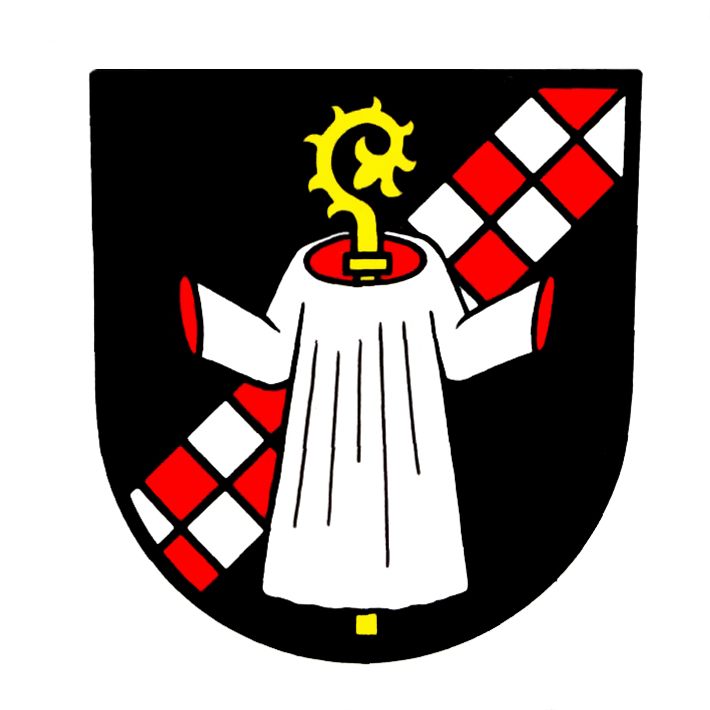
In Schwarz ein doppelreihig rot-silbern (weiß) geschachter Schräglinksbalken, überdeckt mit einer rot gefütterten silbernen (weißen) Albe, durch die ein pfahlweis gestellter, linksgewendeter goldener (gelber) Abtsstab gesteckt ist.
Beschreibung Wappen
Den Ursprung der Siedlung am Oberlauf der Alb bildete das 1149 gestiftete und 1535 reformierte Zisterzienserkloster Herrenalb. Die 1791 aus ehemaligem Kloster und Klosterweiler gebildete bürgerliche Gemeinde entwickelte sich zu einem Kurort, der 1887 zur Stadt erhoben wurde und seit 1971 das Prädikat „Bad" führt. Das älteste Siegel der Gemeinde zeigte schon um 1800 den geschachten sogenannten Zisterzienserbalken schräggekreuzt mit einem Abtsstab. Ende des 19. Jahrhunderts übernahm die Stadt das ehemalige Klosterwappen, welches sie bis heute führt. Es ist „redend" für den Kloster- und Ortsnamen, da ihm das Wortspiel mit der Albe, dem weißen Chorrock der Mönche, und dem Flussnamen Alb zugrundeliegt.
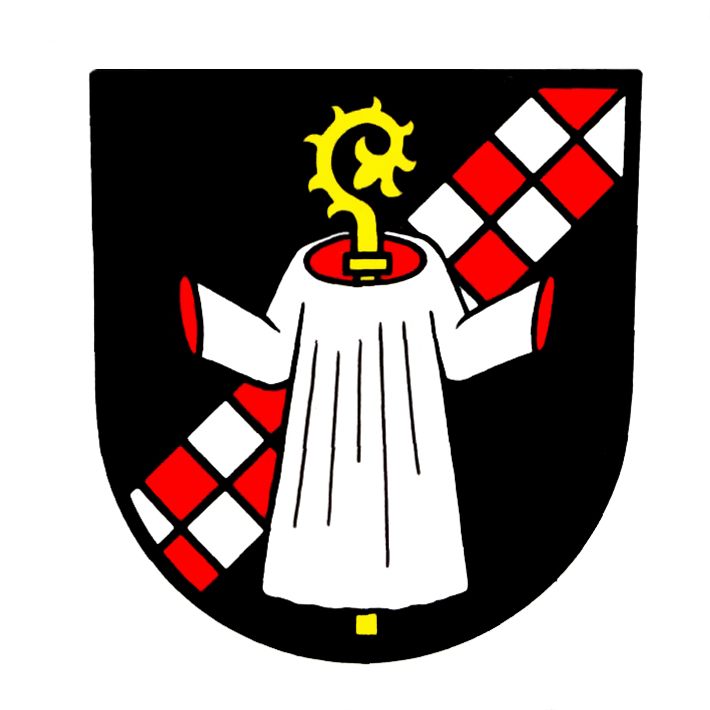











































![[Herrenalb]](/media/wlb_digitalisate/current/delivered/images/urn-nbn-de-bsz-24-digibib-bsz36022511X6/FILE_0000_INTROIMAGE.jpg)




























![[Herrenalb]](/media/wlb_digitalisate/current/generated/images/urn-nbn-de-bsz-24-digibib-bsz36022511X6/FILE_0000_INTROIMAGE.jpg.tm.png)














 leobw
leobw