Müllheim
![Bild von Müllheim]()
Markgräfler Platz, Müllheim [Quelle: Müllheim]
![Bild von Müllheim]()
Müllheim [Quelle: Müllheim]
![Bild von Müllheim]()
Alte Post, Müllheim [Quelle: Müllheim]
![Bild von Müllheim]()
Markgräfler Museum im Blankenhorn-Palais, Müllheim [Quelle: Müllheim]
![Bild von Müllheim]()
Martinskirche, Müllheim [Quelle: Müllheim]
![Luftbild: Film 71 Bildnr. 316, Bild 1]()
Luftbild: Film 71 Bildnr. 316, Bild 1 [Quelle: Landesarchiv BW] /
Zur Detailseite ![Luftbild: Film 54 Bildnr. 240, Bild 1]()
Luftbild: Film 54 Bildnr. 240, Bild 1 [Quelle: Landesarchiv BW] /
Zur Detailseite ![Luftbild: Film 71 Bildnr. 317, Bild 1]()
Luftbild: Film 71 Bildnr. 317, Bild 1 [Quelle: Landesarchiv BW] /
Zur Detailseite ![Markgräfler Museum Müllheim im Blankenhorn-Palais]()
Markgräfler Museum Müllheim im Blankenhorn-Palais [Copyright: Markgräfler Museum Müllheim] /
Zur Detailseite ![Luftbild: Film 54 Bildnr. 276, Bild 1]()
Luftbild: Film 54 Bildnr. 276, Bild 1 [Quelle: Landesarchiv BW] /
Zur Detailseite ![Luftbild: Film 54 Bildnr. 260, Bild 1]()
Luftbild: Film 54 Bildnr. 260, Bild 1 [Quelle: Landesarchiv BW] /
Zur Detailseite ![Luftbild: Film 54 Bildnr. 277, Bild 1]()
Luftbild: Film 54 Bildnr. 277, Bild 1 [Quelle: Landesarchiv BW] /
Zur Detailseite ![Luftbild: Film 54 Bildnr. 250, Bild 1]()
Luftbild: Film 54 Bildnr. 250, Bild 1 [Quelle: Landesarchiv BW] /
Zur Detailseite ![Luftbild: Film 54 Bildnr. 251, Bild 1]()
Luftbild: Film 54 Bildnr. 251, Bild 1 [Quelle: Landesarchiv BW] /
Zur Detailseite ![Luftbild: Film 54 Bildnr. 275, Bild 1]()
Luftbild: Film 54 Bildnr. 275, Bild 1 [Quelle: Landesarchiv BW] /
Zur Detailseite ![Luftbild: Film 54 Bildnr. 232, Bild 1]()
Luftbild: Film 54 Bildnr. 232, Bild 1 [Quelle: Landesarchiv BW] /
Zur Detailseite ![Luftbild: Film 54 Bildnr. 223, Bild 1]()
Luftbild: Film 54 Bildnr. 223, Bild 1 [Quelle: Landesarchiv BW] /
Zur Detailseite Previous Next Die Stadt, die als Zentrum des Markgräflerlandes gilt, liegt im südlichen Landkreises Breisgau-Hochschwarzwald, dessen Südgrenze sie stellenweise erreicht. Sie greift mit sieben eingemeindeten Orten von der Markgräfler Rheineben über das Markgräfler Hügelland bis in den Hochschwarzwald aus, an dem sie mit einer großen Exklave am oberen Klemmbach teilhat. Dort werden beim Kohlgarten Höhenwerte von 1220 m erreicht, die im nordwestlichen Stadtgebiet bis auf rd. 222 m über NN abfallen. Auf der Niederterrasse dominieren Ackerflächen, im Hügelland nördlich des Klemmbachs reichen Reben und Obstwiesen bis an die Schwarzwaldhänge heran, südlich davon tragen die Kuppen ausgedehnte Wälder, wie der gesamte Schwarzwaldanteil. Das Naturschutzgebiet ‚Innerberg‘ ist ein Refugium hier bedrohter Pflanzen- und Tierarten. Vom Westrand des Hügellandes folgt die Kernstadt, die seit 1810 den Stadttitel trägt, dem Klemmbachtal. Um die beiden Dorfkerne wuchs sie kräftig nach Norden und (Süd-)Osten, wozu auch ihre Garnisonsfunktion, heute noch vertreten durch die Deutsch-Französische Brigade, beitrug. Seit 1980 dehnt sie sich mit namhaften Gewerben auch in die Rheinebene aus. Sie ist ein starkes Mittelzentrum mit ausgebautem Sport-, Gesundheits-, Bildungs- und Kultursektor, das seit 2003 auch den Titel ‚staatlich anerkannter Erholungsort‘ trägt. Die Stadt liegt verkehrsgünstig an Rheintalbahn und an der B3, von wo aus ein Zubringer zur A3 bei Neuenburg und ein Übergang über den Rhein nach Frankreich bestehen. Sie wurde 1809 Bezirksamts-, 1939 Landkreissitz und kam nach Auflösung des Kreises Müllheim 1973 zum Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald.
Teilort
Wohnplatz
mehr
aufgegangener Ort
Wüstung
Das ausgedehnte Stadtgebiet erstreckt sich von der Rheinebene über die Vorbergzone bis in den südlichen Hochschwarzwald. Im Westen hat es an der Rheinniederterrasse, in deren würmeiszeitlichen Alpenschottern einige vom Klemmbach gespeiste Bewässerungsgräben versickern, Anteil. Das ostwärts dem Blauen vorgelagerte Markgräfler Hügelland setzt sich nördlich des Klemmbachs aus einer Lößriedel- und -hügellandschaft mit oligozänem Untergrund zusammen, das südlich des Klemmbachtals auf einen randlichen Rebhügelsaum zwischen der Rheinebene und dem Tälchen des Neumattgrabens zusammengedrängt ist. Östlich davon erhebt sich das Badenweiler-Kanderner Schichtstufenland, wo überwiegend tertiäre Konglomerate und Süßwasserkalke die konservierenden Deckschichten über Malmtonen bilden. Mit der Gemarkung Niederweiler und der Müllheimer Waldexklave des Hochwalds greift das Stadtgebiet in das Südschwarzwälder Grundgebirge hinein, wo am bewaldeten und teils felsigen Westhang des Blauen nahe der äußeren Rheingrabenhauptverwerfung große Höhenunterschiede auf engem Raum auftreten. Die das östliche Klemmbachtal umfassende Waldgemarkung des Hochwalds Üegt in einer aus paläozoischen Schiefern und Konglomeraten aufgebauten Ausraumzone, in deren unterkarbonischen Schichten sich das steil eingesägte, westwärtsgewandte Kerbtal mit den von zahlreichen Nebenbächen zerschnittenen Talflanken entwickelte.
![]()
Wanderungsbewegung Müllheim
![]()
Natürliche Bevölkerungsbewegung Müllheim
![]()
Bevölkerungsdichte Müllheim
![]()
Altersstruktur Müllheim
![]()
Bundestagswahlen (ab 1972) Müllheim
![]()
Europawahlen Müllheim
![]()
Landtagswahlen (ab 1972) Müllheim
![]()
Schüler nach Schularten Müllheim
![]()
Übergänge an weiterführende Schulen Müllheim
![]()
Beschäftigte nach Wirtschaftsbereichen (aktuell) Müllheim
![]()
Aus- und Einpendler Müllheim
![]()
Bestand an Kfz Müllheim
Previous Next 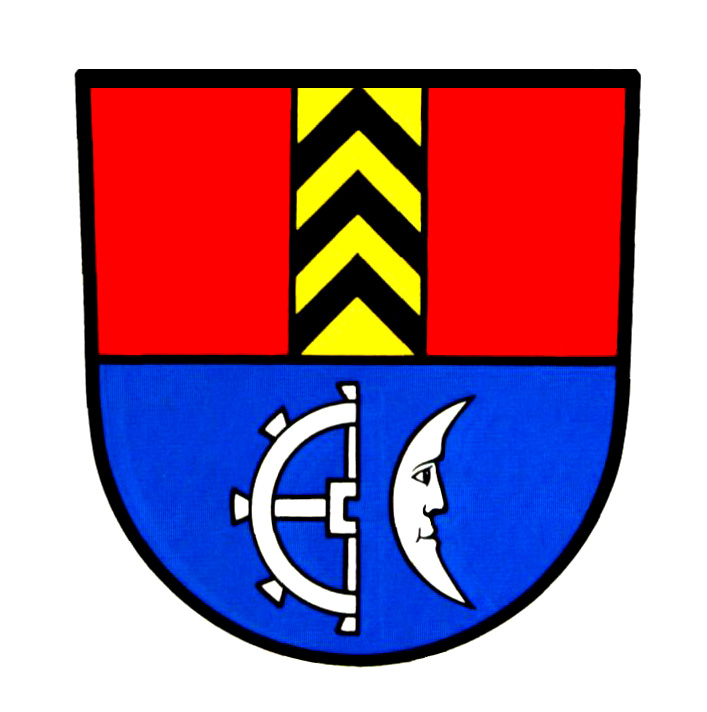
In geteiltem Schild oben in Rot ein mit drei schwarzen Sparren belegter goldener (gelber) Pfahl, unten in Blau nebeneinander die rechte Hälfte eines vierspeichigen silbernen (weißen) Mühlrads und ein abnehmender silberner (weißer) Halbmond mit Gesicht.
Beschreibung Wappen
Müllheim gehörte zur Herrschaft Badenweiler, kam mit dieser 1503 an die Markgrafen von Baden, wurde 1727 Amtssitz der Herrschaft und 1810 zur Stadt erhoben. Das Wappen tritt erstmals im Siegel des ausgehenden 18. Jahrhunderts in Erscheinung, allerdings in spiegelbildlicher Darstellung der Figuren der unteren Schildhälfte. Das obere Feld zeigt das Wappen der Herrschaft Badenweiler. Halbes Mühlrad und Halbmond, ersteres wohl ein „redendes" Bild für den Ortsnamen, letzterer möglicherweise das alte Ortszeichen, begegnen mit ausdrücklicher Bezeichnung als Dorfwappen bereits auf einer 1691 gegossenen Glocke. Die zwischen 1970 und 1974 eingemeindeten Orte Britzingen, Dattingen, Feldberg, Hügelheim, Niederweiler, Vögisheim und Zunzingen zählten mit einer Ausnahme einst ebenfalls zur Herrschaft Badenweiler.
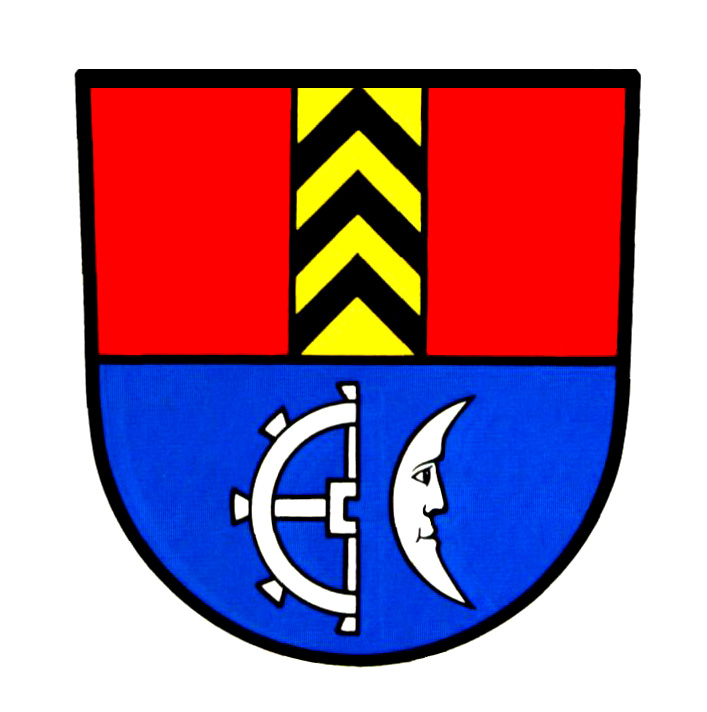























































































 leobw
leobw