Bräunlingen
![Bild von Bräunlingen]()
Stadttor, Bräunlingen [Quelle: Bräunlingen]
![Bild von Bräunlingen]()
Kirchenvorplatz, Bräunlingen [Quelle: Bräunlingen]
![Bild von Bräunlingen]()
Narrenbrunnen beim Zunfthaus, Bräunlingen [Quelle: Bräunlingen]
![Bild von Bräunlingen]()
Kelnhofplatz, Bräunlingen [Quelle: Bräunlingen]
![Bild von Bräunlingen]()
Zähringerplatz mit Stadtkirche, Bräunlingen [Quelle: Bräunlingen]
![Luftbild: Film 56 Bildnr. 623, Bild 1]()
Luftbild: Film 56 Bildnr. 623, Bild 1 [Quelle: Landesarchiv BW] /
Zur Detailseite ![Luftbild: Film 56 Bildnr. 730, Bild 1]()
Luftbild: Film 56 Bildnr. 730, Bild 1 [Quelle: Landesarchiv BW] /
Zur Detailseite ![Luftbild: Film 61 Bildnr. 142, Bild 1]()
Luftbild: Film 61 Bildnr. 142, Bild 1 [Quelle: Landesarchiv BW] /
Zur Detailseite ![Luftbild: Film 60 Bildnr. 454, Bild 1]()
Luftbild: Film 60 Bildnr. 454, Bild 1 [Quelle: Landesarchiv BW] /
Zur Detailseite ![Döggingen (Bräunlingen): Stadtansicht mit Umland, 1980]()
Döggingen (Bräunlingen): Stadtansicht mit Umland, 1980 [Copyright: Landesmedienzentrum Baden-Württemberg; 06.06.1980] /
Zur Detailseite ![Luftbild: Film 61 Bildnr. 130, Bild 1]()
Luftbild: Film 61 Bildnr. 130, Bild 1 [Quelle: Landesarchiv BW] /
Zur Detailseite ![Luftbild: Film 61 Bildnr. 145, Bild 1]()
Luftbild: Film 61 Bildnr. 145, Bild 1 [Quelle: Landesarchiv BW] /
Zur Detailseite ![Luftbild: Film 69 Bildnr. 423, Bild 1]()
Luftbild: Film 69 Bildnr. 423, Bild 1 [Quelle: Landesarchiv BW] /
Zur Detailseite ![Luftbild: Film 56 Bildnr. 699, Bild 1]()
Luftbild: Film 56 Bildnr. 699, Bild 1 [Quelle: Landesarchiv BW] /
Zur Detailseite ![Luftbild: Film 56 Bildnr. 630, Bild 1]()
Luftbild: Film 56 Bildnr. 630, Bild 1 [Quelle: Landesarchiv BW] /
Zur Detailseite ![Luftbild: Film 56 Bildnr. 632, Bild 1]()
Luftbild: Film 56 Bildnr. 632, Bild 1 [Quelle: Landesarchiv BW] /
Zur Detailseite ![Luftbild: Film 56 Bildnr. 599, Bild 1]()
Luftbild: Film 56 Bildnr. 599, Bild 1 [Quelle: Landesarchiv BW] /
Zur Detailseite ![Luftbild: Film 56 Bildnr. 709, Bild 1]()
Luftbild: Film 56 Bildnr. 709, Bild 1 [Quelle: Landesarchiv BW] /
Zur Detailseite ![Sichelhenke auf der Kilbi in Bräunlingen, 1969]()
Sichelhenke auf der Kilbi in Bräunlingen, 1969 [Copyright: Landesmedienzentrum Baden-Württemberg; 01.10.1969] /
Zur Detailseite Previous Next Unmittelbar an Donaueschingen und Hüfingen grenzend, liegt das Stadtgebiet von Bräunlingen am Westrand des Schwarzwald-Baar-Kreises im naturräumlichen Übergang vom Südöstlichen Schwarzwald zur Baar. Die Kernstadt und Döggingen (einer der vier zwischen 1971 und 1972 eingemeindeten Stadtteile) gehören im Osten der Stadtfläche bereits der hier von Muschelkalk geprägten Baar-Hochmulde an. Die Höhen reichen von 1042 über NN im äußersten Westen (Wagnereckle) bis rd. 635 m an der Südspitze der Stadt in der Gauchachschlucht. Mit der Gauchach, der südwestlichen Stadtgrenze, hat die Stadt Anteil am bedeutenden Naturschutzgebiet ‚(Gauchach-)Wutachschlucht‘. Ein kleines Schutzgebiet ‚Palmenbuck‘ (0,3 ha) bewahrt den Wiesenrain eines Muschelkalkrückens nördlich der Kernstadt. Diese liegt am Zusammenfluss von Brändbach und Breg, dem Hauptgewässer, und erstreckt sich über die gesamte Talwanne bis auf die nördlichen und südlichen Hänge hinauf. Vor allem auf der südlichen Höhe ist die Stadt seit den 1970er Jahren weiter gewachsen. In dieser Zeit hat sie, dem Bregtal folgend, vorwiegend mit Gewerbeanlagen auch Anschluss an die östliche Nachbarstadt Hüfingen gefunden hat. Im Tal, am Brändbach, hebt sich der planmäßig angelegte mittelalterliche Stadtkern (Stadttitel seit 1305) mit Marktplatz, Stadtmauer und Stadttor heraus. 2008/2009 wurde er umfassend saniert. Die Stadt, ein Kleinzentrum, besitzt eine breitgefächerte Infrastruktur und zeigt mit ihrer differenzierten Unternehmensausrichtung einen nur geringen Auspendlerüberschuss. Sie ist Endpunkt der Bregtalbahn nach Donaueschingen, wohin eine eng getaktete Verbindung besteht. Sie wird durch Landes- und Kreisstraßen erschlossen und hat bei Döggingen Zugang zur B31. Die Kernstadt kam 1806 an Baden, dort 1807 zum Obervogteiamt Villingen, 1813 zum Bezirksamt Hüfingen, war 1832 bis 1840 Sitz eines Stabsamtes, kam dann zum Bezirksamt Villlingen, 1842 wieder zu Hüfingen, 1849 zum Bezirksamt bzw. Landkreis (1936) Donaueschingen und 1973 zum Schwarzwald-Baar-Kreis.
Teilort
Wohnplatz
mehr
aufgegangener Ort
Wüstung
mehr
Das Stadtgebiet erstreckt sich im Westen auf den Buntsandstein-Randplatten des Südöstlichen Schwarzwalds. Brändbach und Bruderbächle fließen in Abdachungsrichtung auf der nach Оsten geneigten, bewaldeten Hochfläche. Ihre Täler sind entlang von Verwerfungslinien angelegt und infolgedessen asymmetrisch gestaltet. Die Nordhänge reichen jeweils bis zum kristallinen Grundgebirge. Der östliche Teil des Stadtgebiets liegt auf den im Bereich des Bonndorfer Grabens weit nach Westen vorspringenden Gäuplatten der Baar. Während Unterer und Mittlerer Muschelkalk nur in einem schmalen Streifen vorhanden sind, bildet der Hauptmuschelkalk eine etwas größere, vorwiegend ackerbaulich genutzte Fläche. Im Südosten reicht noch ein Ausläufer des Keuper-Lias-Berglands in das Stadtgebiet.
![]()
Wanderungsbewegung Bräunlingen
![]()
Natürliche Bevölkerungsbewegung Bräunlingen
![]()
Bevölkerungsdichte Bräunlingen
![]()
Altersstruktur Bräunlingen
![]()
Bundestagswahlen (ab 1972) Bräunlingen
![]()
Europawahlen Bräunlingen
![]()
Landtagswahlen (ab 1972) Bräunlingen
![]()
Schüler nach Schularten Bräunlingen
![]()
Übergänge an weiterführende Schulen Bräunlingen
![]()
Beschäftigte nach Wirtschaftsbereichen (aktuell) Bräunlingen
![]()
Aus- und Einpendler Bräunlingen
![]()
Bestand an Kfz Bräunlingen
Previous Next 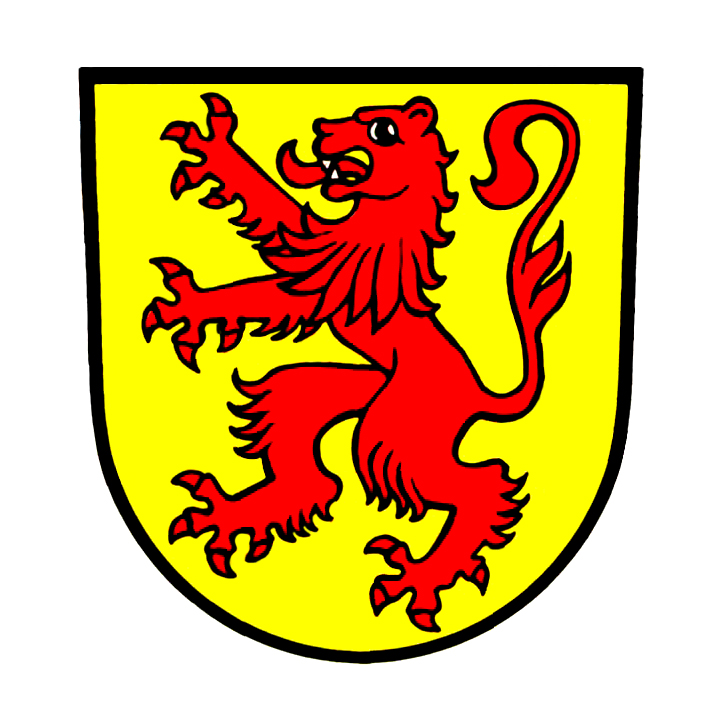
In Gold (Gelb) ein roter Löwe.
Beschreibung Wappen
Graf Heinrich von Fürstenberg erwirkte 1295 für Bräunlingen Stadtrecht. Im Jahre 1305 wurde Bräunlingen an Österreich abgetreten, bei dieser Gelegenheit erstmals als Stadt bezeichnet. Sie bildete fortan einen habsburgischen Stützpunkt im fürstenbergischen Gebiet. 1415-1425 war Bräunlingen Reichsstadt. Trotz häufiger Verpfändungen, die die Bürger oft selbst auslösten, blieb die Stadt bis 1805 bei Österreich. 1971/72 wurden Göggingen, Mistelbrunn, Unterbränd und Waldhausen eingemeindet. Unterbränd gehörte bis zu Beginn des 19. Jahrhunderts zur Großmark Bräunlingen. Der erste Abdruck des Stadtsiegels von 1305 zeigt bereits den Löwen. Das älteste kolorierte Stadtwappen stammt aus dem Jahre 1733 und zeigt die heute gebräuchlichen Tinkturen. Es lag nahe, im Bräunlinger Wappentier den Habsburger Löwen zu sehen, jedoch stammt das älteste Siegel noch aus der Zeit vor dem Übergang der Stadt an Habsburg.
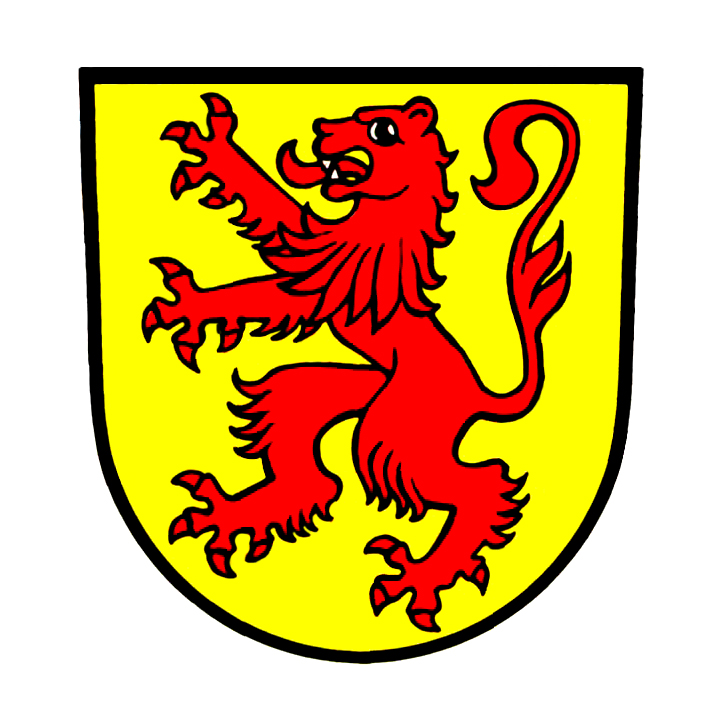























































































 leobw
leobw