Efringen-Kirchen
![Bild von Efringen-Kirchen]()
Rathausplatz, Efringen-Kirchen [Quelle: Efringen-Kirchen]
![Bild von Efringen-Kirchen]()
Der Isteiner Klotz bei Efringen-Kirchen [Quelle: Efringen-Kirchen]
![Bild von Efringen-Kirchen]()
Naturdenkmal Isteiner Schwellen im Rhein bei Efringen-Kirchen [Quelle: Efringen-Kirchen]
![Bild von Efringen-Kirchen]()
St. Peterskirche, Blansingen [Quelle: Efringen-Kirchen]
![Bild von Efringen-Kirchen]()
Brunnenplatz, Welmlingen [Quelle: Efringen-Kirchen]
![Fragebogen: Badische Volkskunde: Fragebogen zur Sammlung der Volksüberlieferungen - Antwortbogen aus Efringen, Amt Lörrach]()
Fragebogen: Badische Volkskunde: Fragebogen zur Sammlung der Volksüberlieferungen - Antwortbogen aus Efringen, Amt Lörrach [Copyright: Badisches Landesmuseum Karlsruhe] /
Zur Detailseite ![Fragebogen: Badische Volkskunde: Fragebogen zur Sammlung der Volksüberlieferungen - Antwortbogen aus Efringen, Amt Lörrach]()
Fragebogen: Badische Volkskunde: Fragebogen zur Sammlung der Volksüberlieferungen - Antwortbogen aus Efringen, Amt Lörrach [Copyright: Badisches Landesmuseum Karlsruhe] /
Zur Detailseite ![Fragebogen: Badische Volkskunde: Fragebogen zur Sammlung der Volksüberlieferungen - Antwortbogen aus Efringen, Amt Lörrach]()
Fragebogen: Badische Volkskunde: Fragebogen zur Sammlung der Volksüberlieferungen - Antwortbogen aus Efringen, Amt Lörrach [Copyright: Badisches Landesmuseum Karlsruhe] /
Zur Detailseite ![Fragebogen: Badische Volkskunde: Fragebogen zur Sammlung der Volksüberlieferungen - Antwortbogen aus Efringen, Amt Lörrach]()
Fragebogen: Badische Volkskunde: Fragebogen zur Sammlung der Volksüberlieferungen - Antwortbogen aus Efringen, Amt Lörrach [Copyright: Badisches Landesmuseum Karlsruhe] /
Zur Detailseite ![Efringen-Kirchen 1967]()
Efringen-Kirchen 1967 [Copyright: Landesmedienzentrum Baden-Württemberg; 07.09.1967] /
Zur Detailseite Previous Next Die ausgedehnte Gemeinde mit ihren neun Teilorten folgt unmittelbar dem Rhein und reicht im südlichen Markgräflerland von der Rheinebene weit in das hier sehr breite, ackerbaulich genutzte Lößhügelland hinein. Dort werden am Katzenberg mit 397 m über NN die höchsten Höhen gemessen, die nach Nordwesten zur Rheinebene hin auf knapp 230 m fallen. Diese ist stellenweise extrem schmal ausgebildet, da hier die Vorbergzone mit der Isteiner Jurascholle weit nach Westen vorstößt und mit dem schroff aufragenden Isteiner Malmklotz einen eindrucksvollen Abbruch zum Rhein bildet. Er steht mit drei weitere Gebieten (insgesamt 150 ha), die Flora und Fauna des meist bewaldeten Randabfalls bzw. der ehemaligen Rheinaue sichern, unter Naturschutz. Bei Kleinkems werden Teile der Kalkscholle abgebaut. Der Steilanstieg gehört auch zu den bevorzugten Reblagen, die den Weinbau zum wichtigen Standbein der Gemeinde machen. Vor allem südlich der Scholle schwingt die Rheinebene stark nach Osten aus mit deutlicher Zweiteilung in Aue und Niederterrasse, die sich über erstere mit markanter Stufe (Hochgestade) erhebt. Dort liegt der 1942 aus zwei Nachbarorten vereinte Hauptort. Er ist heute Kleinzentrum mit kräftigem Wohnsiedlungswachstum und ausgedehntem Gewerbegebiet an der B3. Diese berührt ihn direkt und seit 1851 hält hier die Rheintalbahn. Durch die Rheinebene führt die A5, zu der Anschluss über die südliche Nachbargemeinde Weil am Rhein besteht. 1809 kam der Hauptort und die markgräflichen Teilorte zum Bezirksamt bzw. Landkreis (1939) Lörrach. Die übrigen Teilorte stießen erst 1819 hinzu.
Teilort
mehr
Wohnplatz
aufgegangener Ort
Wüstung
Das Gemeindegebiet liegt naturräumlich zum größten Teil in dem fast vollständig mit Löß bedeckten, im Untergrund aus tertiären Ablagerungen bestehenden Südlichen Markgräfler Hügelland und ist deshalb weitgehend waldfrei. Es steht in intensiver landwirtschaftlicher Nutzung: ertragreicher Ackerbau auf den flachgründigen Pararendzinen, Fettwiesen in den sich zum Rhein hinziehenden Tälern, z.B. des Feuerbachs und zahlreicher flacher Seitentälchen. Rebflächen sind dem steilen Abfall zum w gelegenen Hochgestade vorbehalten, ebenso wie den Steilhängen am Isteiner Malm-Kalkklotz, und Eichen-Hainbuchenwälder den Kuppen und einzelnen Hangteilen. Wesdich des zwischen 300-400 m über Null-Niveau erreichenden Markgräfler Hügellandes schließt sich die tiefer gelegene Niederterrasse (255-265 m) an, deren Sande und Schotter fast überall von Schwemmlöß bedeckt sind und deshalb dem Ackerbau dienen, während die die Niederterrasse durchschneidenden Bäche mit ihren Auen Grünland bedingen. In die Niederterrasse eingesenkt schließt sich nach W die Rheinaue an, an der das Gemeindegebiet ebenfalls einen kleinen Anteil hat. Dieser weist durch Wasserzufuhr mehrerer Seitenbäche und infolge der durch die Isteiner Schwelle gebremsten Grundwasserabsenkung, im Gegensatz zur sonstigen Oberrheinniederung, noch überwiegend feuchte Standorte mit Wiesen und Auwäldern auf.
![]()
Wanderungsbewegung Efringen-Kirchen
![]()
Natürliche Bevölkerungsbewegung Efringen-Kirchen
![]()
Bevölkerungsdichte Efringen-Kirchen
![]()
Altersstruktur Efringen-Kirchen
![]()
Bundestagswahlen (ab 1972) Efringen-Kirchen
![]()
Europawahlen Efringen-Kirchen
![]()
Landtagswahlen (ab 1972) Efringen-Kirchen
![]()
Schüler nach Schularten Efringen-Kirchen
![]()
Übergänge an weiterführende Schulen Efringen-Kirchen
![]()
Beschäftigte nach Wirtschaftsbereichen (aktuell) Efringen-Kirchen
![]()
Aus- und Einpendler Efringen-Kirchen
![]()
Bestand an Kfz Efringen-Kirchen
Previous Next 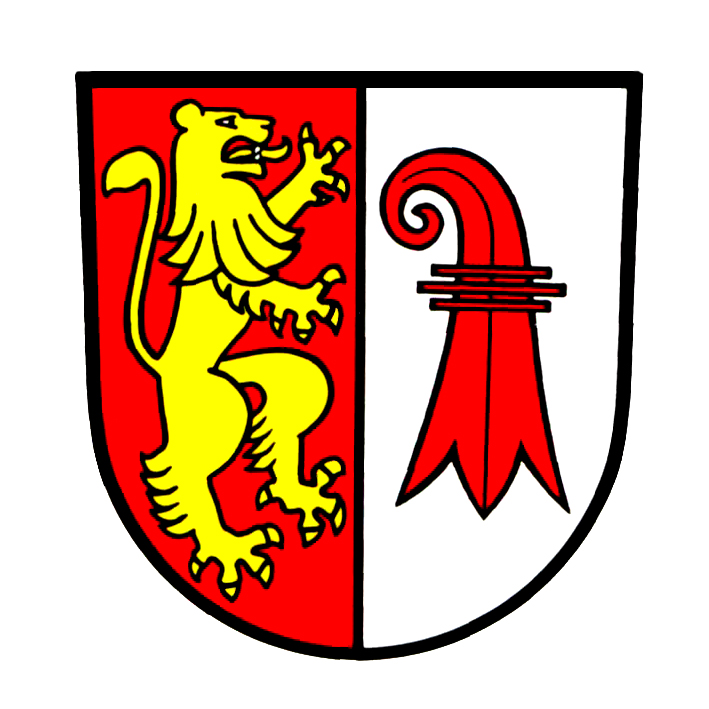
In gespaltenem Schild vorn in Rot ein linksgewendeter goldener (gelber) Löwe, hinten in Silber (Weiß) ein roter Bischofsstab (Baselstab).
Beschreibung Wappen
Efringen und Kirchen wurden 1942 zu einer Gemeinde zusammengeschlossen. Am 1. Oktober 1974 wurde die Gemeinde Efringen-Kirchen durch Vereinigung mit acht Gemeinden neu gebildet. Das am 12. August 1977 zusammen mit der Flagge vom Landratsamt Lörrach verliehene Wappen stellt die historischen Herrschaftsverhältnisse der Gemeinde dar. Im gesamten Gemeindegebiet hatte das Hochstift Basel im Mittelalter die Lehenshoheit, Besitz und Rechte. Huttingen und Istein gehörten bis 1803 zur weltlichen Herrschaft des Basler Bischofs. Daran erinnert der rote Baselstab. Über einige der übrigen Ortsteile hatten die Herren von Rötteln bis zum Beginn des 14. Jahrhunderts die Ortsherrschaft inne. Der Löwe in dem vom Generallandesarchiv entworfenen Wappen spielt auf das Röttelner Wappen an.
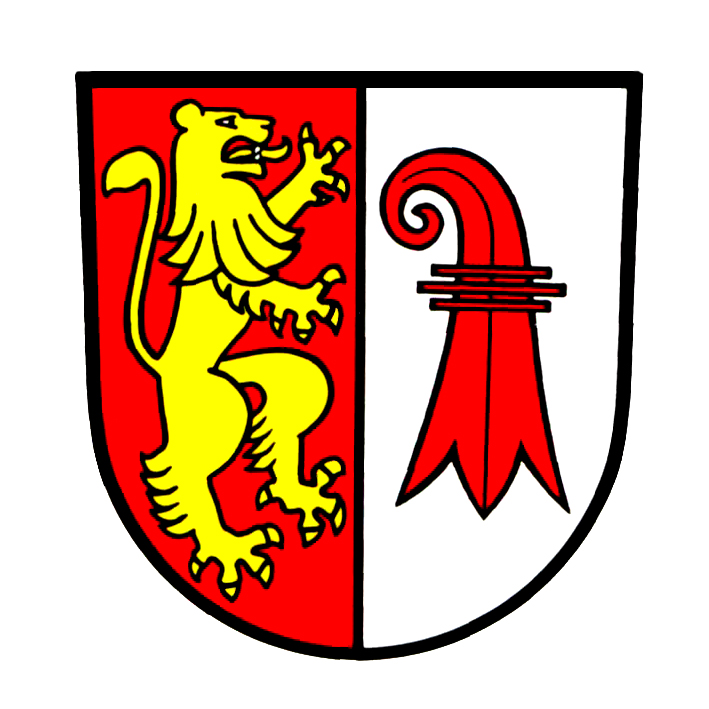






















![[Brief]](/media/ubf_digitalisate/current/delivered/images/oai-dl.ub.uni-freiburg.de-4655/INTROIMAGE.jpg)
![[Postkarte]](/media/ubf_digitalisate/current/delivered/images/oai-dl.ub.uni-freiburg.de-4663/INTROIMAGE.jpg)
![[Brief]](/media/ubf_digitalisate/current/delivered/images/oai-dl.ub.uni-freiburg.de-4653/INTROIMAGE.jpg)


![[Brief]](/media/ubf_digitalisate/current/delivered/images/oai-dl.ub.uni-freiburg.de-4662/INTROIMAGE.jpg)
![[Postkarte]](/media/ubf_digitalisate/current/delivered/images/oai-dl.ub.uni-freiburg.de-4665/INTROIMAGE.jpg)
![[Postkarte]](/media/ubf_digitalisate/current/delivered/images/oai-dl.ub.uni-freiburg.de-4658/INTROIMAGE.jpg)
![[Postkarte]](/media/ubf_digitalisate/current/delivered/images/oai-dl.ub.uni-freiburg.de-4659/INTROIMAGE.jpg)
![[Postkarte]](/media/ubf_digitalisate/current/delivered/images/oai-dl.ub.uni-freiburg.de-4664/INTROIMAGE.jpg)
![[Brief]](/media/ubf_digitalisate/current/delivered/images/oai-dl.ub.uni-freiburg.de-4656/INTROIMAGE.jpg)
![[Brief]](/media/ubf_digitalisate/current/delivered/images/oai-dl.ub.uni-freiburg.de-4654/INTROIMAGE.jpg)
![[Brief]](/media/ubf_digitalisate/current/delivered/images/oai-dl.ub.uni-freiburg.de-4652/INTROIMAGE.jpg)






![[Brief]](/media/ubf_digitalisate/current/delivered/images/oai-dl.ub.uni-freiburg.de-4657/INTROIMAGE.jpg)







![[Brief]](/media/ubf_digitalisate/current/generated/images/oai-dl.ub.uni-freiburg.de-4655/INTROIMAGE.jpg.tm.png)
![[Postkarte]](/media/ubf_digitalisate/current/generated/images/oai-dl.ub.uni-freiburg.de-4663/INTROIMAGE.jpg.tm.png)
![[Brief]](/media/ubf_digitalisate/current/generated/images/oai-dl.ub.uni-freiburg.de-4653/INTROIMAGE.jpg.tm.png)


![[Brief]](/media/ubf_digitalisate/current/generated/images/oai-dl.ub.uni-freiburg.de-4662/INTROIMAGE.jpg.tm.png)
![[Postkarte]](/media/ubf_digitalisate/current/generated/images/oai-dl.ub.uni-freiburg.de-4665/INTROIMAGE.jpg.tm.png)
![[Postkarte]](/media/ubf_digitalisate/current/generated/images/oai-dl.ub.uni-freiburg.de-4658/INTROIMAGE.jpg.tm.png)
![[Postkarte]](/media/ubf_digitalisate/current/generated/images/oai-dl.ub.uni-freiburg.de-4659/INTROIMAGE.jpg.tm.png)
![[Postkarte]](/media/ubf_digitalisate/current/generated/images/oai-dl.ub.uni-freiburg.de-4664/INTROIMAGE.jpg.tm.png)
![[Brief]](/media/ubf_digitalisate/current/generated/images/oai-dl.ub.uni-freiburg.de-4656/INTROIMAGE.jpg.tm.png)
![[Brief]](/media/ubf_digitalisate/current/generated/images/oai-dl.ub.uni-freiburg.de-4654/INTROIMAGE.jpg.tm.png)
![[Brief]](/media/ubf_digitalisate/current/generated/images/oai-dl.ub.uni-freiburg.de-4652/INTROIMAGE.jpg.tm.png)







![[Brief]](/media/ubf_digitalisate/current/generated/images/oai-dl.ub.uni-freiburg.de-4657/INTROIMAGE.jpg.tm.png)














 leobw
leobw