Bad Dürrheim
![Luftbild: Film 53 Bildnr. 130, Bild 1]()
Luftbild: Film 53 Bildnr. 130, Bild 1 [Quelle: Landesarchiv BW] /
Zur Detailseite ![Deutsches Gebet- und Tagzeitenbuch mit einzelnen lateinischen Texten]()
Deutsches Gebet- und Tagzeitenbuch mit einzelnen lateinischen Texten [Copyright: Universitätsbibliothek Freiburg] /
Zur Detailseite ![Luftbild: Film 53 Bildnr. 131, Bild 1]()
Luftbild: Film 53 Bildnr. 131, Bild 1 [Quelle: Landesarchiv BW] /
Zur Detailseite ![Luftbild: Film 53 Bildnr. 134, Bild 1]()
Luftbild: Film 53 Bildnr. 134, Bild 1 [Quelle: Landesarchiv BW] /
Zur Detailseite ![Luftbild: Film 58 Bildnr. 608, Bild 1]()
Luftbild: Film 58 Bildnr. 608, Bild 1 [Quelle: Landesarchiv BW] /
Zur Detailseite ![Luftbild: Film 58 Bildnr. 399, Bild 1]()
Luftbild: Film 58 Bildnr. 399, Bild 1 [Quelle: Landesarchiv BW] /
Zur Detailseite ![Luftbild: Film 56 Bildnr. 720, Bild 1]()
Luftbild: Film 56 Bildnr. 720, Bild 1 [Quelle: Landesarchiv BW] /
Zur Detailseite ![Luftbild: Film 58 Bildnr. 400, Bild 1]()
Luftbild: Film 58 Bildnr. 400, Bild 1 [Quelle: Landesarchiv BW] /
Zur Detailseite ![Luftbild: Film 57 Bildnr. 126, Bild 1]()
Luftbild: Film 57 Bildnr. 126, Bild 1 [Quelle: Landesarchiv BW] /
Zur Detailseite ![Luftbild: Film 58 Bildnr. 393, Bild 1]()
Luftbild: Film 58 Bildnr. 393, Bild 1 [Quelle: Landesarchiv BW] /
Zur Detailseite ![Luftbild: Film 57 Bildnr. 144, Bild 1]()
Luftbild: Film 57 Bildnr. 144, Bild 1 [Quelle: Landesarchiv BW] /
Zur Detailseite ![Luftbild: Film 57 Bildnr. 122, Bild 1]()
Luftbild: Film 57 Bildnr. 122, Bild 1 [Quelle: Landesarchiv BW] /
Zur Detailseite ![Luftbild: Film 57 Bildnr. 147, Bild 1]()
Luftbild: Film 57 Bildnr. 147, Bild 1 [Quelle: Landesarchiv BW] /
Zur Detailseite ![Agitation der Bolschewisten, Bild 3]()
Agitation der Bolschewisten, Bild 3 [Quelle: Generallandesarchiv Karlsruhe] /
Zur Detailseite ![Luftbild: Film 58 Bildnr. 405, Bild 1]()
Luftbild: Film 58 Bildnr. 405, Bild 1 [Quelle: Landesarchiv BW] /
Zur Detailseite Previous Next Die Stadt (Stadttitel seit 1974) liegt am östlichen Rand des Schwarzwald-Baar-Kreises. Sie gehört naturräumlich zur Baar, einer südlichen Teileinheit der Neckar-Tauberland-Gäuplatten und nimmt nahezu das Zentrum der Baar-Hochmulde ein. Dort reicht sie mit ihren sechs eingemeindeten Teilorten vom Gipskeuper über markante Stufen nach Südosten bis zum Braunjura. Im äußersten Osten (Himmelberg) wird mit 941 m über NN das Höhenmaximum erreicht, das nach Südwesten an der Stelle, wo die Stille Musel die Stadt verlässt, auf 683 m abfällt. Der oft sumpfige Gipskeupers steht mit mehreren Gebieten (Schwenninger Moos, Birken-Mittelmeß und Unterhölzer Wald) unter Naturschutz, genauso wie die naturnahe bzw. extensiv kultivierten Braunjurastufe im südlichen Stadtgebiet (‚Albtrauf Baar‘). Ackerflächen bestimmen weithin das Landschaftsbild; der Stufenanstieg wird von Wald eingenommen. Die Kernstadt dehnt sich vor der Liasstufe auf dem Gipskeuper aus. 1822 wurden hier Salzlager erbohrt und seit 1851 zu Badekuren genutzt, mit denen sich das heutige Sohle-Heilbad (Prädikat seit 1985) zum bekannten Kurort (Titel ‚Bad‘ seit 1921) mit spezifischen Sanatorien und Kliniken entwickelte. Unter den erhaltenen Salinengebäuden sticht besonders jenes mit den beiden Bohrtürmen als architektonisches Denkmal hervor. Das seit 1960 eher ostwärts gerichtete Wachstum orientierte sich auch an der B27, wo im Norden des Stadtgebiets im Anschluss an die Mineralwasserabfüllanlage seit Ende der 1970er Jahre ein ausgedehntes Gewerbegebiet mit mehreren Verbrauchermärkten entstand. Das Kleinzentrum liegt äußerst verkehrsgünstig, trifft doch an ihrem westlichen Rand die über den Schwarzwald kommende B33 auf die nordsüdverlaufende B27. 1805 kam die Stadt an Württemberg, 1806 an Baden und gehörte zum Amt (1807), Bezirksamt (1813) bzw. Landkreis (1936) Villingen und seit 1973 zum Schwarzwald-Baar-Kreis.
Teilort
Wohnplatz
mehr
aufgegangener Ort
Wüstung
Im Westen des Stadtgebiets, das zwischen den Gäuflächen und Albvorbergen der Baar liegt, dehnt sich die versumpfte Niederung des Gipskeupers aus, in dessen Mergeln sich die Stille Musel ein flachmuldiges Tal geschaffen hat. Östlich Bad Dürrheim erhebt sich in einer etwa 100 m hohen bewaldeten Stufe das Keuper-Lias-Bergland. Das leicht hügelige, nach Оsten einfallende Stufendach ist in den Kalken des unteren Lias ausgebildet. Diese werden ebenso ackerbaulich genutzt wie die östlich der Köthach in einer kleinen, 20-30 m hohen Geländestufe einsetzenden Schichten des oberen Lias, die durch zahlreiche Seitenbäche in einzelne Riedel zerlegt sind. Nach Оsten folgen in einer in den Opalinustonen zunächst sanft ansteigenden, später in den oberen Doggerschichten sich versteilenden Stufe die Albvorberge. Im äußersten Оsten ragen noch Ausläufer des Albtraufs in das Stadtgebiet.
![]()
Wanderungsbewegung Bad Dürrheim
![]()
Natürliche Bevölkerungsbewegung Bad Dürrheim
![]()
Bevölkerungsdichte Bad Dürrheim
![]()
Altersstruktur Bad Dürrheim
![]()
Bundestagswahlen (ab 1972) Bad Dürrheim
![]()
Europawahlen Bad Dürrheim
![]()
Landtagswahlen (ab 1972) Bad Dürrheim
![]()
Schüler nach Schularten Bad Dürrheim
![]()
Übergänge an weiterführende Schulen Bad Dürrheim
![]()
Beschäftigte nach Wirtschaftsbereichen (aktuell) Bad Dürrheim
![]()
Aus- und Einpendler Bad Dürrheim
![]()
Bestand an Kfz Bad Dürrheim
Previous Next 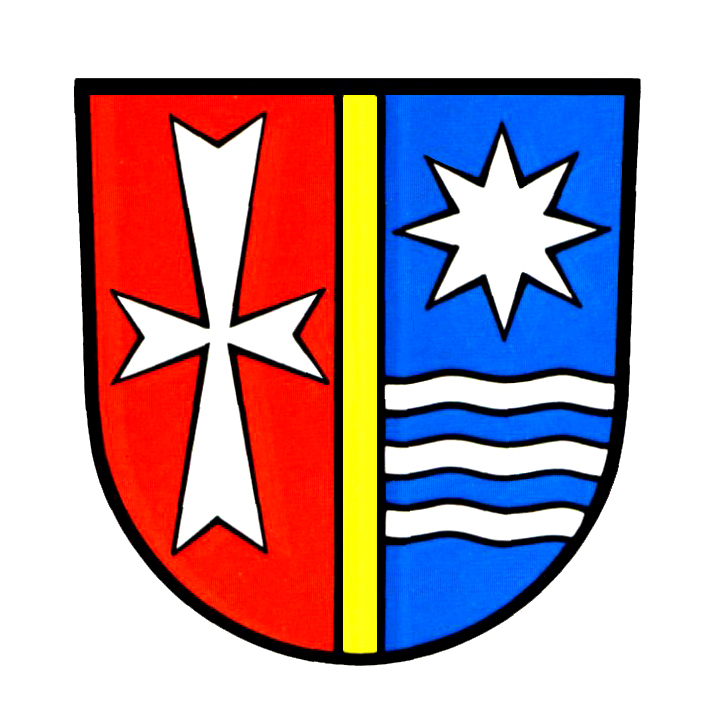
In einem durch einen goldenen (gelben) Stab gespaltenen Schild vorn in Rot ein silbernes (weißes) Johanniterkreuz, hinten in Blau über drei silbernen (weißen) Wellenleisten ein achtstrahliger silberner (weißer) Stern.
Beschreibung Wappen
Dürrheim gehörte seit dem 13. Jahrhundert der Johanniterkommende Villingen. Der Vogt von Dürrheim führte im 18. Jahrhundert ein Siegel, das als Hauptemblem das Johanniterkreuz zeigt. Fast alle Siegel der Gemeinde (ab 1840) enthalten den Schild mit dem Johanniterkreuz (auch zum Stern entstellt) und einen geflügelten Löwen oder einen Greifen als Schildhalter. Nach längeren Verbesserungsbemühungen wurden Wappen und Flagge vom Innenministerium am 7. Dezember 1957 verliehen. Der Stab erscheint als Symbol für ein Bohrloch zur Solegewinnung, die Motive im hinteren Feld versinnbildlichen die drei Heilfaktoren Sole, Sonne und Höhenluft des 1921 mit dem Prädikat „Bad" ausgestatteten Kurortes, der 1974 zur Stadt erhoben wurde.
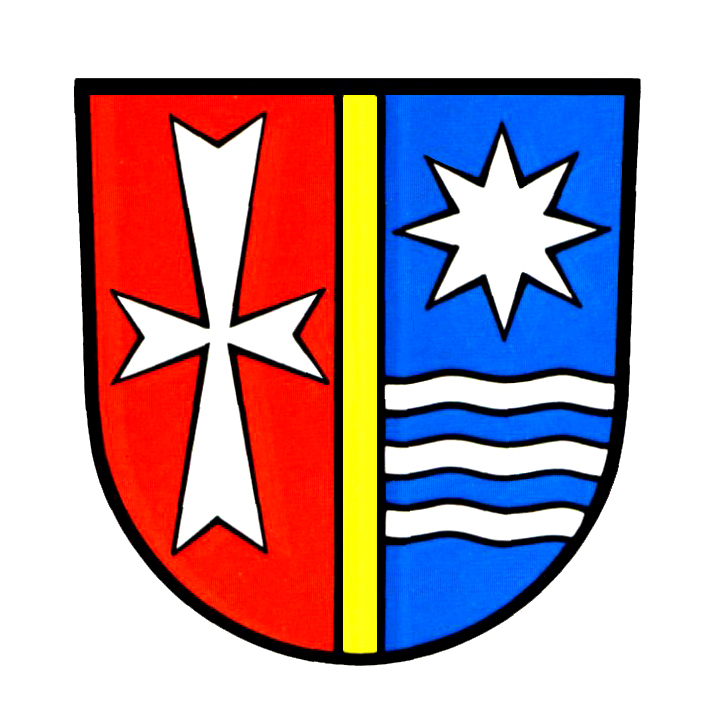























































































 leobw
leobw