Konstanz
![Bild von Konstanz]()
Konzilgebäude am Hafen, Konstanz [Quelle: Konstanz]
![Bild von Konstanz]()
Münster Unserer Lieben Frau, Konstanz [Quelle: Konstanz]
![Bild von Konstanz]()
Imperia, Konstanz [Quelle: Konstanz]
![Bild von Konstanz]()
Seestraße, Konstanz [Quelle: Konstanz]
![Bild von Konstanz]()
Stadtteil Niederburg, Konstanz [Quelle: Konstanz]
![Constitutiones Et Decreta Synodi Dioecesanae Constantiensis]()
Constitutiones Et Decreta Synodi Dioecesanae Constantiensis [Copyright: Universitätsbibliothek Freiburg] /
Zur Detailseite ![Statuta consistorialia episcopalis curiae constantiensis]()
Statuta consistorialia episcopalis curiae constantiensis [Copyright: Universitätsbibliothek Freiburg] /
Zur Detailseite ![Ethica sive distigivm Cathonis]()
Ethica sive distigivm Cathonis [Copyright: Universitätsbibliothek Freiburg] /
Zur Detailseite ![Digitaler Film: Privates Filmdokument einer regelkonformen Polonaise während der Konstanzer Fasnacht 2021]()
Digitaler Film: Privates Filmdokument einer regelkonformen Polonaise während der Konstanzer Fasnacht 2021 [Copyright:
CC0] /
Zur Detailseite ![Digitaler Film: Privates Filmdokument einer regelkonformen Polonaise während der Konstanzer Fasnacht 2021]()
Digitaler Film: Privates Filmdokument einer regelkonformen Polonaise während der Konstanzer Fasnacht 2021 [Copyright:
CC0] /
Zur Detailseite ![Digitaler Film: Privates Filmdokument einer regelkonformen Polonaise während der Konstanzer Fasnacht 2021]()
Digitaler Film: Privates Filmdokument einer regelkonformen Polonaise während der Konstanzer Fasnacht 2021 [Copyright:
CC0] /
Zur Detailseite ![Fotografie: Hamsterkauf nach Bundeskanzlerin Merkels Pressekonferenz am 12. März 2020]()
Fotografie: Hamsterkauf nach Bundeskanzlerin Merkels Pressekonferenz am 12. März 2020 [Copyright:
CC0] /
Zur Detailseite ![Ablaß-Calender der Gnadenvollen Ertz-Bruderschafft Mariae Vom Trost, Der schwartz-ledern Gürtel der H. Mutter Monicae]()
Ablaß-Calender der Gnadenvollen Ertz-Bruderschafft Mariae Vom Trost, Der schwartz-ledern Gürtel der H. Mutter Monicae [Copyright: Universitätsbibliothek Freiburg] /
Zur Detailseite ![Constitutiones Et Decreta Synodi Dioecesanae Constantiensis]()
Constitutiones Et Decreta Synodi Dioecesanae Constantiensis [Copyright: Universitätsbibliothek Freiburg] /
Zur Detailseite ![De Febre Coryzali Das ist: Wahre Beschreibung und Beschaffenheit dieser Epidemischen Krankheit, wie auch deroselben Chur]()
De Febre Coryzali Das ist: Wahre Beschreibung und Beschaffenheit dieser Epidemischen Krankheit, wie auch deroselben Chur [Copyright: Universitätsbibliothek Freiburg] /
Zur Detailseite ![Zwey Primitz-Predigen]()
Zwey Primitz-Predigen [Copyright: Universitätsbibliothek Freiburg] /
Zur Detailseite ![Der Triumphierliche Namen Jesus/ Das ist: Allgemeines/ unfehlbares/ und kräfftiges Hilffs-Mittel, durch welches ein jeglicher Catholischer Christ, sonderbar aber ein Seelsorger sich und die Seinige von allem Unheil bewahren ... ja gar den leydigen Teufel selbsten vermittelst deß allerheiligsten Namen Jesus verjagen/ und überwinden kan]()
Der Triumphierliche Namen Jesus/ Das ist: Allgemeines/ unfehlbares/ und kräfftiges Hilffs-Mittel, durch welches ein jeglicher Catholischer Christ, sonderbar aber ein Seelsorger sich und die Seinige von allem Unheil bewahren ... ja gar den leydigen Teufel selbsten vermittelst deß allerheiligsten Namen Jesus verjagen/ und überwinden kan [Copyright: Universitätsbibliothek Freiburg] /
Zur Detailseite ![Pia et Devota Opuscula]()
Pia et Devota Opuscula [Copyright: Universitätsbibliothek Freiburg] /
Zur Detailseite Previous Next Die Universitäts- und Kreisstadt Konstanz liegt am östlichen Ende ihres Landkreises am Ufer des Bodensees. Das ausgedehnte Stadtgebiet erstreckt sich vom Drumlinhügelland des Bodanrücks im Norden bis zu der vom Seerhein durchflossenen Konstanzer Niederung und dem Bodenseeufer im Süden und Osten. Naturräumlich gehört das gesamte Gebiet zur übergeordneten Einheit des Hegau. Der höchste Punkt liegt nordwestlich der Stadt beim Rohnhauser Hof in Dettingen mit 570 m NN, der tiefste Punkt mit 394,01 m ist der Seespiegel. Das Stadtgebiet hat Anteil an den Naturschutzgebieten Bodenseeufer - Untere Güll, Bodenseeufer (Gemarkung Litzelstetten, Dingelsdorf, Dettingen), Bussensee, Dingelsdorfer Ried, Haagstaffelweiher, Mooswiese, Mühlhaldenweiher, Nördliches Mainauried, Obere Güll und Wollmatinger Ried - Untersee – Gnadensee. Die Stadt Konstanz kam 1805 an Baden und war ab 1807 Sitz eines Oberamtes, ab 1813 eines Bezirksamtes. Aus diesem ging 1939 der Landkreis Konstanz hervor. 1953 wurde die Stadt auf eigenen Wunsch wieder in den Landkreis eingegliedert und 1956 zur Großen Kreisstadt erhoben. Die heutige Stadt entstand durch Eingemeindung der bis dahin selbständigen Orte Allmannsdorf (1915), Wollmatingen (1934), Litzelstetten (1971), Dingelsdorf (1975) und Dettingen (1975). Konstanz ist die größte Stadt am Bodensee mit zwei Hochschulen und Oberzentrum der Region. Da die Stadt aufgrund ihrer Grenzlage weitgehend von Kriegshandlungen verschont wurde, hat sich ein einzigartiges mittelalterliches Stadtbild erhalten. Seit 1945 hat die auch zuvor schon stark industrialisierte Stadt eine deutliche Vergrößerung erfahren. Neue Siedlungs- und Gewerbeflächen entstanden bis Mitte der 1960er Jahre vorwiegend am nördlichen und nordwestlichen Stadtrand, in kleinerem Maße auch im Osten zum See hin. In den 1970er und vor allem den 1980er Jahren wurden weitere Flächen im Westen und Norden erschlossen. Konstanz ist als Grenzstadt Endbahnhof der DB und der SBB mit direktem Anschluss an das Schweizer Bahnnetz; der ÖPNV erfolgt durch die Stadtwerke und den Verkehrsverbund Hegau-Bodensee sowie eine grenzüberschreitende Buslinie nach Kreuzlingen. Die Stadt verfügt über einen Verkehrslandeplatz, während die nächsten Flughäfen in Friedrichshafen, St. Gallen, Zürich und Stuttgart liegen. Über den Bodensee bestehen Schiffsverbindungen und Autofähren. An das Fernstraßennetz ist die Stadt über die B33, B30 und die A81 sowie die schweizerische A7 und die Hauptstraßen 1 und 13 angeschlossen.
Teilort
Wohnplatz
mehr
aufgegangener Ort
mehr
Wüstung
![]()
Wanderungsbewegung Konstanz
![]()
Natürliche Bevölkerungsbewegung Konstanz
![]()
Bevölkerungsdichte Konstanz
![]()
Altersstruktur Konstanz
![]()
Bundestagswahlen (ab 1972) Konstanz
![]()
Europawahlen Konstanz
![]()
Landtagswahlen (ab 1972) Konstanz
![]()
Schüler nach Schularten Konstanz
![]()
Übergänge an weiterführende Schulen Konstanz
![]()
Beschäftigte nach Wirtschaftsbereichen (aktuell) Konstanz
![]()
Aus- und Einpendler Konstanz
![]()
Bestand an Kfz Konstanz
Previous Next 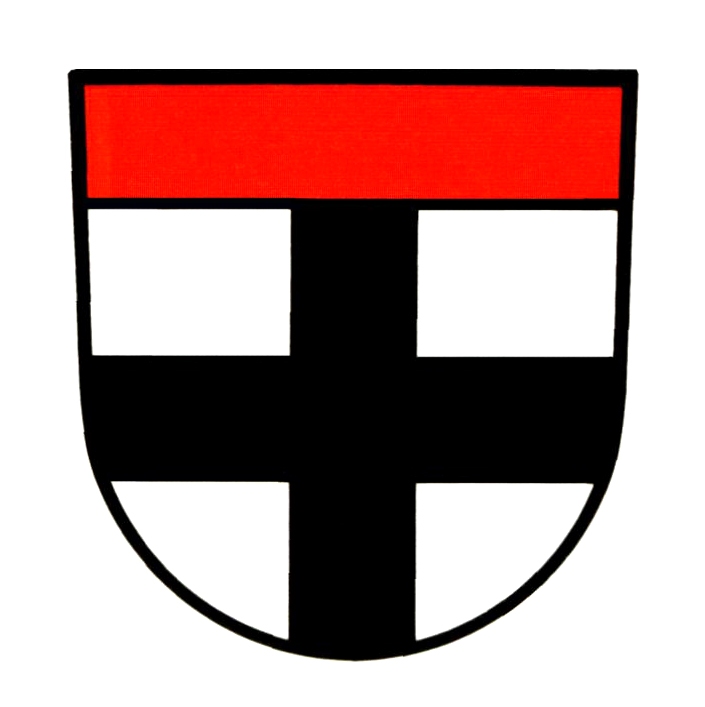
In Silber (Weiß) unter rotem Schildhaupt ein durchgehendes schwarzes Kreuz.
Beschreibung Wappen
Zunächst unter bischöflicher Herrschaft, war Konstanz seit Anfang des 13. Jahrhunderts Reichsstadt (1237 erstmals als solche genannt). Die Siegel (ältester Abdruck 1246) zeigen zunächst eine Stadtmauer mit Tor und Türmen. In einem seit 1397 nachweisbaren Sekretsiegel begegnet erstmals unter dem Tor das Stadtwappen, ein durchgehendes Kreuz, das vom Wappen des Hochstifts Konstanz herzuleiten ist. Die Wappenfarben, die sich von denen des Hochstifts unterscheiden, sind seit 1405 bezeugt. Das Schildhaupt entstand aus dem 1417 von König Siegmund verliehenen roten Zagel über dem Banner. Nachdem die Stadt 1548 österreichisch geworden war, wurde das Siegelbild mit Mauer und Stadtwappen um einen mit dem österreichischen Bindenschild belegten Adler bereichert. Die Stadtfahne, die dem Stadtwappen entspricht, ist 1544 in Jakob Köbels Fahnenbuch abgebildet.
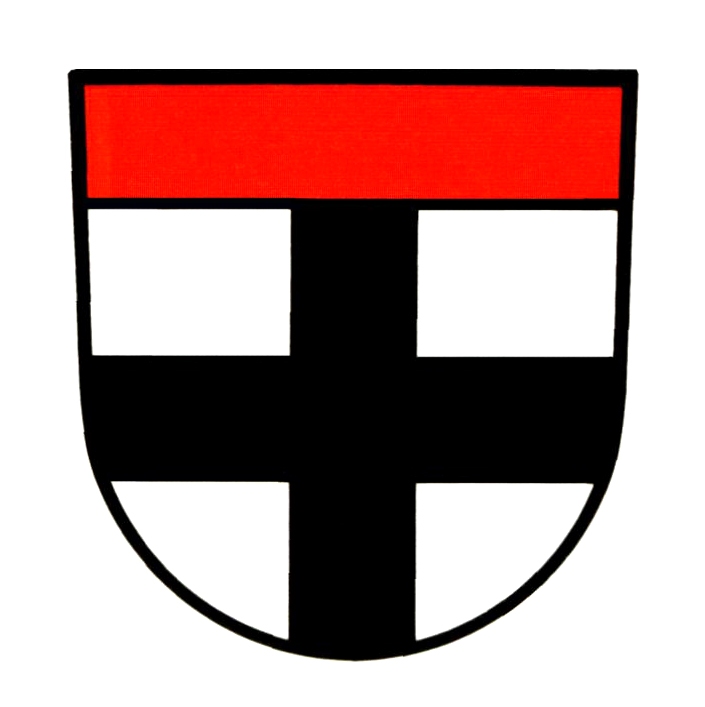
























![[Brief]](/media/ubf_digitalisate/current/delivered/images/oai-dl.ub.uni-freiburg.de-4858/INTROIMAGE.jpg)
![[Brief]](/media/ubf_digitalisate/current/delivered/images/oai-dl.ub.uni-freiburg.de-5341/INTROIMAGE.jpg)



























![[Brief]](/media/ubf_digitalisate/current/generated/images/oai-dl.ub.uni-freiburg.de-4858/INTROIMAGE.jpg.tm.png)
![[Brief]](/media/ubf_digitalisate/current/generated/images/oai-dl.ub.uni-freiburg.de-5341/INTROIMAGE.jpg.tm.png)
































 leobw
leobw