Wiedergründung der jüdischen Gemeinde Württemberg
von Eva Rincke
![Die neue Synagoge in Stuttgart, Blick auf den Brunnen vor dem Eingang im Jahr 1964 [Quelle: Landesmedienzentrum, Foto: Dieter Jaeger] Die neue Synagoge in Stuttgart, Blick auf den Brunnen vor dem Eingang im Jahr 1964 [Quelle: Landesmedienzentrum, Foto: Dieter Jaeger]](/documents/10157/19391930/LMZ030031.jpg/267d955f-0865-c82e-33fb-d0ebaa8953b0?t=1689330256561 )
Am 9. Juni 1945 wurde auf Initiative des Rabbiners Herbert S. Eskin die „Israelitische Kultusvereinigung Württemberg“ (IKVW) gegründet. Als Mitglied der 100. Division der US-Army hatte der Militärgeistliche neben der seelsorgerischen Betreuung der jüdischen Soldaten den Auftrag, nach überlebenden Juden in Württemberg zu forschen und den Wiederaufbau einer jüdischen Gemeinde zu leiten. Auf Eskins Vorschlag hin stellte der neueingesetzte Bürgermeister Arnulf Klett ein Gebäude in der Reinsburgstraße 26 im Stuttgarter Westen zur Verfügung, wo die Gemeinde ein provisorisches Gemeindehaus mit Betsaal einrichtete. Das Gebäude in der Reinsburgstraße 26 wurde im Sommer 1945 von der Stadt Stuttgart beschlagnahmt und der jüdischen Gemeinde zur Verfügung gestellt. Das Gebäude hatte ursprünglich einer jüdischen Familie gehört und war in der NS-Zeit „arisiert“ worden.[1]
Die Gemeindemitglieder und der zehnköpfige erste Gemeindeausschuss waren Holocaustüberlebende, die seit Kriegsende nach und nach in Stuttgart eintrafen. In den Folgejahren kamen auch einige, wenige Rückkehrer aus dem Ausland hinzu. In der ersten Sitzung des frisch gewählten Gemeindevorstands wurde vor allem diskutiert, wie man ein Transportmittel organisieren konnte, um die überlebenden württembergischen Juden aus Theresienstadt und anderen befreiten Konzentrationslagern schnell nach Stuttgart zu holen. Die Versorgung der Gemeindemitglieder mit Lebensmitteln und Unterkunft war zunächst die Hauptaufgabe der neugegründeten Gemeinde.
Außerdem stellte die Gemeinde einen wichtigen Rückzugsraum für die Holocaustüberlebenden dar. Der Kontakt zu Deutschen fiel in den ersten Jahren vielen von ihnen schwer. Josef Warscher, der seit ihrer Gründung im Vorstand der IKVW vertreten war und bis 1960 als Geschäftsführer amtierte, erinnerte sich so an diese Zeit: „Ich habe ungefähr zwei Jahre gebraucht, bis ich fähig war, wieder in ein Café oder Restaurant hineinzugehen. Es gab da eine unsichtbare Wand. Es hat lange gedauert, bis ich wieder Kontakt mit der nichtjüdischen Bevölkerung aufnehmen konnte. Das war nicht aus Absicht, nein, ich konnte das einfach nicht“.[2]
Das Misstrauen gegenüber der nichtjüdischen Bevölkerung war durchaus begründet, denn die von der NS-Propaganda über Jahre angeheizten antisemitischen Vorurteile waren bei Kriegsende nicht automatisch verschwunden. Besonders jüdische „Displaced Persons“[3] aus Polen wurden auch in den Jahren nach Kriegsende von der deutschen Bevölkerung abschätzig behandelt und von der Polizei verfolgt. Die polnischen Juden im Lager in der Oberen Reinsburgstraße stammten hauptsächlich aus Radom. Viele waren als Zwangsarbeiter in einem Außenlager des KZ Natzweiler in Vaihingen/Enz interniert gewesen. Bei einer Razzia im großen DP-Lager in der oberen Reinsburgstraße am 29. März 1946 wurde der Auschwitz-Überlebende Szmul Danzyger, der am Tag zuvor in Stuttgart angekommen war und hier seine Frau und seine Kinder wiedergefunden hatte, von deutschen Polizisten erschossen.[4]
1948 wurde die IKVW eine Körperschaft öffentlichen Rechts. In diesem Jahr stellte die Gemeinde mit Prof. Dr. Heinrich Guttmann den ersten Landesrabbiner ein. Nach seiner Auswanderung in die USA übernahm dann zunächst Kantor Kormann die Durchführung der Gottesdienste.
Seit 1948 gab es in der Repräsentanz Überlegungen zur Wiedererrichtung einer Synagoge. Nachdem das Kultministerium von Württemberg-Baden 1950 die Finanzierung übernahm, konnte mit der Planung begonnen werden. Der Architekt Ernst Guggenheimer errichtete auf den Fundamenten der Synagoge, die in der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 zerstört worden war, ein neues Synagogengebäude.[5]
![Innenraum der Synagoge in Stuttgart im Jahr 1964 [Quelle: Landesmedienzentrum, Foto: Dieter Jaeger] Innenraum der Synagoge in Stuttgart im Jahr 1964 [Quelle: Landesmedienzentrum, Foto: Dieter Jaeger]](/documents/10157/19391930/LMZ030034.jpg/c56ace1d-d055-dc17-2552-80c81d835191?t=1689330268291 )
Am 13. Mai 1952, dem 18. Ihar 5712 nach dem jüdischen Kalender, wurde die neue Synagoge feierlich eingeweiht.[6] Neben der Freude über das neue Gebäude, das auch ein deutliches Zeichen dafür war, dass sich die Gemeinde in Stuttgart wieder fest etabliert hatte, war bei der Einweihung die Trauer sehr präsent: Die Ermordung von Angehörigen und Bekannten, die nicht dabei sein konnten, wurde Gemeindemitgliedern und Gästen bei dem Festakt schmerzlich bewusst. Hinzu kam die Angst, wie die nichtjüdische Bevölkerung auf die neue Synagoge reagieren würde. Ein großes Polizeiaufgebot schützte die Feier. Auch wenn es nicht zu Ausschreitungen kam, zeigten Äußerungen von Passanten wie „Es sind noch viel zu viel übrig geblieben“[7], dass die Befürchtungen nicht aus der Luft gegriffen waren.
Nachdem zwischen 1951 bis 1953 Dr. Siegbert Jitzchak Neufeld als Landesrabbiner in Stuttgart gewirkt hatte, fand die Gemeinde 1953 mit Dr. Fritz Eliezer Bloch schließlich einen Landesrabbiner, der optimal zu den Bedürfnissen der heterogenen Gruppe passte. Mittlerweile stammte die große Mehrheit der Gemeinde aus Polen und war einem frommen, eher traditionell ausgerichteten Judentum verpflichtet, während die deutschen Jüdinnen und Juden zumeist eher liberal eingestellt waren. Rabbiner Bloch hatte in Breslau und Berlin studiert und verstand es, zwischen den „stocksteifen temperamentlosen Jeckischen und den feurigen Söhnen des Ostens“[8] zu vermitteln, wie es der geborene Cannstatter Alfred Marx, damaliger Vorstand der jüdischen Gemeinde und späterer Landgerichtspräsident, ausdrückte. Marx selbst gehörte als gebürtiger Cannstatter eindeutig zu den „Jeckischen“, mit dem Wort „Jecke“ werden in Israel nämlich die deutschen Juden bezeichnet.[9]
Dr. Fritz Eliezer Bloch amtierte bis zu seinem Tod am 28. September 1979 als Landesrabbiner der jüdischen Gemeinde Württemberg, die seit 1966 „Israelitische Religionsgemeinschaft Württemberg“ (IRGW) heißt. In dem Vierteljahrhundert seines Wirkens trug er nicht nur zu einer guten Atmosphäre innerhalb der Gemeinde bei, sondern engagierte sich mit unzähligen Vorträgen, Synagogenführungen und seiner Lehrtätigkeit an der Universität Tübingen auch stark in der nichtjüdischen Öffentlichkeit.[10]
Anmerkungen
[1] Vgl. dazu: Hosseinzadeh, S. 162.
[2] Zitiert nach Hosseinzadeh, S.168.
[3] Als „Displaced Persons“ wurden nach dem Zweiten Weltkrieg Zivilpersonen bezeichnet, die durch die Kriegshandlungen aus ihrer Heimat vertrieben worden waren und auf Hilfe angewiesen waren, um dorthin zurückzukehren oder sich in einem anderen Land anzusiedeln.
[4] Vgl dazu Schulze Wessel, S.192ff.
[5] Zur Architektur der Synagoge vgl. Hosseinzadeh, S.254-260.
[6] In der Festschrift zur Einweihung der Synagoge, die 1952 herausgegeben wurde, finden Sie die Reden, die bei der Einweihung gehalten wurden: https://www.irgw.de/pdf/520513-Festschrift_zur_Einweihung_der_Synagoge_in_Stuttgart_am_18_Ijar_5712_-_13_Mai_1952.pdf
[7] Zitiert nach Hosseinzadeh, S. 261.
[8] Zitiert nach Hosseinzadeh, S. 81.
[9] Mehr zur Biografie des Juristen, der sich trotz der Verfolgung durch das NS-Regime nach 1945 entschied, in Deutschland zu bleiben und als Richter am Landgericht und späterer Landgerichtspräsident einen wichtigen Beitrag zur Demokratisierung der Bundesrepublik leistete: Hosseinzadeh, S. 178f.
[10] Zur Biografie von Dr. Fritz Elieser Bloch vgl. Hosseinzadeh, S. 275-279.
Literatur
- Hosseinzadeh, Sonja, „Wir, ein lebendiger Zweig am grünenden Baum unseres Volkes…“ (Alfred marx, 1949). Die jüdische Gemeinde in Württemberg seit 1945, in: Jüdisches Leben im Wandel der Zeit. 170 Jahre Israelitische Religionsgemeinschaft. 50 Jahre neue Synagoge in Stuttgart, hg. von Israelitische Religionsgemeinschaft Württembergs KdöR, Gerlingen 2002, S. 153-280.
- Schulze Wessel, Julia, Zur Reformulierung des Antisemitismus in der deutschen Nachkriegsgesellschaft. Eine Analyse deutscher Polizeiakten aus der Zeit von 1945 bis 1948, in: Zwischen Selbstorganisation und Stigmatisierung. Die Lebenswirklichkeit jüdischer Displaced Persons und die neue Gestalt des Antisemitismus in der deutschen Nachkriegsgesellschaft, hg. von Susanne Dietrich/Julia Schulze Wessel, Stuttgart 1998, S. 133 - 232.
- Tenné, Meinhard, Die Entwicklung der jüdischen Gemeinde in Württemberg, in: Untergang und Neubeginn. Jüdische Gemeinden nach 1945 in Südwestdeutschland, hg. von Haus der Geschichte Baden-Württemberg, Heidelberg 2009, S. 71-84.
Zitierhinweis: Eva Rincke, Wiedergründung der jüdischen Gemeinde Württemberg, in: Jüdisches Leben im Südwesten, URL: […], Stand: 20.06.2023.



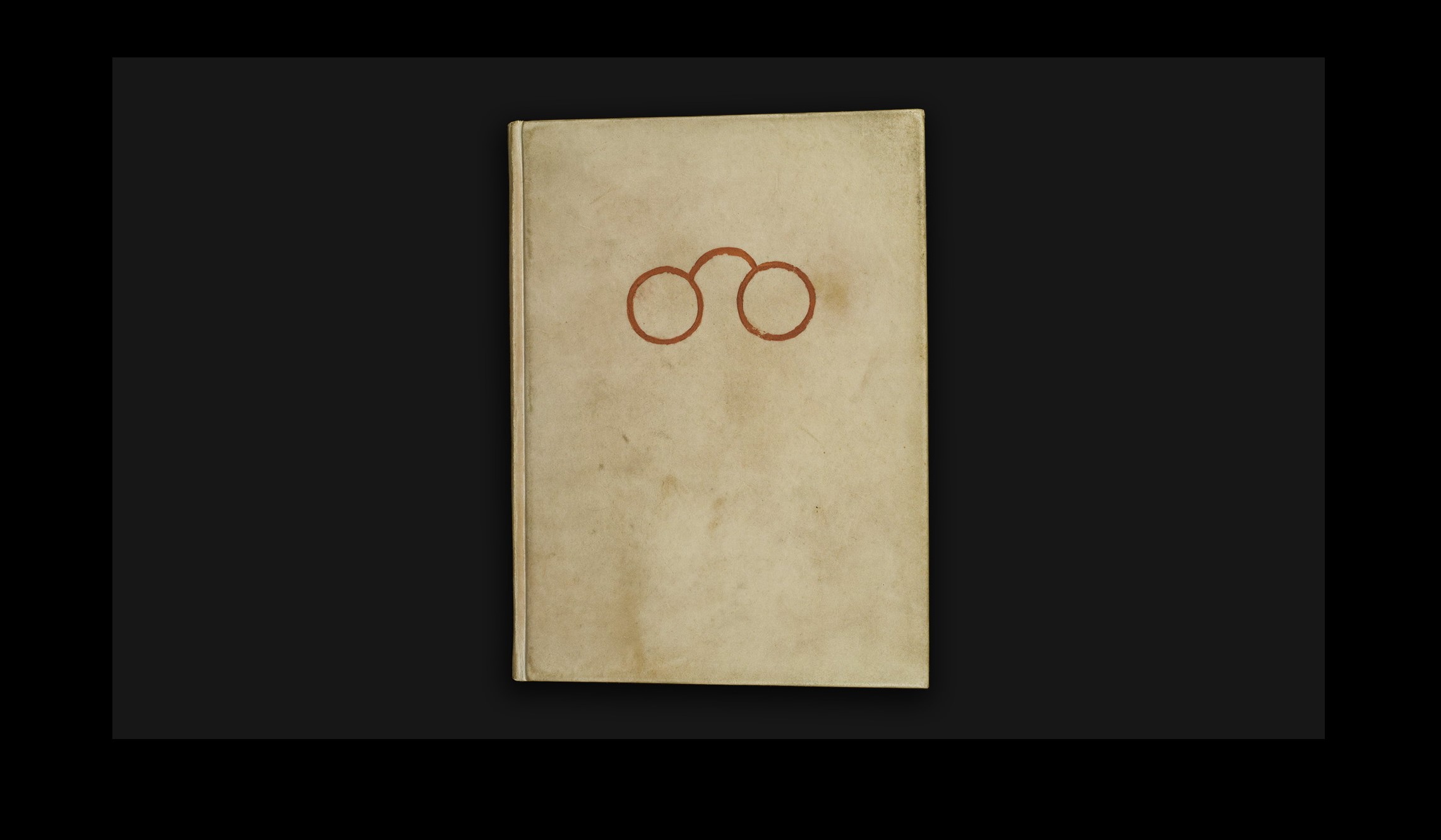
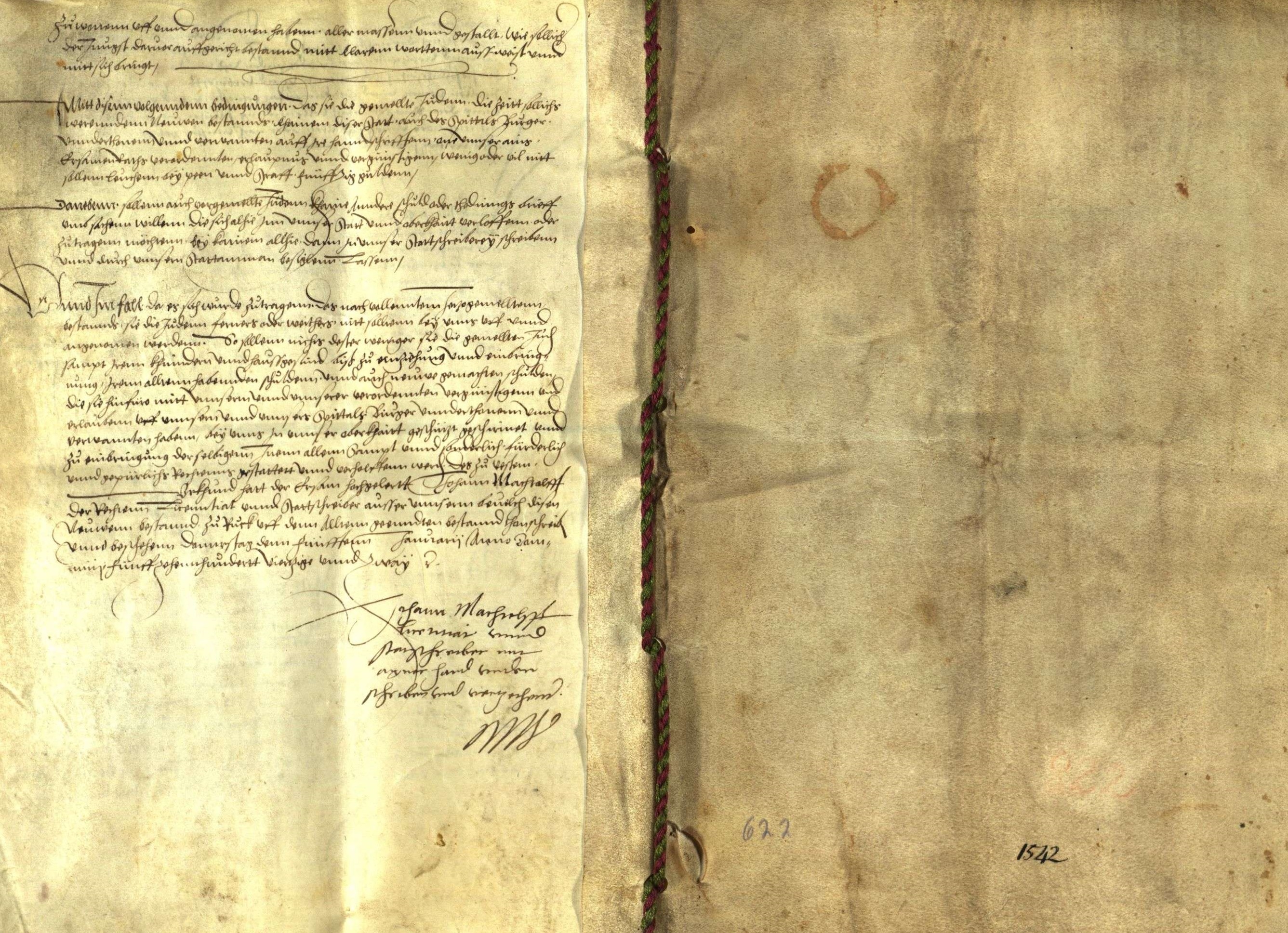
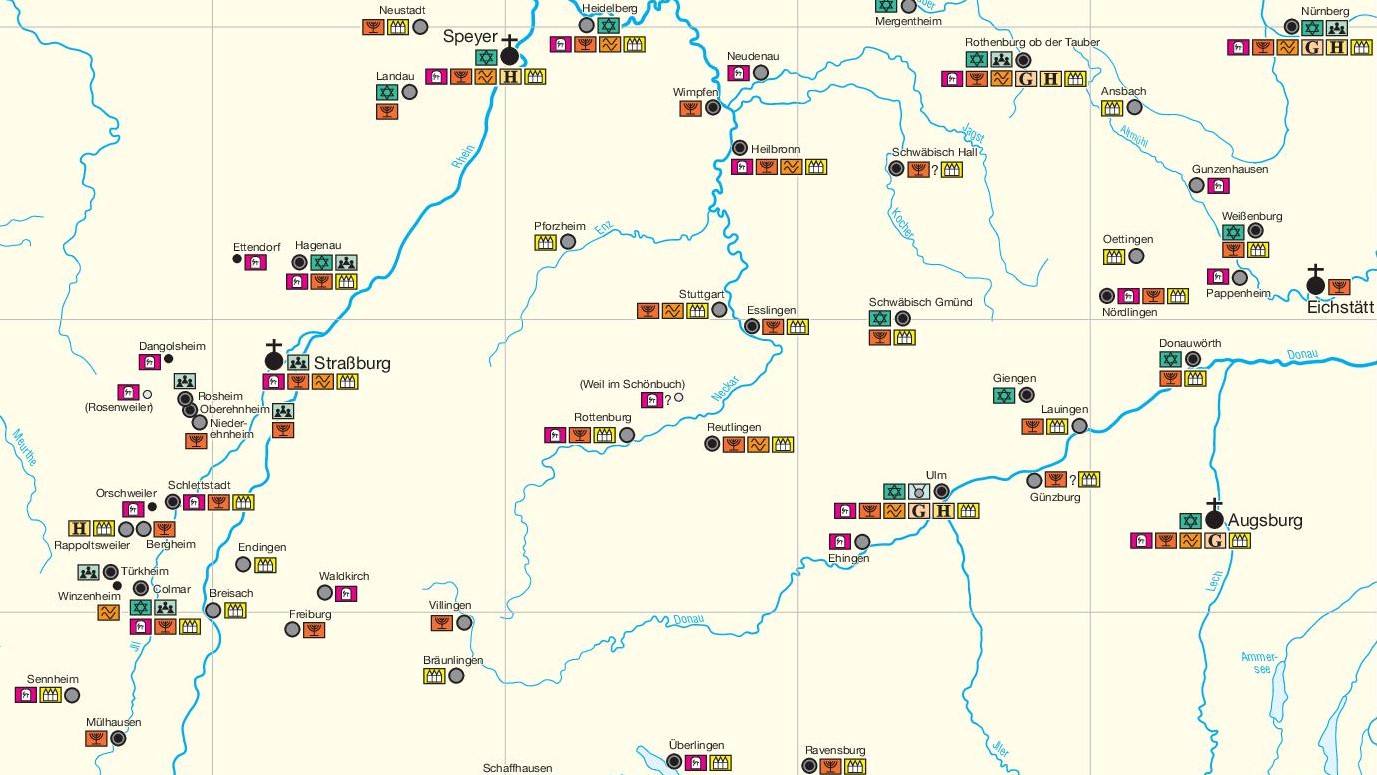
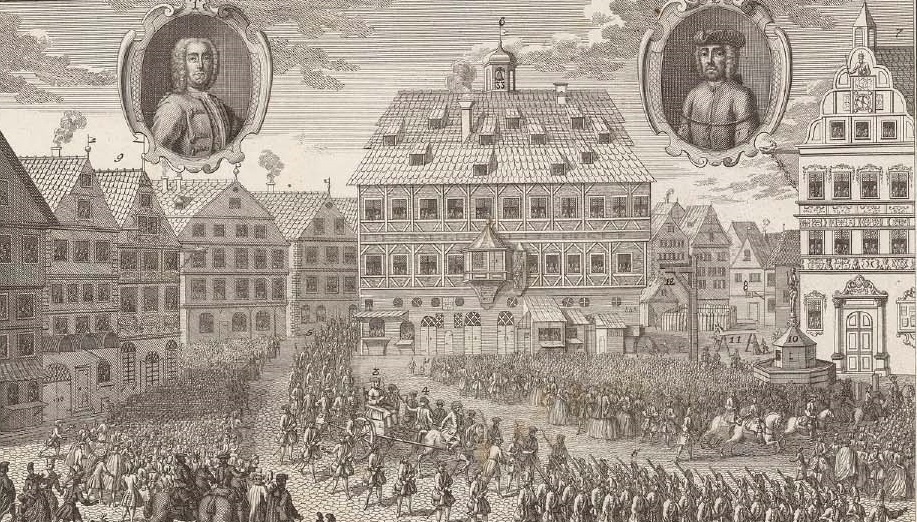




 leobw
leobw