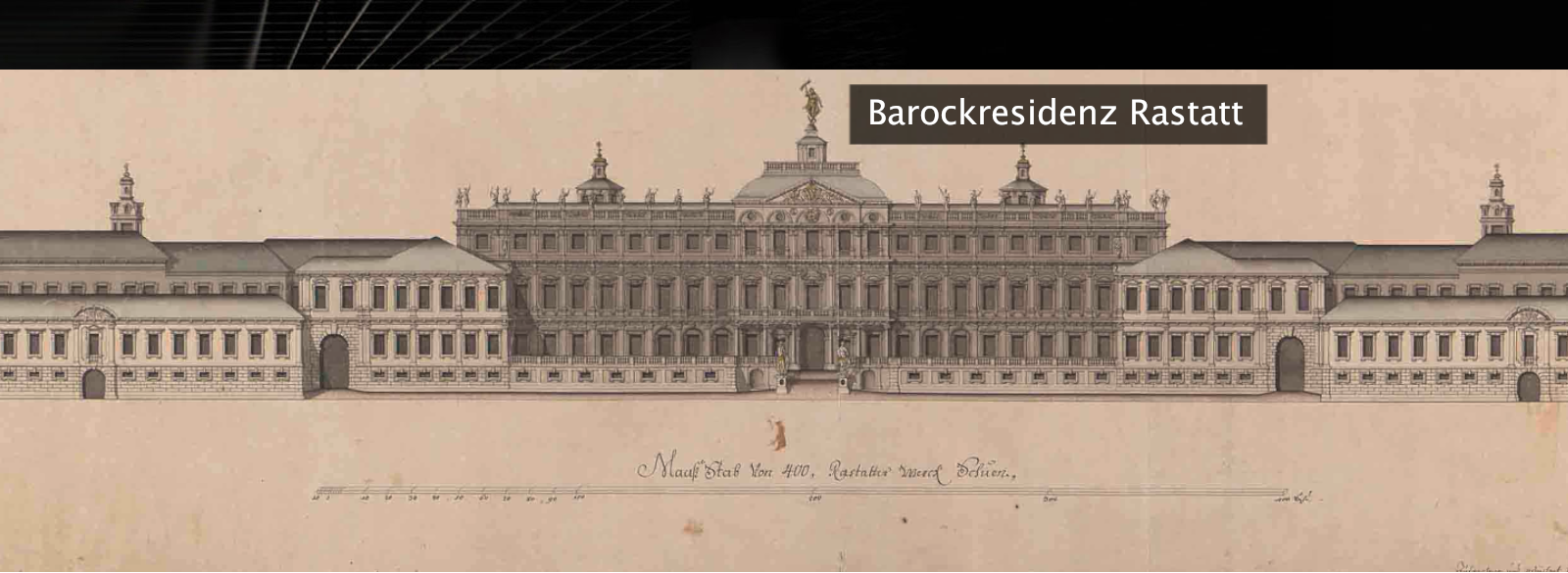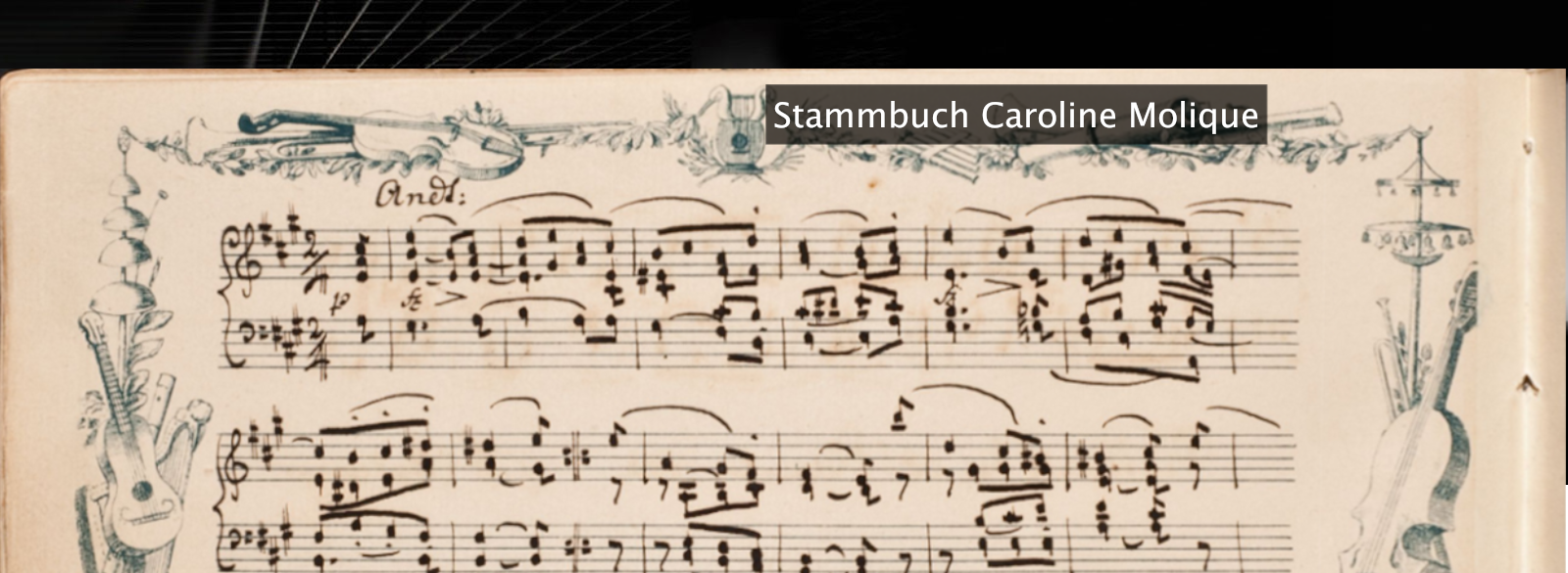Die Überbringung von Nachrichten, insbesondere von Briefen, durch Boten ist in Europa bereits seit dem Frankenreich der Merowinger bezeugt. Zunächst beschränkte sich solch ein Botenverkehr vor allem auf den Austausch zwischen Klöstern. Mit dem Aufkommen der Städte, der Ausdehnung des Handels, der Zunahme der Schriftlichkeit und der Verbreitung des Papiers steigerte sich der der Bedarf an schriftlicher Nachrichtenübermittlung immer weiter. Das seit dem Spätmittelalter ausgedehnte Postwesen im Reichsgebiet hatte sich neben Brief- und Kleingepäckbeförderung bald auch dem Güter- und Personenverkehr angenommen. Etwa seit 1630 bis weit in die Mitte des 18. Jahrhunderts hinein verbanden Landkutschen, die planmäßig auf festen Routen verkehrten, die verschiedenen Regionen des Reichs. Es wurden feste Poststationen aufgebaut, im Abstand von je einer Tagesreise. Diese Poststationen bekamen im Laufe der Zeit erhebliche wirtschaftliche Bedeutung: Sie waren Treffpunkt, Tausch- und Handelsplatz, Pferdestall und nicht zuletzt Herbergen für die Reisenden. Denn die Fahrten mit den Postkutschen waren alles andere als komfortabel. Auf den Holzsitzen der offenen, ungefederten, auf Holzachsen fahrenden Leiterwagen bekamen die Reisenden nicht nur jede Straßenunebenheit unmittelbar zu spüren, sondern waren auch der Witterung direkt ausgesetzt. Wichtiges Utensil für die Fahrer der Postkutschen war das Posthorn, da die Postkutsche immer Vorrang besaß. Auch das Öffnen der Stadttore und Bedarfsankündigung auf den Relaisstationen zum Pferdewechsel wurden mit unterschiedlichen Signalmelodien bereits vor Ankunft mitgeteilt.
Ab 1742 setzte die Reichspost erstmals regelmäßig verkehrende geschwinde Postwagen auf der Strecke von Frankfurt am Main nach Basel über Mannheim, Karlsruhe, Freiburg im Breisgau ein. Sie waren dazu eine ganze Woche lang unterwegs. 1760 wurde die wichtige überregionale Verbindung von Paris über Straßburg/Strasbourg nach München und Wien eröffnet, die allerdings anfangs den Umweg über Offenburg, Heilbronn, Nürnberg nahm. Nicht nur solche Umwege, sondern auch die häufig schlechten Straßen führten zu langen Fahrzeiten. Durch den Gebrauch der üblichen Gabelfuhrwerke waren die selten gut befestigten Straßen und Wege nämlich in der Mitte meist so ausgetreten, dass dort das Wasser nicht abfließen konnte und der Morast eine Befahrung oft kaum mehr möglich machte. Daneben behinderte im Südwesten das Relief mit seinen kräftigen Steigungen über Schwarzwald und Schwäbische Alb die Durchlässigkeit vor allem im Ost-West-Verkehr. Die mit enormem Aufwand betriebene Erneuerung und Verbreiterung der Poststraßen, die Vorschrift, dort statt der Gabelfuhrwerke nur noch die moderneren Deichselwagen zu verwenden, die Neutrassierung in den Gebirgsgebieten mit festgelegten Steigungen von maximal sechs Prozent – in Baden seit 1824, in Württemberg seit 1849 – sowie eine generelle Erweiterung des Routennetzes über Abkürzungsstrecken brachten eine Reduzierung der Fahrzeiten und eine Steigerung des Fahrkomforts. Die Folge war eine Aufstockung des Reiseverkehrs. Doch kamen diese Verbesserungsmaßnahmen zu spät. Ein neues Verkehrsmittel, die Eisenbahn, stand ab 1834 in Baden und ab 1840 in Württemberg bereit. Es trat als Beförderungsmittel rasch in Konkurrenz zur Postkutsche, zumal die frühen Bahnverbindungslinien oft parallel zu den alten Hauptpostrouten verliefen. Mehr über das Postwesen und die damit einhergehende Entwicklung der neuzeitlichen Bevölkerungsmobilität finden Sie im Historischen Atlas Baden-Württemberg sowie im neuen Themenmodul zur "Alltagskultur im Südwesten". (JH)
Die Gleichstellung der jüdischen Bevölkerung wurde im deutschsprachigen Raum erst sehr spät Gegenstand ernsthafter Bemühungen. Entfacht wurde die Diskussion unter anderem vom preußischen Kriegsrat im Berliner Staatsarchiv Christian Wilhelm Dohm, der 1781 auf Bitten von Moses Mendelssohn eine Streitschrift mit dem Titel „Über die bürgerliche Verbesserung der Juden“ veröffentlichte. Dohm forderte darin eine Befreiung der Jüdinnen und Juden aus der Unmündigkeit und eine Gleichstellung mit ihren christlichen Mitbürgern.
Zu den weiteren wichtigen Wegbereitern zählen die Toleranzedikte Kaiser Josephs II. im gleichen Jahr, in deren Folge unter anderem die vorderösterreichische Universität Freiburg für jüdische Studierende geöffnet wurde. Allerdings darf die Wirkung dieser Toleranzedikte nicht überschätzt werden. Abgesehen von einigen Vergünstigungen wurde nicht nur der alte Schutzstatus beibehalten, sondern auch zahlreiche Restriktionen wie das Heiratsverbot und die Einschränkungen der Freizügigkeit erneut betont. Nach der napoleonischen Neuordnung Südwestdeutschlands folgten 1809 das Konstitutionsedikt im Großherzogtum Baden und am 25. April 1828 das "Gesetz in Betreff der öffentlichen Verhältnisse der israelitischen Glaubensgenossen" im Königreich Württemberg. Das Gesetz unterschied sich von anderen, etwas dem badischen Gesetz darin, dass das gesamte religiöse Leben in den bisher autonomen jüdischen Gemeinden der Staatsaufsicht eines Konsistoriums unterstellt wurde. Bei der Gleichstellungspolitik in wirtschaftlicher und kultureller Hinsicht bildete jedoch wie in den meisten Edikten das „erzieherische“ Ziel das Hauptmotiv, Jüdinnen und Juden von einem Teil ihrer bisherigen Erwerbszweige abzubringen. Somit erreichte das Gesetz keineswegs eine volle Gleichstellung und klammerte weiterhin wichtige Fragen der politischen, aber auch der religiösen Emanzipation aus, zum Beispiel die Frage nach der Übernahme von Gemeindeämtern oder nach dem aktiven und passiven Wahlrecht.
Erst am 13. August 1864 erhielt die jüdische Bevölkerung mit dem „Gesetz über die bürgerliche Gleichstellung der Juden im Königreich Württemberg“ schließlich eine weitergehende bürgerliche Gleichberechtigung und 1869 außerdem die Erlaubnis, christliche Mitbürger zu ehelichen. Der jüdischen Bevölkerung in Hohenzollern war diese Aufwertung bereits 1850 nach dem Übergang der beiden Fürstentümer an Preußen vergönnt.
Nunmehr standen der jüdischen Bevölkerung auch politische Ämter offen. So bekleidete etwa 1868 mit dem badischen Finanzminister Moritz Ellstädter erstmals in Deutschland ein jüdischer Mitbürger ein Regierungsamt. Zwei Jahre später trat in Gailingen am Hochrhein der erste jüdische Bürgermeister Deutschlands sein Amt an. Die kurze jüdische Blütephase sollte jedoch schon bald vom rassischen Antisemitismus überschattet und schließlich durch die Barbarei des Nationalsozialismus jäh beendet werden. Weitere Informationen finden Sie im Artikel von Franz-Josef Ziwes zum jüdischen Leben im Südwesten zwischen Autonomie und Obrigkeit. (JH)

Holz aus den Wäldern des Südwestens stellte spätestens seit dem Mittelalter eine begehrte Handelsware dar. Wichtige Voraussetzung für den Vertrieb waren Flüsse und Bäche mit genügend Wasser, meist die einzige Möglichkeit zum Transport auf längeren Strecken und im Schwarzwald reichlich verfügbar. Die Stämme wurden nach dem Schlagen zunächst einzeln auf den Weg geschickt und dann zu Flößen zusammengebunden. Die Flößerei barg Gefahren, erforderte Geschick und Teamarbeit. Je nach Zielgebiet waren die Besatzungen Tage, Wochen oder Monate unterwegs. Ausdrücke des Flößerhandwerks mit ihren regionalen Varianten geben Aufschluss über das harte aber auch gewinnbringende Gewerbe. Zu den bedeutendsten Flößern des Schwarzwalds zählten die an Kinzig, Schiltach und besonders der Murg, die im Gegensatz zu den Rhein- als Waldschiffer bezeichnet wurden. Die alte Murgschifferschaft war eine Vereinigung von Holzhändlern, Wald- und Sägewerksbesitzern an der mittleren Murg mit Sitz in Gernsbach und Geschäftsbeziehungen bis nach Holland.
Die für den Schwarzwald typischen Gestörflöße wurden aus mehreren Teilen zusammengesetzt, die jeweils aus Holz gleicher Länge und Dicke bestanden. Der süddeutsche Holzhandel verwendete als zentrale Maßeinheit den Klotz. Ein Klotz bezeichnete Stämme bis zu 13 m Länge und durchschnittlich 26 cm Durchmesser. An den Einbindestellen schlugen die Flößer Löcher in die Stammenden. Als Verbundmaterial dienten Wieden, Seile aus jungen schlanken Hölzern, die durch Erhitzen und Wässern die nötige Biegsamkeit erhielten. An den Seiten der Flöße kamen dickere Eckbäume zu liegen, am vorderen Ende eine als Vorholz bezeichnete Spitze mit der Schlenkerung zum Steuern. Beim Einbinden und auf dem Wasser arbeiteten die Flößer im Gespann, meistens paarweise zusammen. Die fertigen Gestörflöße fuhren unter Größenbezeichnungen als Dreier oder Fünfer. Neben den Schiffern als Geschäftseignern durften die Flößerknechte der Kinzig auf eigene Rechnung Katzenflöße betreiben, die aus kleineren Hölzern und Brettern zusammengesetzt waren. Durch die Handelsbeziehungen fanden auch über größere Distanzen hinweg fremdsprachliche Begriffe Eingang in die Arbeitswelt. So nutzten die Kinzigschiffer Anmährpfähle zum Festmachen, eine ans Holländische angelehnte Bezeichnung. In anderen Gegenden, so am Neckar, kam zu diesem Zweck ein Esel zum Einsatz, ein hölzernes Gestell, das auch auf dem Floß mitgeführt werden konnte und hier zum Aufhängen und Befestigen mitgeführter Gegenstände diente.
Auf dem Weg zu den Abnehmern mussten die Flöße Hindernisse wie Stromschnellen oder Wehre passieren. An Mühlen und anderen Bauwerken waren Flößgassen eingerichtet. In den Wehren befand sich ein Floßloch, das mit einer brettartigen Diele, auch Gamber, an der Schiltach als Schnapper bezeichnet, geöffnet werden konnte. Für die Passage war ein festgesetztes Lochgeld zu bezahlen. Wegen des ausgeprägten Gefälles und der starken Strömung der Schwarzwaldgewässer wurden Sperren entwickelt, Bremsvorrichtungen, die an der Kinzig ab dem 17. Jh. zum Einsatz kamen. Sie drückten auf den Boden und verhinderten, dass sich die Gestöre übereinander schoben. Auch in früheren Zeiten entstanden durch Ausbeutung gravierende Schäden, blieben Rücksicht auf Natur und Umwelt zweitrangig. So erhoben sich Proteste, weil die Sperren die Fischbestände vernichten konnten. Das Abholzen der Wälder und die Floßbarmachung von Gewässern sowie das Ablassen der aufgestauten Wassermassen, die Schwallung für die Trift des geschlagenen Holzes, führten zu Erosion und Verödung.
Auf die Fahrt über die wilden Flüsse der Schwarzwaldtäler folgte der Fernhandel auf dem Rhein. Die hier eingesetzten Holländerflöße bewegten sich in gigantischen Dimensionen, besonders in der Blütezeit des Holzhandels ab der zweiten Hälfte des 17. Jh. Das Holländerholz umfasste Stämme von 18 m Länge und einem Durchmesser von ca. 30 cm und wurden an allen großen Rheinhäfen umgeschlagen. Neben dem Schwarzwald als Hauptliefergebiet kam das Holz auch aus anderen Mittelgebirgen, die über Zuflüsse zum Rhein verfügten. Das Hauptstück eines großen Holländerfloßes bestand aus einem unbeweglichen rechteckigen Kern mit einer Länge von bis zu 250 m, auf dem Hütten errichtet wurden, in der Waren und Mannschaft Platz fanden. Die Hütte der Floßherren konnte recht komfortabel ausgestattet sein. Die Besatzung übernachtete in einfacheren Unterkünften auf Stroh. An das Kernteil oder Steifstück schlossen sich bewegliche Knieteile an. Auf großen Flößen arbeiteten 500 Menschen und mehr. Die Flöße mussten durch Muskelkraft auf Kurs gehalten und je nach Wasserstand auch vorwärtsbewegt werden. Mitunter war es nicht möglich, unterwegs zu ankern. Wurde geankert, kamen spezielle Ankerknechte zum Einsatz, die die Ankervorrichtungen auch bei Kurswechseln zu bedienen hatten. Hundanker verhinderten das Abtreiben am Ufer. Die mit dem Floß verbundenen Ankernachen gehörten zu einem Tross mehrerer Beiboote, die das Floß begleiteten. Die Besatzungen verpflegten sich selbst über eine Kochstelle oder Küche. Zum Proviant für die schwer arbeitende Besatzung zählte Bier und lebendes Vieh. Das Verteilen der Mahlzeiten auf den langgestreckten Fahrzeugen erfolgte über hölzerner Zuber, genannt Back, den die Mannschaftseinheiten gemeinsam auslöffelten.
Ab dem 19. Jh. und mit der Industrialisierung veränderte sich die das Flößereigewerbe. Die Murgschifferschaft entwickelte sich zu einem Forstbetrieb auf genossenschaftlicher Basis, der bis heute existiert. Transportschiffe lösten die Flöße auf dem Rhein ab. Die Ära der Rheingiganten endete 1968 mit dem letzten gewerblichen Einsatz eines Holzfloßes.

Über 45 Jahre lebte Herzogin Henriette von Württemberg, die als Tochter des Hauses Nassau-Weilburg am 22. April 1780 in Kirchheimbolanden in der Pfalz geboren wurde, auf Schloss Kirchheim. Die Familie hatte nach schwierigen Jahren in der Stadt an der Teck Zuflucht gefunden. Als Ehemann Ludwig 1817 starb, widmete sich Henriette caritativen Aufgaben, wofür sie von den Einwohnern sehr geschätzt wurde. Hilfe war dringend nötig, fiel doch der Tod des Ehemannes in die Hungerjahre nach Ausbruch des Vulkans Tambora. Ihr Engagement verdeutlicht als eines von vielen Beispielen, mit welchen Maßnahmen den sozialen Erfordernissen in der ersten Hälfte des 19. Jh. begegnet wurde. Bereits 1817 unterstützte Henriette die neu eröffnete Industrieschule für mittellose Kinder und stand ab 1821 dem ebenfalls neu gegründeten Wohlfahrtsverein vor. Zusammen mit der Stadt, der Oberamtei und einem Stiftungsrat wurde 1826 das Waisenhaus Paulinenpflege realisiert, das sich am Vorbild des Stuttgarter Waisenhauses orientierte. Mitbegründerin des Stuttgarter Waisenhauses war Henriettes Tochter Pauline, verheiratet mit König Wilhlem I. von Württemberg. Außerdem entstanden eine Kleinkinderschule und ein nach neuesten Maßstäben konzipiertes Krankenhaus. Henriette galt als geistig rege, sehr gläubige und bescheidene Frau, die den Kontakt zur Bevölkerung nicht scheute. Mit ihrer Initiative zur Gründung einer Freiwilligen Feuerwehr zeigte sie erneut Interesse an Innovationen.
Nicht nur über Pauline war Henriette eng mit dem Stuttgart Königshaus verbunden, wo sie viele Vorbilder für die sozialen Einrichtungen gefunden haben mag. Sie genoss das Vertrauen König Friedrichs I. von Württemberg, einem Bruder ihres Ehemanns. Tiefe Freundschaft bestand auch zu Katharina, der 1819 verstorbenen zweiten Ehefrau König Wilhelms I.
Die Ehe mit Herzog Ludwig von Württemberg war 1797 in Bayreuth geschlossen worden. Der Umgang mit dem autoritären und hoch verschuldeten Ludwig scheint Fingerspitzengefühl erfordert zu haben. Nur mithilfe seines Bruders war dieser 1811 nach mehrmonatiger Inhaftierung durch seine Gläubiger in Warschau freigekommen. Daraufhin erhielt die Familie Schloss Kirchheim als Wohnsitz zugewiesen. Der Verbindung entstammten fünf Kinder, von denen die Töchter und Enkelinnen in verschiedene europäische Herrscherhäuser einheirateten. Henriette starb am 2. Januar 1857 und wurde in der Stuttgarter Stiftskirche beigesetzt. Enkel Franz Paul Ludwig (1837-1900) und seine Schwestern erhielten als erste offiziell den Titel der Fürsten von Teck. Franz war der Vater der späteren Königin Mary, der Großmutter Königin Elisabeths II.
Zum Weiterlesen: Biographisches Lexikon des Hauses Württemberg
Die Seitenlinie der Herzöge von Teck
Henriette, Herzogin von Württemberg-Teck (1780-1857)
Ludwig (Louis), Herzog von Württemberg-Teck (1756-1817)
Schlösser und Gärten: Schloss Kirchheim - Landesfestung und Witwensitz Württembergs
Am 17. April 1921 erschien in der Volksstimme, einem Parteiorgan der Mannheimer Sozialdemokraten, ein Artikel von Anna Blos mit dem Titel Die Gleichberechtigung der Geschlechter, in dem sie anprangerte, dass allein mit der Durchsetzung des Frauenwahlrechts noch keineswegs die Gleichberechtigung der Frau erreicht worden war. Anna Blos, die am 4. August 1866 als Anna Berta Antonia Tomasczewska in Liegnitz (Niederschlesien) geboren wurde, engagierte sich zu diesem Zeitpunkt schon lange als sozialdemokratische Politikerin. In den Jahren 1919/20 gehörte sie für die SPD der tagenden Weimarer Nationalversammlung an. Sie war dort die einzige Frau aus ganz Südwestdeutschland. Insgesamt betrug der Anteil weiblicher Abgeordneter zu diesem Zeitpunkt weniger als zehn Prozent.
Ihr Artikel in der Volksstimme liest sich einerseits als historischer Abriss des bereits zurückgelegten Wegs zur Gleichberechtigung von Mann und Frau sowie als Prognose des noch bevorstehenden Wegs zur Gleichstellung. Vor allem aber gilt Die Gleichberechtigung der Geschlechter als Darstellung des Selbstverständnisses der sozialdemokratischen Frauenbewegung.
Auf die Lage der Frau im Jahr 1921 Bezug nehmend beschreibt Anna Blos, dass „sich in ihrer abhängigen Lage wenig geändert hat“ und begründet dies insbesondere mit der „Arbeit im Hause“, da diese „das alte Abhängigkeitsverhältnis wieder mit sich [bringt].“ Mit der Industrialisierung und der gesellschaftlichen Etablierung des kleinbürgerlichen Familienideals verfestigte sich eine geschlechtsspezifische Arbeitsteilung in Form der innerhäuslichen und außerhäuslichen Arbeitsteilung zwischen Frau und Mann. Da „die Arbeit im Hause […] unbezahlte, darum unterschätzte Arbeit [ist]“, trug diese einerseits zu dem einseitigen Abhängigkeitsverhältnis zu Lasten der Frau und andererseits, durch die Abwertung der innerhäuslichen Arbeit beziehungsweise die Aufwertung der außerhäuslichen Arbeit, zu der Ungleichwertigkeit von Frau und Mann bei. Dieses hierarchische Geschlechterverhältnis bestimmte nicht nur den privaten Lebensbereich der Frau, sondern auch ihren öffentlichen Lebensbereich. Hier hat laut Anna Blos' die sozialdemokratisch geprägte geschlechtsspezifische Emanzipationsstrategie anzusetzen. Die Frage, wie Gleichberechtigung erreicht werden kann, beantwortet Anna Blos damals mit der Feststellung: „Zunächst müssen wir uns wohl darüber klar werden, daß Gleichberechtigung keineswegs Gleichartigkeit bedeutet. […] Beide Geschlechter sind unentbehrlich, also sind beide gleich wichtig.“ Demnach verstand Blos unter der Gleichberechtigung der Frau nicht eine vollkommene Gleichheit von Frau und Mann. Viel eher sollte das Ziel der Gleichberechtigung sein, dass die Frau mithilfe spezifisch weiblicher Tätigkeiten in dem privaten und öffentlichen Lebensbereich ihre Persönlichkeit innerhalb ihrer Geschlechtsspezifität weiterentwickelt, um somit in diesen Lebensbereichen die männliche Persönlichkeit zu ergänzen und letztendlich nicht nur die Entwicklung der Frau, sondern die Entwicklung der Menschen überhaupt zu vervollkommnen.
Dieser Ansatz geriet ab Mitte der 1920er Jahre zunehmend in die Kritik, da er Unterschiede eher zementierte und an einer geschlechtsspezifischen Diskriminierung kaum etwas änderte. Vielmehr forderte die SPD später wieder eine Rückbesinnung auf die sozialistische Emanzipationstheorie nach dem Vorbild Clara Zetkins.
Den ausführlichen Artikel zu Anna Blos finden Sie in dem LEO-BW-Themenmodul zur Weimarer Republik. (JH)
Zeige 276 bis 280 von 609 Einträgen.
LEO-BW-Blog

Herzlich willkommen auf dem LEO-BW-Blog! Sie finden hier aktuelle Beiträge zu landeskundlichen Themen sowie Infos und Neuigkeiten rund um das Portalangebot. Wir freuen uns auf Ihre Kommentare zu den einzelnen Posts.
Über den folgenden Link können Sie neue Blog-Beiträge als RSS-Feed abonnieren: